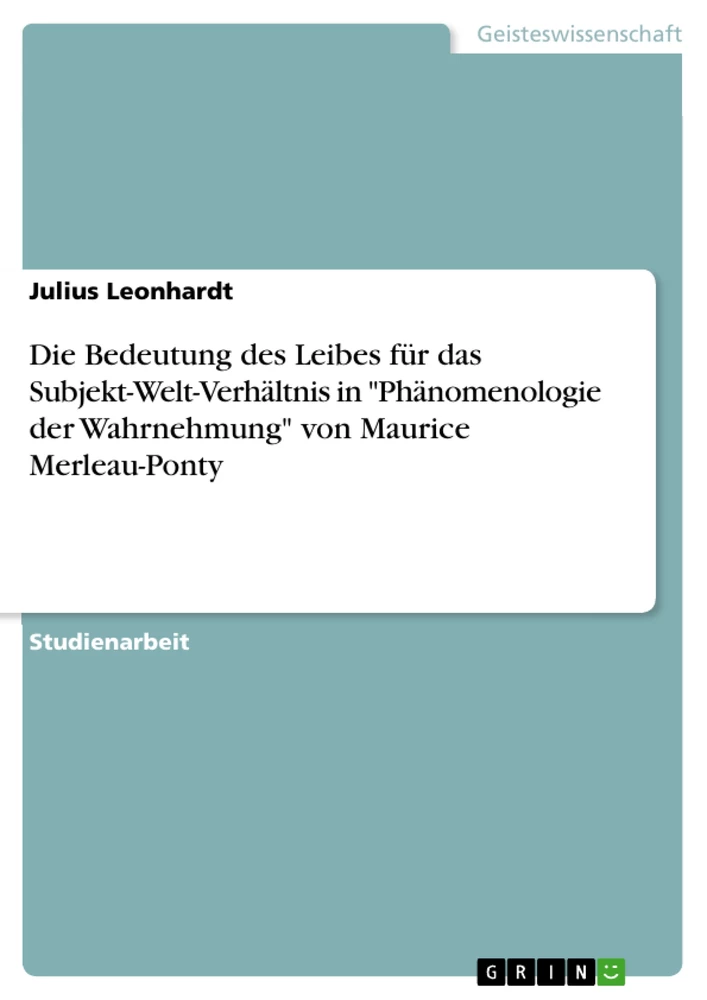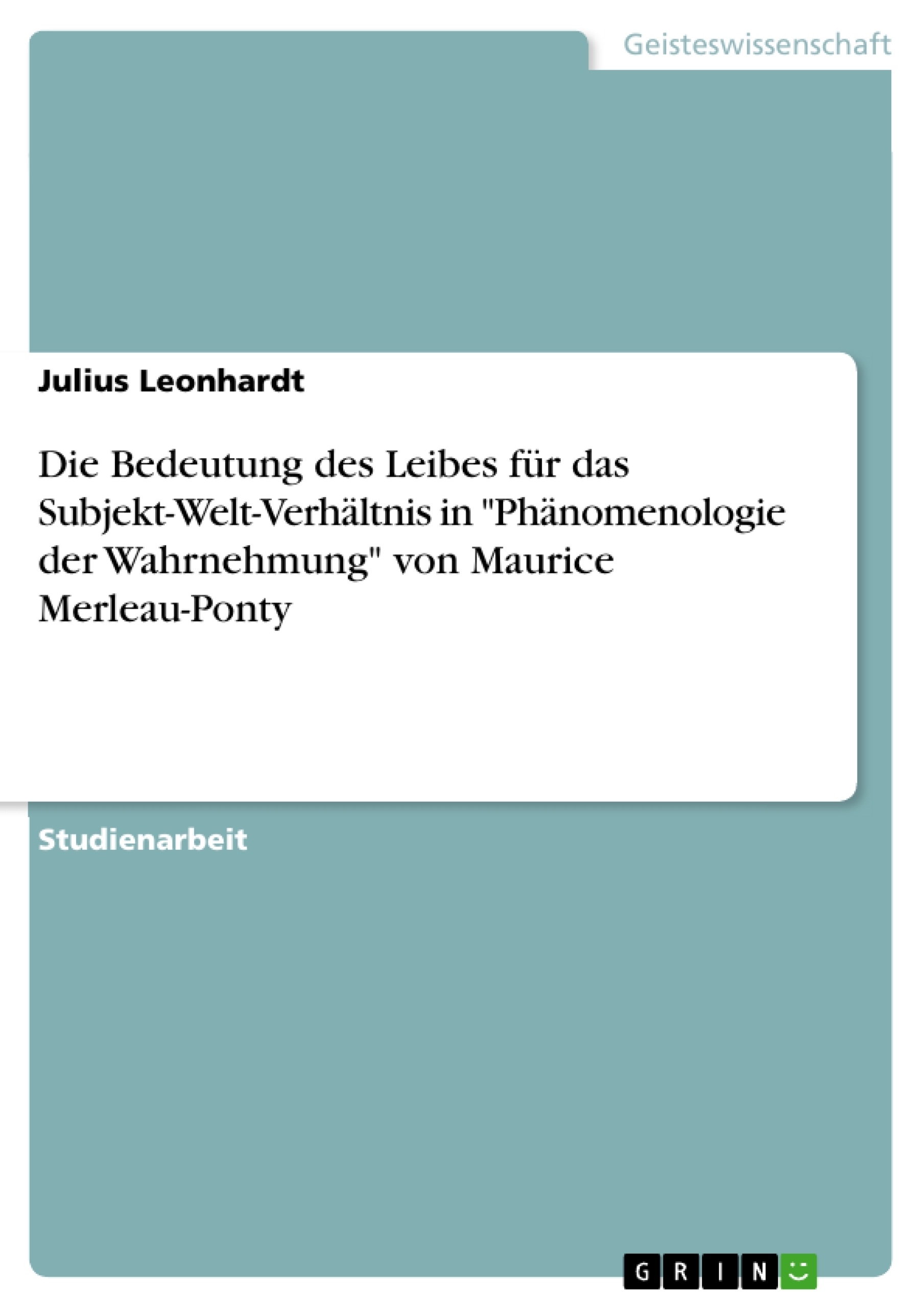Die Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit Maurice Merleau-Pontys Konzept des Leibes und dessen von ihm als grundlegend deklarierte Bedeutung für das Verhältnis des Subjekts zu seiner Umwelt.
Um dieser These nachzugehen, interpretiere ich hauptsächlich Textstellen aus dem Werk „Phänomenologie der Wahrnehmung“. Außerdem möchte ich im letzten Teil der Arbeit eben jene Konzeption und die daraus resultierende Schlussfolgerung für Subjekt und Welt kritisch hinterfragen.
Maurice Merleau-Ponty eröffnet mit seiner Frage nach dem Leib einige der grundlegendsten Fragen der Philosophie und gibt im selben Moment auch eine umfassende Antwort auf diese. In seinem Werk setzt er sich mit Fragen nach der Zeit, dem Anderen, der Welt, dem Bewusstsein und der Freiheit auseinander und entwickelt nicht nur einen Ansatz, der diese zufriedenstellend erklären kann, sondern zeigt auch, welche fundamentalen Fehlannahmen die bisherigen zeitgenössischen, als auch vergangenen Erklärungsmodelle sowohl in der Philosophie als auch in den Naturwissenschaften begangen haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Empirismus und Intellektualismus
- 2.1 Der Empirismus
- 2.2 Der Intellektualismus
- 3. Die Ständigkeit des Leibes
- 4. Der engagierte Leib
- 5. Die Doppeldeutigkeit des Leibes
- 6. Das Einwohnen
- 7. Die Offenheit des Leibes und der Welt
- 8. Der wahrgenommene Gegenstand
- 9. Ganzheitliche Wahrnehmung und das Ding-an-sich-für-uns
- 10. Das Subjekt und die Welt
- 11. Kritik: Wissen und Erfahrung
- 12. Schluss
- 13. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Maurice Merleau-Pontys Konzept des Leibes und dessen Bedeutung für das Subjekt-Welt-Verhältnis, basierend auf dessen Werk „Phänomenologie der Wahrnehmung“. Sie rekonstruiert Merleau-Pontys Kritik am Empirismus und Intellektualismus und präsentiert seine alternative phänomenologische Herangehensweise. Schließlich wird eine kritische Auseinandersetzung mit Merleau-Pontys Leibkonzeption angestrebt.
- Merleau-Pontys Kritik am Empirismus und Intellektualismus
- Das Konzept des Leibes als Konstitutionsort des Sinns
- Die Überwindung der Subjekt-Objekt-Dichotomie
- Das Zur-Welt-Sein des Subjekts
- Eine kritische Auseinandersetzung mit Merleau-Pontys Leibkonzeption
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Auseinandersetzung mit Merleau-Pontys Konzept des Leibes und dessen Bedeutung für das Subjekt-Welt-Verhältnis. Sie betont die kritische Hinterfragung der Konzeption und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Erklärungsmodellen aus Philosophie, Medizin, Psychologie und Physik. Merleau-Pontys Ansatz wird als Rückkehr "zu den Sachen selbst" innerhalb der phänomenologischen Tradition dargestellt, wobei der Leib als Konstitutionsort des Sinns hervorgehoben wird. Die Arbeit skizziert den methodischen Aufbau, der mit der Rekonstruktion der Kritik am Empirismus und Intellektualismus beginnt, um anschließend die Leiberfahrung als Alternative aufzuzeigen und die Beziehung des Subjekts zu den Dingen neu zu definieren. Eine abschließende kritische Auseinandersetzung mit der Leibkonzeption ist vorgesehen.
2. Empirismus und Intellektualismus: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Merleau-Pontys Kritik am Empirismus und Intellektualismus. Es werden die grundlegenden Kritikpunkte kurz dargestellt, welche den Ausgangspunkt von Merleau-Pontys Denken bilden. Obwohl eine detaillierte Auseinandersetzung nicht im Fokus steht, werden im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder Beispiele aus diesen Denktraditionen herangezogen, um Merleau-Pontys Thesen zu illustrieren. Das Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis der weiteren Argumentation.
2.1 Der Empirismus: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Merleau-Pontys Kritik am Empirismus. Er beschreibt, wie Merleau-Ponty eine Vielzahl von Wissenschaften und Wissenschaftsausrichtungen unter den Begriff des Empirismus subsumiert, die alle eine gemeinsame Perspektive auf die Welt, das Bewusstsein und den Leib teilen. Merleau-Ponty kritisiert die empiristische Reduktion der Wahrnehmung auf ein Reiz-Reaktions-Schema, indem er am Beispiel der Wahrnehmung der Farbe Rot aufzeigt, dass die sinnesphysiologische Beschreibung nicht mit der phänomenalen Erfahrung übereinstimmt. Die phänomenale Wirklichkeit ist durch Wahrnehmungskontexte durchdrungen, die das Kausaldenken nicht erklären kann. Der Empirismus, so argumentiert Merleau-Ponty, zwingt der phänomenalen Welt Kategorien auf, die eigentlich für die wissenschaftliche Welt geschaffen sind. Er kritisiert weiter den Anspruch des Empirismus auf einen neutralen, unbedingten Gesichtspunkt, der das Gebunden-sein an die eigene leibliche Perspektive und den Subjektstatus ignoriert. Merleau-Ponty betont stattdessen das "Zur-Welt-Sein" des Subjekts als Ausgangspunkt der Welterfahrung.
Schlüsselwörter
Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Leib, Subjekt-Welt-Verhältnis, Empirismus, Intellektualismus, Zur-Welt-Sein, Wahrnehmung, Phänomenologie, Leiblichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Phänomenologie der Wahrnehmung" von Maurice Merleau-Ponty
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Maurice Merleau-Pontys Konzept des Leibes und dessen Bedeutung für das Verhältnis zwischen Subjekt und Welt, basierend auf seinem Werk "Phänomenologie der Wahrnehmung". Sie untersucht kritisch den Empirismus und Intellektualismus und präsentiert Merleau-Pontys phänomenologische Alternative. Ein zentraler Aspekt ist die kritische Auseinandersetzung mit Merleau-Pontys Leibkonzeption.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Merleau-Pontys Kritik am Empirismus und Intellektualismus, dem Leib als Konstitutionsort des Sinns, der Überwindung der Subjekt-Objekt-Dichotomie, dem "Zur-Welt-Sein" des Subjekts und einer kritischen Auseinandersetzung mit Merleau-Pontys Leibkonzeption.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik und den methodischen Aufbau beschreibt. Es folgt ein Kapitel zur Kritik am Empirismus und Intellektualismus, gefolgt von Kapiteln, die Merleau-Pontys Konzept des Leibes detailliert darstellen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Quellenverzeichnis. Es werden Kapitel zu einzelnen Aspekten des Leibes (Ständigkeit, Engagement, Doppeldeutigkeit, Einwohnen, Offenheit) sowie zu Wahrnehmung und dem Verhältnis von Subjekt und Welt behandelt. Eine abschließende kritische Auseinandersetzung rundet die Arbeit ab.
Wie wird Merleau-Pontys Kritik am Empirismus dargestellt?
Merleau-Ponty kritisiert die empiristische Reduktion der Wahrnehmung auf ein Reiz-Reaktions-Schema. Er argumentiert, dass die sinnesphysiologische Beschreibung nicht mit der phänomenalen Erfahrung übereinstimmt und dass der Empirismus der phänomenalen Welt Kategorien aufzwingt, die eigentlich für die wissenschaftliche Welt geschaffen sind. Er kritisiert den Anspruch des Empirismus auf einen neutralen Gesichtspunkt, der das Gebunden-sein an die eigene leibliche Perspektive ignoriert und betont stattdessen das "Zur-Welt-Sein" des Subjekts.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Leib, Subjekt-Welt-Verhältnis, Empirismus, Intellektualismus, Zur-Welt-Sein, Wahrnehmung, Phänomenologie, Leiblichkeit.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine rekonstruktive und kritische Methode. Sie rekonstruiert zunächst Merleau-Pontys Kritik am Empirismus und Intellektualismus, um anschließend seine alternative phänomenologische Herangehensweise zu präsentieren und kritisch zu diskutieren. Der Ansatz wird als "Rückkehr zu den Sachen selbst" innerhalb der phänomenologischen Tradition beschrieben.
Welche Quellen werden verwendet?
Ein detailliertes Quellenverzeichnis wird am Ende der Arbeit aufgeführt. Die Arbeit bezieht sich primär auf das Werk "Phänomenologie der Wahrnehmung" von Maurice Merleau-Ponty und berücksichtigt relevante philosophische, medizinische, psychologische und physikalische Erklärungsmodelle.
- Arbeit zitieren
- Julius Leonhardt (Autor:in), 2020, Die Bedeutung des Leibes für das Subjekt-Welt-Verhältnis in "Phänomenologie der Wahrnehmung" von Maurice Merleau-Ponty, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1038558