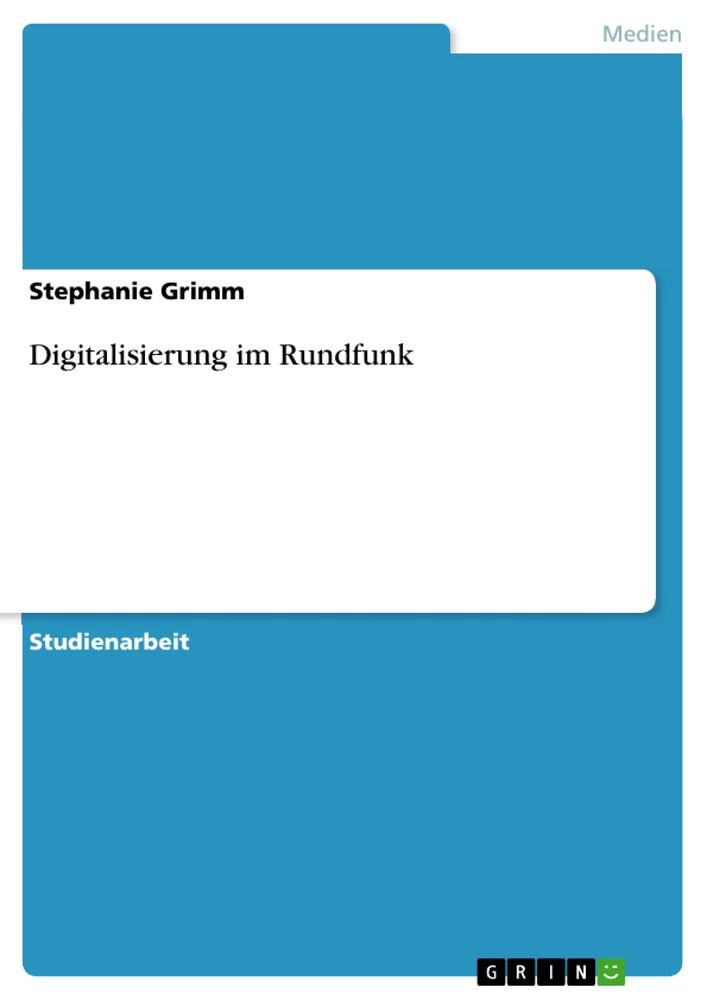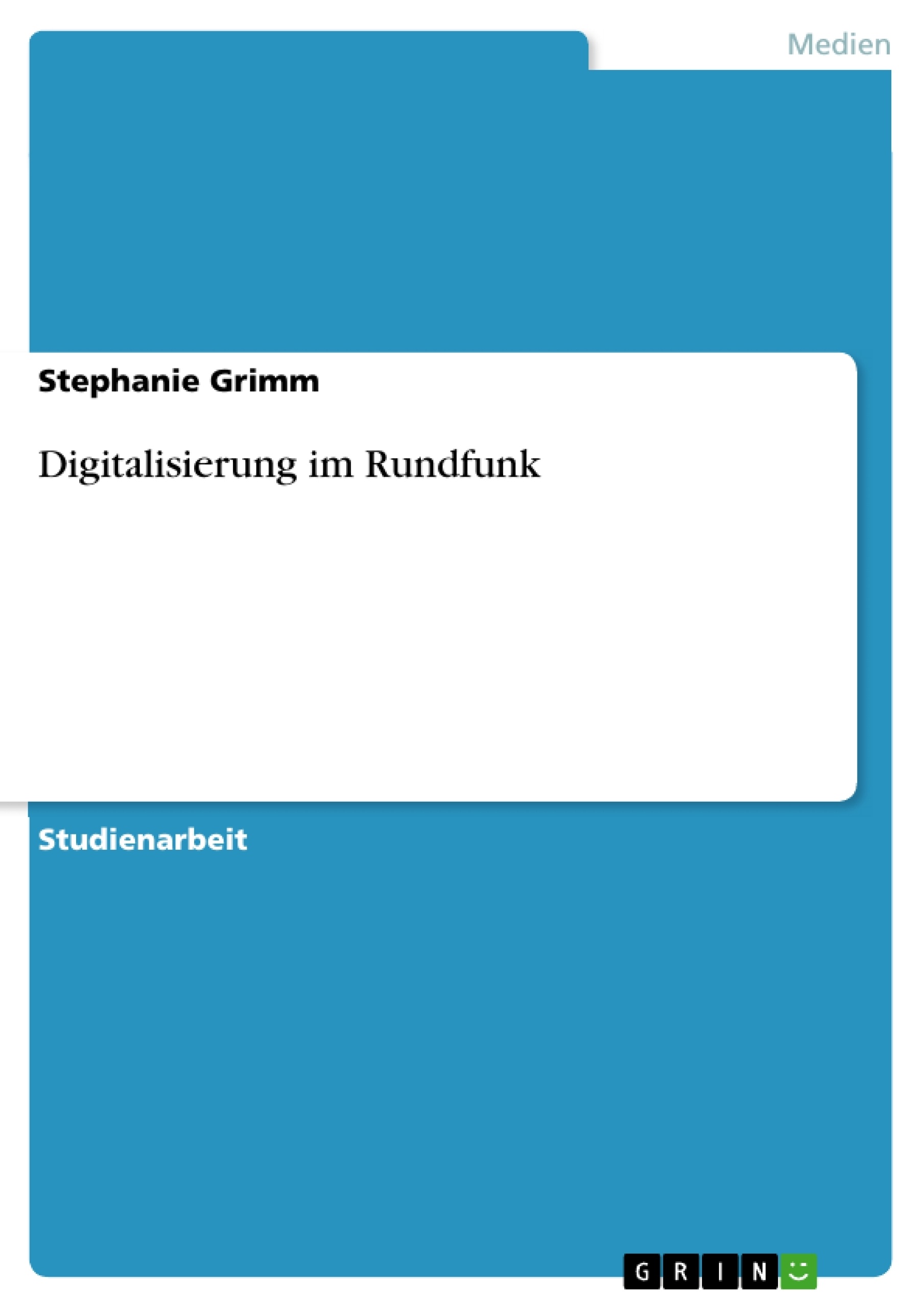1. Was ist Digitalisierung im Rundfunk?
Wenn man von Digitalisierung im Rundfunk spricht, dann lassen sich zwei verschiedene Ebenen der Digitalisierung unterscheiden- zum einen die Digitalisierung der Übertragungswege, zum anderen die Veränderung des Arbeitsplatzes des Rundfunkredakteurs, an dem die gesamte Radioproduktion nun digital durchgeführt werden kann. Um die letztgenannte Entwicklung soll es nun im nachfolgenden Referat gehen.
Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes ist eine relativ neue Entwicklung, die erst durch die Entwicklung eines Verfahrens der Datenkompression möglich gemacht wurde. Vor dieser technische Neuerung wären die meisten Festplatten in der Radioproduktion schnell an ihre Grenzen gestoßen. Im Sommer 1991 stellte die Firma General Instruments ein Programm namens "Digicipher" vor1, was eben jene Datenkompression leisten kann. Seither geht die Entwicklung in diesem Bereich rasant vor sich. In den vergangenen Jahren haben sich Rundfunkingenieure weltweit auf gemeinsame Standards für die Datenreduktion bei der digitalen Ton-und Videoübertragung geeinigt.
Inwieweit diese neue Technologien von den Sendeanstalten auch genutzt werden, hängt auch von dem Programmprofil des jeweiligen Senders ab. Verschiedene Sendekonzepte erfordern verschiedene technische Lösungen. So kommen Nachrichtensender auch heute schon kaum mehr ohne die moderne Technik aus, während bei Kulturprogrammen, die hauptsächlich klassische Musik spielen oder inhaltlich aufwendige Features produzieren, kaum ein Bedarf für Digitalisierung besteht.
Festzuhalten ist jedoch, daß sich künftig in weiten Teilen des Rundfunks die Radioproduktion im Computer abspielen wird und sich das Berufsbild des Rundfunkredakteurs dadurch weitreichend wandeln wird. Auch die Arbeitsstrukturen in den Rundfunksendern werden sich grundlegend verändern. Der Redakteur wird künftig (in einigen Sendern ist die Digitalisierung schon so weit fortgeschritten) auch Aufgaben übernehmen, für die bislang der Tontechniker zuständig gewesen ist.
2. Wie sieht der durch-digitalisierte Arbeitsplatz aus?
Am durch-digitalisierten Arbeitsplatz (im folgenden auch workstation genannt) können fast alle für einen Radioredakteur anfallenden Arbeiten direkt an der workstation durchgeführt werden. Doch darüber hinaus übernimmt der Redakteur auch Aufgaben wahr, die früher dem Tontechniker vorbehalten waren. So ist die workstation so ausgerüstet, daß die Tonbearbeitung gleich am Arbeitsplatz durchgeführt werden kann.
Der auf einer für alle Mitarbeiter zugänglichen Festplatte gespeicherte Audiotext kann vom bearbeitenden Redakteurs abgerufen und gleich im Computer geschnitten werden. Die dazu benötigten O-Töne sind schon über eine Audioschnittstelle in das System eingespeist worden und können so direkt auf den Bildschirm gebracht werden, was den Vorteil hat, das die graphisch dargestellten Schallwellen gleich mögliche Schnittstellen erkennen lassen. Der digitale Schnitt wird mit Hilfe von Maus und Tastatur durchgeführt. Die gewünschten Teile werden mit der Maus markiert und zusammengeschnitten. Die O-Töne bleiben auf der Festplatte erhalten und können so beliebig neu zusammengeschnitten werden. Das zeitraubende Kopieren von Tonbändern entfällt so.
Da der Redakteur am Arbeitsplatz einen Kopfhörer und ein Mikrophon hat, was präzise genug ist, um die Hintergrundgeräusche in der Redaktion auszublenden, kann er seinen Text gleich an seinem Schreibtisch einsprechen. Auch hat der Redakteure direkten Zugriff auf Archive (Musik und Presse), Nachrichtenagenturmeldungen und eingespielte Korrespondentenberichte. Der Zusammenschnitt dieser Elemente verläuft nach dem oben am Beispiel "O- Töne" dargestelltem Verfahren.
Nach Zusammenbau der verschiedenen Elemente geht der Beitrag per Datenleitung ins Studio, wo er dann per Mausklick abgefahren wird.
3.Welche Folgen hat diese Veränderung für den Journalisten?
Gegenüber früher unterscheidet sich der Arbeitsalltag insofern, daß der Redakteur fast den ganzen Produktionsprozess an seinem Arbeitsplatz erledigen kann. Auch wird er, wie schon oben angesprochen, in viel stärkerem Maße in die Technik eingebunden, als das bisher der Fall gewesen ist. Der Tontechniker wird so zunehmend überflüssig. Bislang arbeiten Redakteur und Tontechniker im Tonstudio zusammen; jetzt kann der Redakteur viele der Aufgaben, für die früher ein Tonstudio benötigt wurde, an seinem Arbeitsplatz erledigen. Zwar werden Tonstudios in absehbarer Zeit nicht völlig überflüssig werden, doch sind die Folgen für die Tontechnikern kaum zu unterschätzen, da ihre Stellen immer stärker Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer fallen.
4. Welche Folgen haben die technischen Veränderung für das journalistische Arbeit?
Welche Auswirkungen diese neuen technischen Anforderungen auf die journalistische Arbeit haben, hängt auch von der Radioform ab. Bei den privaten Sendern, die schon länger mit sogenannten "Selbstfahrerstudios"2 arbeiten, ist zu erwarten, daß der Redakteur durch die Vereinfachung der Technik sich wieder stärker auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Dagegen besteht angesichts der bei den öffentlich-rechtlichen Sendern praktizierten Arbeitsformen die Gefahr, daß durch den Umstand, daß Journalisten auch nicht-journalistsiche Aufgaben übernehmen müssen, mit denen sie bislang gar nicht konfrontiert waren, zumindest vorübergehend ein Qualitätsverlust einher geht3.
Diese Probleme sind natürlich nur vorübergehender, und nicht prinzipieller Natur. Die Sender, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, müssen durch weitreichende Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen dafür sorgen, daß diese durch Umstrukturierung der Arbeitsplätze auftretenden Probleme möglichst weitreichend abgefedert werden, und daß eine sozial verträgliche Lösung für die überflüssig werdenden Arbeitsfelder gefunden wird.
Doch auch wichtige Kommunikationsprozesse innerhalb des Senders fallen der neuen Technik zum Opfer. So wird beispielsweise der Redakteur künftig auf den Tontechniker als ersten Zuhörer und Kritiker seiner Arbeit verzichten müssen.
Eine Gefahr besteht auch darin, daß bei digital verwalteten Archiven viele bisher bestehende Querverweise verloren gehen und der interdisziplinäre Überblick verloren geht. So kann ich aus eigener Erfahrung aus meiner Tätigkeit am Nachrichtenticker einer Zeitung sagen, daß, wenn ich nicht jeden Ticker anlesen, sondern mich statt dessen streng an die Einteilung in Politik, Vermischtes, Kultur und Wirtschaft halten würde, einige für bestimmte Redaktionen interessante Informationen fehlgeleitet würden und somit verloren gingen.
Auch laßt sich heute schon am Beispiel Bibliotheken, in denen ausschließlich elektronische Datenbank verwendet werden, erkennen, daß Datenbänke das Blickfeld des Recherchierenden eher einengen, als erweitern.
"If I am doing a subject search in a card catalog, I will also typically find directions to additional listings [..]On-line computer searches typically offer no such cross-referencing"4
Zwar wird sich diese Problem mit der Zeit auch durch immer ausgefeiltere Zugriffsmöglichkeiten auf Datenbänke und neue Suchprogramme relativieren. Kurz- und mittelfristig kann es jedoch durch diese "Kinderkrankheiten" des Computerzeitalters zu einem Qualitätsverlust kommen.
So birgt die zwangsläufig erfolgende Rationalisierung zwar Chancen, weil viele der stupiden, sich immer wiederholenden Arbeitsprozesse weitgehend verschwinden. Das hat aber nicht zwangsläufig zur Folge, daß die dadurch frei werdenden Resourcen (sowohl an menschlicher Kreativität als auch im finanziellen Bereich) an anderer Stelle zur Qualitätsverbesserung eingesetzt werden. Für eine sinnvolle Weichenstellung in diesem Bereich ist auch die medienpolitische Entwicklung entscheidend.
Ein weiteres Problem, das zwar nicht unbedingt mit der Qualität der journalistischen Arbeit zu tun hat, sich für die Repuataion des Senders jedoch auch fatal auswirken kann, besteht darin, daß bei einem Computerfehler gleich die ganze Sendung unsendbar geworden ist, während sich bei den herkömmlichen Sendeformen der Ausfall eines Beitrages leicht kompensieren läßt.
5.Welche sozialen Folgen hat die Umstellung?
Bei den sozialen Folgen stehen natürlich die Veränderungen am Arbeitsmarkt durch die Rationalisierung im Vordergrund. Hier sind die Medienanstalten gefordert, regulierend einzugreifen und durch Fortbildungsmaßnahmen und Umschulungen allzugroße Einbrüchen bei denen im technischen Bererich arbeitenden Menschen zu verhindern.
Auch ist zu erwarten, daß die veränderten Arbeitsbedingungen die Kommunikatiosprozesse in den Sendern verändern werden. Der schon beschriebene Wegfall des Tontechnikers als erster Kritiker für die Arbeit des Redakteurs ist hierfür nur ein Bespiel. Zwar sehe ich nicht die Gefahr, daß der Redakteur an seinem Arbeitsplatz vereinsamt, doch wird sich der Schaffungsprozess, den ein Beitrag bis zur Sendung durchläuft, und die Inspirationen, die sein Autor dabei bekommt, mit der Umstrukturierung des Arbeitsplatzes sicher verändern. Hier müssen auch neue Kommunikationsstrukturen geschaffen werden.
6. Welche rundfunkpolitischen Folgen hat diese Entwicklung?
Die technische Entwicklung, die dadurch entstehenden Möglichkeiten und die Möglichkeit mit geringerem finanziellen Aufwand Radio zu machen, wird die Gebührendiskussion und die Diskussion um die Zukunft der ARD neu anheizen. Die Rundfunkanstalten werden vermutlich noch größere Schwierigkeiten haben, Rundfunkgebühren in in bisher üblichen Höhe zu rechtfertigen, weil die Technik, die notwendig ist, um Radio zu produzieren, längerfristig billiger werden wird. Es wird vermutlich schwieriger werden, die zur Qualitätssicherung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten notwendigen Gelder zu sichern.
7.Mögliche Zukunftsszenarios
In weiterer Zukunft - dann, wenn über DAB (Digirtal Audio Broadcasting) außer den herkömmlichen Rundfunkdiensten möglicherweise noch Zusatzinformationen und Zusatzdienste übermittelt werden- werden neue Berufe in diesem Bereich entstehen. So wird es z.B einen Datenredakteur geben, dessen Aufgabe ganz klassisch die Selektion und Bearbeitung von Nachrichten sein wird. Der Unterschied liegt darin, daß diese Ausarbeitung für das Display, was sich bei dem Empfänger zuhause oder im Auto befindet, und auf dem dann z.B.Landkarten mit Verkehrshinweisen erscheinen werden, bestimmt ist. Der Datenredakteur wird wie der Moderator ein Live- Mitarbeiter sein, der Einzelheiten aus dem, was der Moderator sagt, heraushebt und verstärkt. Ein weiterer neuer Beruf könnte der des Datenproducer sein, dessen Aufgabe es sein wird, die vom Datenredakteur selektierten Informationen graphisch darzustellen.5
Literaturhinweise:
-Jürgen Bischoff "Computer Aided Radio - die Digitalisierung ist voll im Gange" in: Medium, Januar/ Februar 1995
-Interview mit Tom Otto in: Media Spektrum, Mai 1995
-Paul Gruchow "Ransacking our libraries" in: Utne Reader, Mai/ Juni 1995
[...]
1 vgl Seite 26 "Computer Aided Radio" in Medium Januar/ Februar 1995
2 "Selbstfahrerstudios" sind Studios, in denen der Redakteur schon in der Vergangenheit verschieden Aufgaben wahrnahm (Moderation, Schnitt etc). "Selbstfahrerstudios" wurden bislang vor allem bei den privaten Sendern eingesetzt.
3 vgl.Seite 28 erster und zweiter Paragraph
4 Paul Gruchow "Ransacking our libraries" in Utne Reader, Mai/Juni 1995, S 31
Häufig gestellte Fragen
1. Was bedeutet Digitalisierung im Rundfunk gemäß diesem Text?
Der Text unterscheidet zwei Ebenen der Digitalisierung im Rundfunk: die Digitalisierung der Übertragungswege und die Veränderung des Arbeitsplatzes des Rundfunkredakteurs, wo die Radioproduktion digital durchgeführt wird. Der Text konzentriert sich auf die letztgenannte Entwicklung.
2. Welche technischen Entwicklungen haben die Digitalisierung des Rundfunkarbeitsplatzes ermöglicht?
Die Entwicklung eines Verfahrens zur Datenkompression war entscheidend, da es die Speicherung und Bearbeitung großer Audiomengen ermöglichte. Die Firma General Instruments stellte 1991 ein Programm namens "Digicipher" vor, das Datenkompression leistete.
3. Inwieweit nutzen Sendeanstalten diese neuen Technologien?
Die Nutzung hängt vom Programmprofil des Senders ab. Nachrichtensender nutzen die Technik stärker als Kulturprogramme, die klassische Musik spielen oder aufwendige Features produzieren.
4. Wie sieht ein durch-digitalisierter Arbeitsplatz (Workstation) aus?
An der Workstation kann der Redakteur fast alle Arbeiten erledigen, einschließlich Tonbearbeitung. Er kann Audiotexte abrufen, im Computer schneiden, O-Töne einspielen, Texte einsprechen und auf Archive zugreifen. Der Beitrag geht dann per Datenleitung ins Studio.
5. Welche Folgen hat die Digitalisierung für den Journalisten?
Der Redakteur erledigt den ganzen Produktionsprozess an seinem Arbeitsplatz und wird stärker in die Technik eingebunden. Der Tontechniker wird zunehmend überflüssig.
6. Welche Folgen hat die Digitalisierung für die journalistische Arbeit?
Bei Privatsendern könnte die Vereinfachung der Technik dem Redakteur ermöglichen, sich stärker auf seine eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Bei öffentlich-rechtlichen Sendern besteht die Gefahr eines Qualitätsverlusts, wenn Journalisten nicht-journalistische Aufgaben übernehmen müssen. Wichtige Kommunikationsprozesse innerhalb des Senders können der neuen Technik zum Opfer fallen.
7. Welche Probleme können bei digital verwalteten Archiven auftreten?
Es besteht die Gefahr, dass Querverweise verloren gehen und der interdisziplinäre Überblick verloren geht. Datenbänke können das Blickfeld des Recherchierenden eher einengen als erweitern.
8. Welche sozialen Folgen hat die Umstellung?
Veränderungen am Arbeitsmarkt durch Rationalisierung stehen im Vordergrund. Medienanstalten sind gefordert, regulierend einzugreifen und durch Fortbildungsmaßnahmen und Umschulungen allzugroße Einbrüchen bei denen im technischen Bererich arbeitenden Menschen zu verhindern.
9. Welche rundfunkpolitischen Folgen hat diese Entwicklung?
Die Gebührendiskussion und die Diskussion um die Zukunft der ARD werden neu angeheizt. Es wird vermutlich schwieriger werden, die zur Qualitätssicherung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten notwendigen Gelder zu sichern.
10. Welche möglichen Zukunftsszenarios werden im Text erwähnt?
Mit DAB (Digital Audio Broadcasting) könnten neue Berufe wie Datenredakteur und Datenproducer entstehen, die Zusatzinformationen und Zusatzdienste für Displays zuhause oder im Auto bearbeiten und graphisch darstellen.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Grimm (Autor:in), 2001, Digitalisierung im Rundfunk, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103921