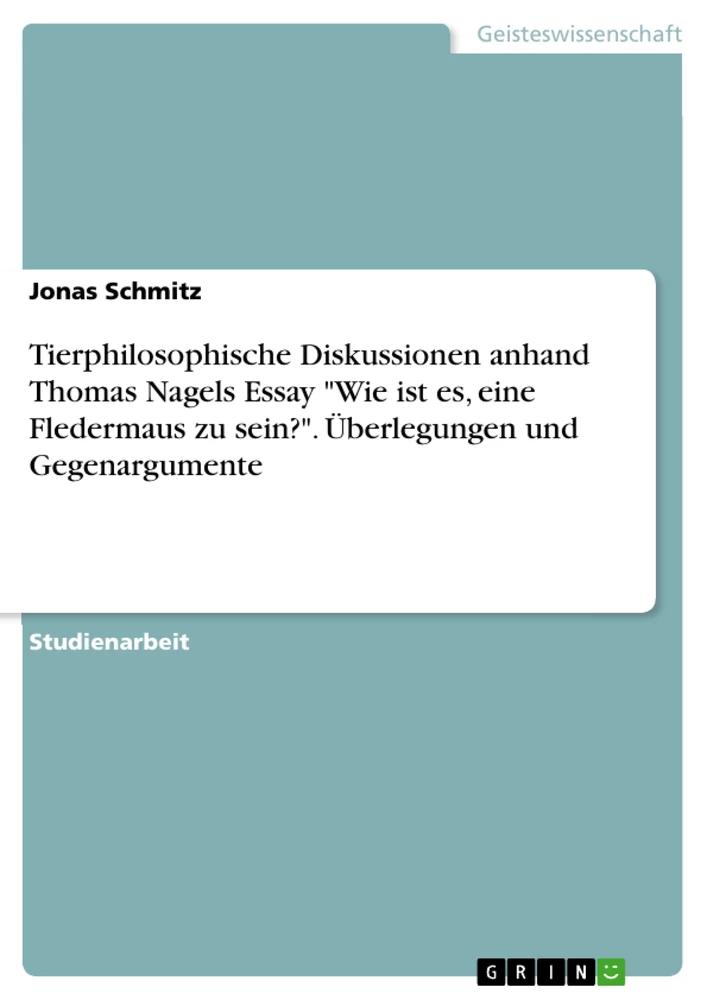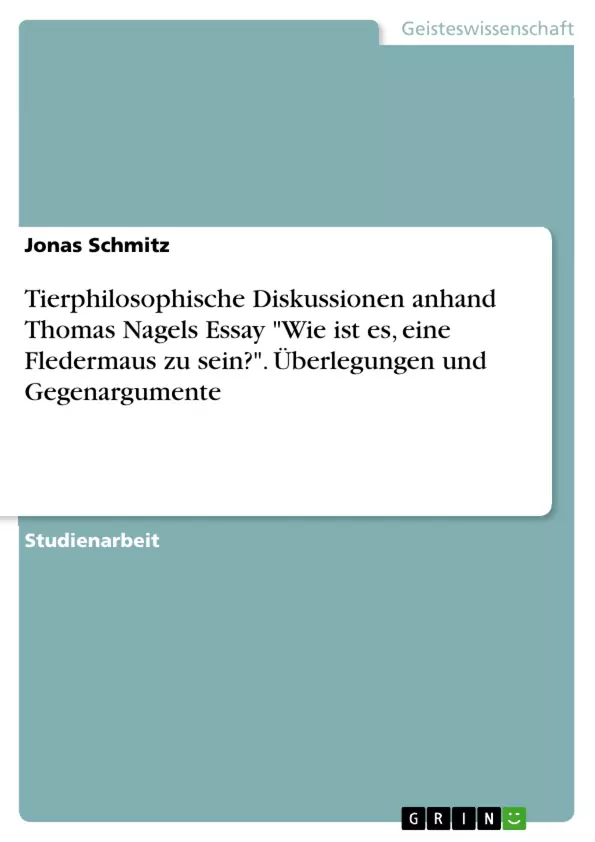Die Hausarbeit beschäftigt sich mit Thomas Nagels Essay "Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?". In diesem setzt er sich mit der Thematik des Fremdpsychischen und der Subjektivität fremder Individuen auseinander. Er unterbreitet die These, dass es – aufgrund von irreduziblen Bedingungen – unmöglich für Menschen sei, nachzuvollziehen, wie es für einen anderen Organismus ist, dieser zu sein. Es stellt sich die Frage, ob wir uns überhaupt in die subjektive Position eines Tieres hineinversetzen, beziehungsweise ob wir sie nachvollziehen können?
Die Hausarbeit befasst sich in einer Nachzeichnung der Argumente mit dem Essay und geht auf einen Einwand Daniel Dennetts ein, der die Grundargumentation Nagels angreifen möchte. Wie berechtigt ist dieser Einwand und wie ließe sich eine Klärung erreichen? Dazu werden ein paar kurze Schlaglichter auf generelle Problematiken der Tierphilosophie geworfen.
Ihre Relevanz in Bezug auf die Philosophie des Geistes und der Sprachphilosophie darf dabei nicht vergessen werden, denn die Auseinandersetzung mit den Fragen nach dem Bewusstsein von Tieren, ihrer Sprachbegabung und die Frage nach ihrem Geist sind über ihre eigenen Geltungsbereiche hinaus ertragreich, da sie gleichzeitig auch die Bedingungen und Problematiken ihres allgemeinen – und somit auch dem Menschen zukommenden – möglichen Vorhandenseins beinhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie ist es eine Fledermaus zu sein im Kontext der Tierphilosophie und Dennetts Einwänden
- Wie ist es eine Fledermaus zu sein – Grundzüge der Argumentation
- Was ist Tierphilosophie?
- Wie ist es eine Fledermaus zu sein und die Einwände Dennetts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Thomas Nagels Essay „Wie ist es eine Fledermaus zu sein?“ und untersucht dessen Argumente hinsichtlich der Frage, ob es für den Menschen möglich ist, sich in die subjektive Position eines Tieres hineinzuversetzen. Im Fokus stehen die Herausforderungen, die der Leib-Seele-Dualismus für das Verständnis von Bewusstsein und subjektiver Erfahrung darstellt, und wie diese durch Nagels Argumentation aufgezeigt werden.
- Der Leib-Seele-Dualismus und das Problem der Bewusstseinsphänomene
- Die Unmöglichkeit der Reduktion von Bewusstsein auf physikalische Prozesse
- Der subjektive Charakter der Erfahrung und die Bedeutung von Qualia
- Die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft bei der Simulation tierlicher Wahrnehmung
- Die Relevanz von Tierphilosophie für die Philosophie des Geistes und die Sprachphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik des Essays von Thomas Nagel, „Wie ist es eine Fledermaus zu sein?“, vor. Der Essay beschäftigt sich mit dem Fremdpsychischen und der Subjektivität fremder Individuen, insbesondere mit der Frage, ob Menschen die subjektive Perspektive von Tieren nachvollziehen können.
Wie ist es eine Fledermaus zu sein im Kontext der Tierphilosophie und Dennetts Einwänden
Wie ist es eine Fledermaus zu sein – Grundzüge der Argumentation
Dieser Abschnitt behandelt Nagels Argumentation, dass es aufgrund irreduzibler Bedingungen für den Menschen unmöglich sei, die subjektive Erfahrung eines anderen Organismus nachzuvollziehen. Dabei greift Nagel den Leib-Seele-Dualismus auf und kritisiert reduktionistische Ansätze, die Bewusstsein auf physikalische Prozesse reduzieren wollen.
Was ist Tierphilosophie?
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Wesen und der Bedeutung der Tierphilosophie. Es wird die Relevanz dieser Disziplin für die Philosophie des Geistes und die Sprachphilosophie herausgestellt, da sie Fragen nach Bewusstsein, Sprache und Geist von Tieren aufwirft, die auch das Verständnis von Mensch und Geist im Allgemeinen betreffen.
Wie ist es eine Fledermaus zu sein und die Einwände Dennetts
Dieser Abschnitt geht auf einen Einwand von Daniel Dennett ein, der die Grundargumentation Nagels in Frage stellt. Die Diskussion mit Dennetts Einwand soll dazu dienen, die Gültigkeit von Nagels Argumenten zu überprüfen und eine Klärung der Frage zu ermöglichen, ob sich Menschen wirklich in die subjektive Position eines Tieres hineinversetzen können.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder der Hausarbeit sind: Leib-Seele-Dualismus, Bewusstsein, subjektive Erfahrung, Qualia, Tierphilosophie, Philosophie des Geistes, Sprachphilosophie, Reduktionismus, Nagel, Dennett, Fledermaus, Echolotortung.
- Quote paper
- Jonas Schmitz (Author), 2020, Tierphilosophische Diskussionen anhand Thomas Nagels Essay "Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?". Überlegungen und Gegenargumente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1039266