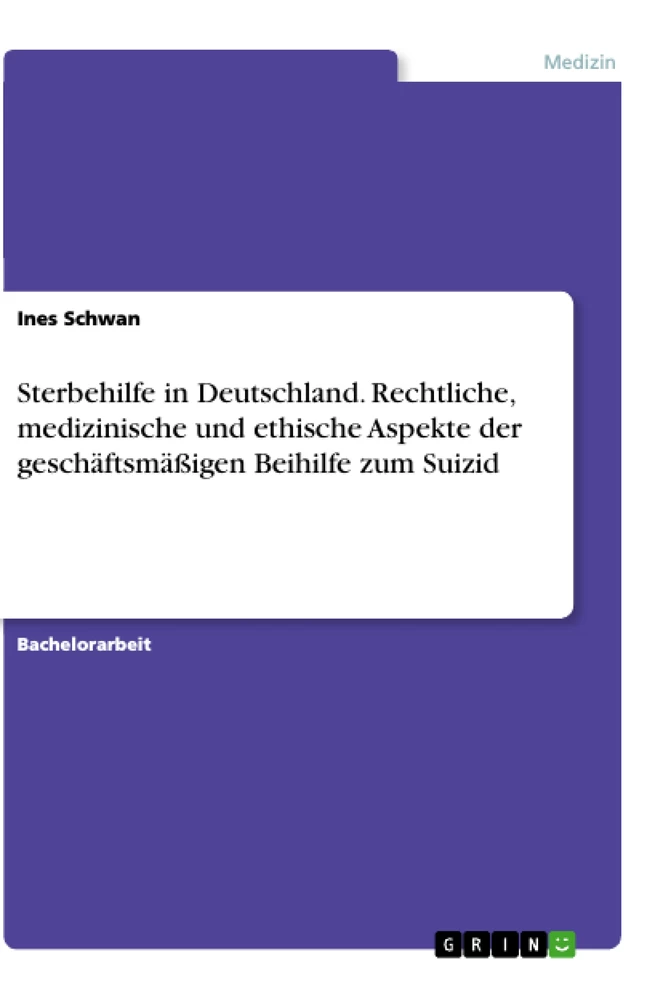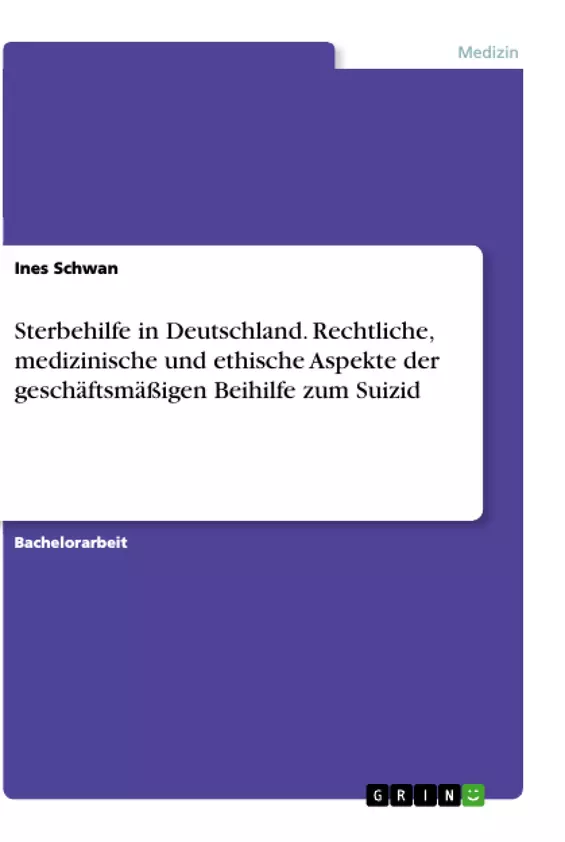Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, ob und wie die Beihilfe zum Suizid mit den rechtlichen, medizinischen und ethischen Grundsätzen vereinbart werden kann. Auch die Frage, ob die Suizidbeihilfe in Deutschland überhaupt notwendig ist und zu einer Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung im Sterben führt, wird anhand unterschiedlicher Aspekte analysiert. Basis der Überlegungen sind eine umfassende Literaturarbeit und fünf geführte Experteninterviews, durch welche es möglich war, Kriterien und Voraussetzungen zur medizinischen und ethischen Vereinbarkeit zu definieren. Auch der Gefahr der Fremdbestimmung kann durch Vorgabe gewisser Anspruchsvoraussetzungen, die in der Ausarbeitung hinreichend dargelegt werden, und einer strengen Kontrolle begegnet werden. Natürlich ist es nicht möglich alle Bedenken und Missbrauchsgefahren in ihrer Gänze zu beseitigen, trotzdem hat sich gezeigt, dass es medizinische Situationen gibt, in denen die Beihilfe zum Suizid eine sinnvolle und humane Alternative für schwerkranke Menschen darstellen kann.
Das Bedürfnis selbstbestimmt über das eigene Leben und den eigenen Tod entscheiden zu können, ist ein zunehmendes Verlangen unserer heutigen Gesellschaft. Das Thema Sterbehilfe spielt hierbei eine zentrale Rolle und wird bereits seit mehreren Jahren in Deutschland thematisiert. Sterbehilfedebatten berufen sich immer wieder auf die Prinzipien der Menschenwürde und Autonomie, welche sogar im Grundgesetz fest verankert sind. Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht den § 217 StGB, der die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt hat, für nichtig erklärt. Seither beschäftigt sich Deutschland mit der Suizidbeihilfe und versucht einen sinnvollen gesetzlichen Rahmen für die Inanspruchnahme zu definieren. Eine endgültige Gesetzeslage liegt derzeit noch nicht vor. Aus medizinischer und ethischer Sicht ist das Thema Beihilfe zum Suizid ein sehr umstrittenes Thema. Im Hinblick auf die Selbstbestimmung stellt sich die Frage, ob die Beihilfe zum Suizid wirklich zu einem selbstbestimmten Tod führt oder mit der Unfreiheit zum Leben einhergeht.
Inhaltsverzeichnis
- Abstrakt
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau
- 2 Überblick zum Thema Sterbehilfe
- 2.1 Was ist Sterbehilfe?
- 2.2 Arten der Sterbehilfe
- 2.3 Euthanasie
- 3 Nichtigkeitserklärung des § 217 StGB
- 3.1 Gesetzeslage vor der Nichtigkeitserklärung
- 3.2 Gesetzeslage nach der Nichtigkeitserklärung
- 4 Freiheit zum Tod oder Unfreiheit zum Leben?
- 4.1 Selbstbestimmung am Lebensende
- 4.2 Patientenverfügung
- 4.3 Grundsätze ärztlichen Handelns
- 4.4 Prinzipien der Medizinethik
- 4.5 Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Sterbehilfe
- 5 Vergleich mit den Nachbarländern
- 5.1 Sterbehilfe in den Niederlanden
- 5.2 Sterbehilfe in der Schweiz
- 5.3 Vergleich zu Deutschland
- 6 Versorgung schwerstkranker Menschen
- 6.1 Palliativversorgung
- 6.1.1 Begriffserklärung
- 6.1.2 Palliative Versorgungssettings
- 6.2 Hospiz
- 6.2.1 Begriffserklärung
- 6.2.2 Formen der Hospizarbeit
- 6.3 Finalversorgung von Tumorkranken
- 7 Methodik
- 7.1 Qualitatives Forschungsdesign
- 7.1.1 Allgemeines
- 7.1.2 Gütekriterien qualitativer Forschung
- 7.1.3 Erhebungsmethode- Experteninterview
- 7.1.4 Interviewpartner
- 7.1.5 Durchführung und Aufbereitung der Interviews
- 7.2 Methodisches Vorgehen- Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz
- 8. Ergebnisse
- 8.1 Ergebnisdarstellung
- 8.2 Ergebnisinterpretation
- 9. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
- Anhang A
- Anhang B
- Anhang C
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Sterbehilfe in Deutschland und analysiert die rechtlichen, medizinischen und ethischen Aspekte der Legalisierung der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid.
- Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit der Suizidbeihilfe mit den rechtlichen und ethischen Grundsätzen.
- Sie beleuchtet die Frage der Selbstbestimmung im Sterben und die Gefahr der Fremdbestimmung durch die Inanspruchnahme der Suizidbeihilfe.
- Die Arbeit analysiert die aktuelle Gesetzeslage und die Entwicklung der Sterbehilfedebatte in Deutschland.
- Sie betrachtet verschiedene Modelle der Sterbehilfe in anderen Ländern und vergleicht sie mit der Situation in Deutschland.
- Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Palliativversorgung und der Hospizarbeit für die Begleitung schwerstkranker Menschen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sterbehilfe in Deutschland ein und beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 bietet einen Überblick über verschiedene Arten der Sterbehilfe, darunter die aktive Sterbehilfe, die passive Sterbehilfe und die Euthanasie. Kapitel 3 analysiert die Gesetzeslage in Deutschland vor und nach der Nichtigkeitserklärung des § 217 StGB, der die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt hat. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Frage der Selbstbestimmung am Lebensende und der ethischen und medizinischen Aspekte der Sterbehilfe. Kapitel 5 vergleicht die Sterbehilfegesetzgebung in Deutschland mit den Nachbarländern Niederlande und Schweiz. Kapitel 6 beleuchtet die Bedeutung der Palliativversorgung und der Hospizarbeit für die Begleitung schwerstkranker Menschen. Kapitel 7 beschreibt die Methodik der Arbeit, welche auf einer umfassenden Literaturarbeit und fünf geführten Experteninterviews basiert. Die Ergebnisse der Arbeit werden in Kapitel 8 präsentiert und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Selbstbestimmung, Medizin, Ethik, Fremdbestimmung, medizinische Kriterien und Anspruchsvoraussetzungen in Bezug auf die Legalisierung der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid in Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Ines Schwan (Autor:in), 2021, Sterbehilfe in Deutschland. Rechtliche, medizinische und ethische Aspekte der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1039633