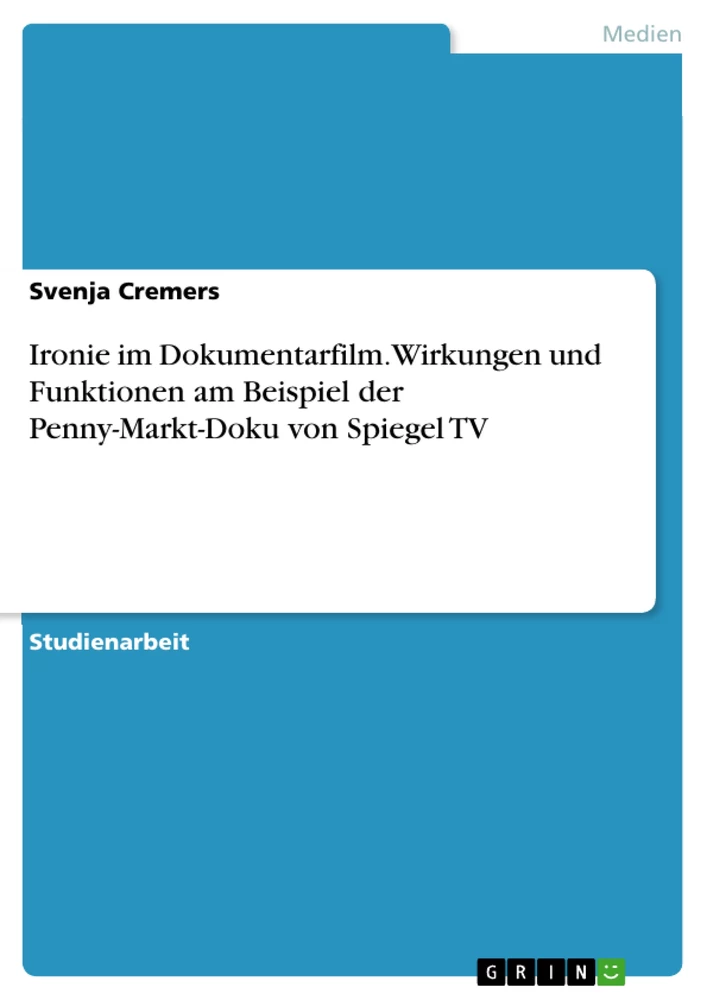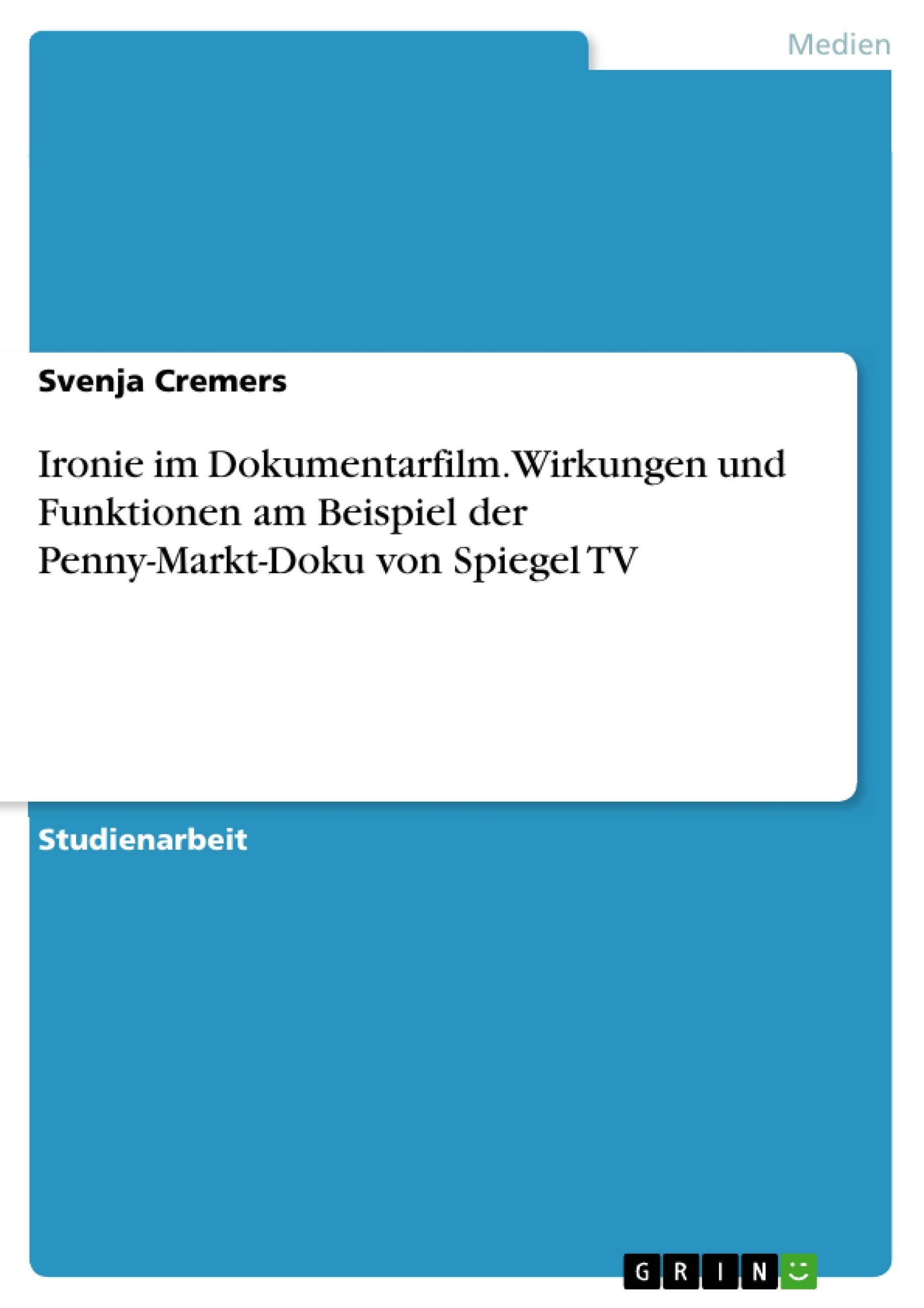Kann sich ein rhetorisches Mittel wie Ironie im sachlich-faktischen Dokumentarfilm verwenden lassen? Zunächst würde man diese Frage intuitiv mit ‚Nein‘ beantworten, da der humoristische Charakter der Ironie und der objektive Charakter des nonfiktionalen Films nicht konvergieren. Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema, welche Wirkung und Funktion Ironie im Dokumentarfilm hat und ob sie konvergieren können. Im Folgenden wird die Ausgangsthese tiefgründiger hinterfragt und die Verwendung von Ironie im nichtfiktionalen Film wird analysiert und auf das Beispiel der Penny-Markt-Doku von Spiegel TV aus dem Jahr 2007 bezogen, wo sich deutlich Funktion, Wirkung und Intention der Ironie analysieren und darstellen lassen.
Dabei stehen die Leitfragen „Welche Intention hat die Ironie im Dokumentarfilm?“, „Passen Ironie und Dokumentarfilm zusammen?“ und „Lässt sich die Intention der Ironie anhand des Penny-Markt-Doku Beispiels verdeutlichen?“ im Fokus der Betrachtung und werden im Laufe der Arbeit versucht zu beantworten.
Zunächst wird die Arbeit in Kapitel 1 eingeleitet mit einer Definition des Dokumentarfilms und der Reportage, um den eigentlichen Sinn und die Charakteristiken zu erfassen. Anschließend widmet sich Kapitel 2 der Ironie, der Fokus liegt hierbei auf der allgemeinen Definition und der Rezeption. Darauf aufbauend wird in Kapitel 3 die Konvergenz von Ironie und Dokumentarfilm/Reportage analytisch dargestellt und die Wirkung beziehungsweise die Vor- und Nachzüge der Ironie wird durch zwei verschiedene Positionen erörtert. Das Analysierte wird abschließend in Kapitel 4 anhand des Beispiels der Penny-Markt-Doku verdeutlicht. Dafür werden konkrete Szenen aus der vierteiligen Reportage dargelegt und der Gebrauch von Ironie wird analysiert und erläutert. Hier wird sich auf die Ironie im Voice-Over-Kommentar und im Schnitt konzentriert. Zum Ende des 4. Kapitels wird kurz auf den Erfolgscharakter der Penny-Markt-Doku, somit die Wirkung der Anwendung von Ironie bei den Rezipienten der Reportage, eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ironie und Dokumentarfilm im Bezug auf das Beispiel
- 1. Definitionen
- 1.1 Dokumentarfilm
- 1.2 Fernsehreportage
- III. Fazit
- IV. Literaturverzeichnis
- V. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirkung und Funktion von Ironie im Dokumentarfilm und analysiert, ob und wie diese beiden Elemente konvergieren. Die Analyse konzentriert sich auf die Spiegel TV Penny-Markt-Doku (2007) als Fallbeispiel. Die Arbeit zielt darauf ab, die Intention der Ironie im Dokumentarfilm zu beleuchten, die Frage nach der Kompatibilität von Ironie und Dokumentarfilm zu beantworten und die Intention der Ironie anhand des Beispiels der Penny-Markt-Doku zu verdeutlichen.
- Definition und Rezeption von Ironie
- Charakteristiken des Dokumentarfilms und der Fernsehreportage
- Konvergenz von Ironie und Dokumentarfilm/Reportage
- Analyse der Ironie in der Penny-Markt-Doku (Spiegel TV)
- Wirkung der Ironie auf die Rezipienten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Wirkung und Funktion von Ironie im Dokumentarfilm und deren möglicher Konvergenz. Sie führt die Penny-Markt-Doku von Spiegel TV als Fallbeispiel ein und formuliert die Leitfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, wobei die einzelnen Kapitel und ihre jeweiligen Schwerpunkte vorgestellt werden.
II. Ironie und Dokumentarfilm im Bezug auf das Beispiel: Dieses Kapitel analysiert zunächst die Charakteristika des Dokumentarfilms und der Reportage, um den Kontext für die Untersuchung der Ironie zu schaffen. Es werden unterschiedliche Positionen innerhalb der Dokumentarfilmtheorie (Direct Cinema vs. Cinéma Vérité) dargestellt und die Grenzen zwischen Dokumentarfilm und Reportage herausgearbeitet. Die Definition und Rezeption von Ironie wird ebenfalls beleuchtet, um die Grundlage für die spätere Analyse der Konvergenz von Ironie und Dokumentarfilm zu legen. Die Zusammenfassung der Unterkapitel 1.1 und 1.2 betont die jeweilige Definition und Abgrenzung der Begriffe Dokumentarfilm und Reportage, wobei die unterschiedlichen Grade an Objektivität und Subjektivität in beiden Formaten hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Ironie, Dokumentarfilm, Fernsehreportage, Spiegel TV, Penny-Markt-Doku, Wirkung, Funktion, Konvergenz, Rezeption, Authentizität, Subjektivität, Objektivität.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Ironie und Dokumentarfilm - Analyse der Spiegel TV Penny-Markt-Doku
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Wirkung und Funktion von Ironie im Dokumentarfilm, insbesondere in Bezug auf die Spiegel TV Penny-Markt-Doku (2007). Es wird analysiert, ob und wie Ironie und Dokumentarfilm zusammenwirken und welche Intentionen dahinterstecken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition und Rezeption von Ironie, den Charakteristika des Dokumentarfilms und der Fernsehreportage, der Konvergenz von Ironie und Dokumentarfilm/Reportage, einer Analyse der Ironie in der Penny-Markt-Doku und der Wirkung der Ironie auf die Rezipienten. Es werden unterschiedliche Positionen innerhalb der Dokumentarfilmtheorie (Direct Cinema vs. Cinéma Vérité) berücksichtigt.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analyse der Spiegel TV Penny-Markt-Doku als Fallbeispiel. Sie untersucht die in der Dokumentation verwendeten ironischen Elemente und deren Wirkung auf den Zuschauer. Die Analyse stützt sich auf theoretische Grundlagen der Dokumentarfilmtheorie und der Ironieforschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel, das sich mit Ironie und Dokumentarfilm im Kontext des Beispiels befasst (inklusive Unterkapiteln zu Definitionen von Dokumentarfilm und Fernsehreportage), ein Fazit, ein Literaturverzeichnis und ein Quellenverzeichnis.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ironie, Dokumentarfilm, Fernsehreportage, Spiegel TV, Penny-Markt-Doku, Wirkung, Funktion, Konvergenz, Rezeption, Authentizität, Subjektivität, Objektivität.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Intention der Ironie im Dokumentarfilm zu beleuchten, die Frage nach der Kompatibilität von Ironie und Dokumentarfilm zu beantworten und die Intention der Ironie anhand des Beispiels der Penny-Markt-Doku zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt die Spiegel TV Penny-Markt-Doku?
Die Spiegel TV Penny-Markt-Doku dient als Fallbeispiel, um die theoretischen Überlegungen zur Ironie im Dokumentarfilm konkret zu untersuchen und zu illustrieren.
Wie werden Dokumentarfilm und Fernsehreportage unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Dokumentarfilm und Fernsehreportage, indem sie die jeweiligen Definitionen und Abgrenzungen betrachtet und die unterschiedlichen Grade an Objektivität und Subjektivität in beiden Formaten hervorhebt.
- Citar trabajo
- Svenja Cremers (Autor), 2021, Ironie im Dokumentarfilm. Wirkungen und Funktionen am Beispiel der Penny-Markt-Doku von Spiegel TV, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1039636