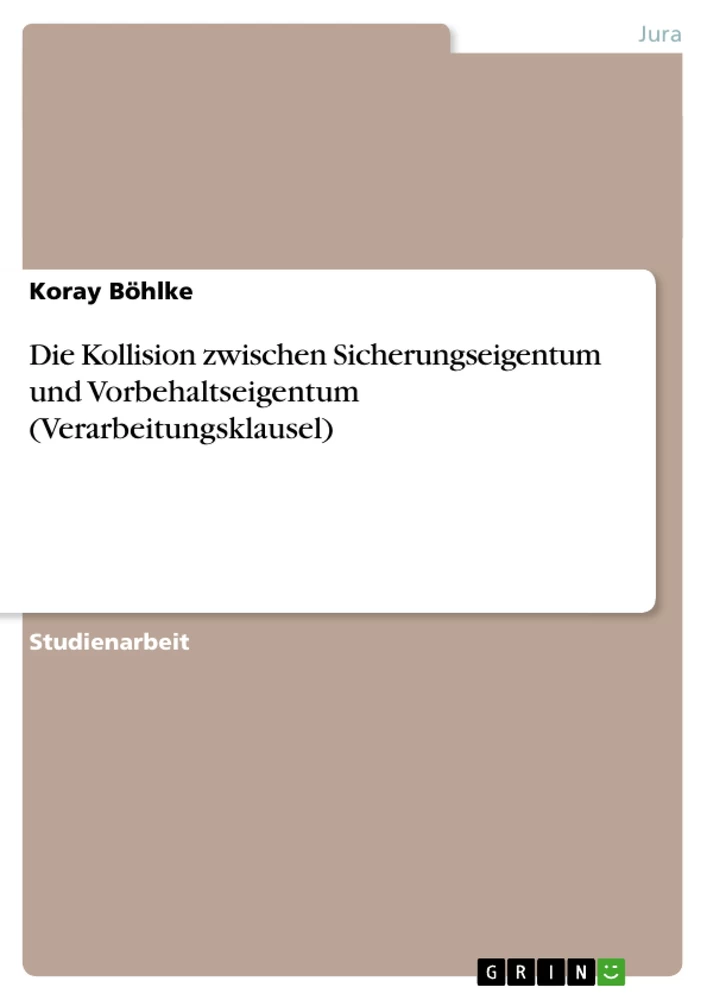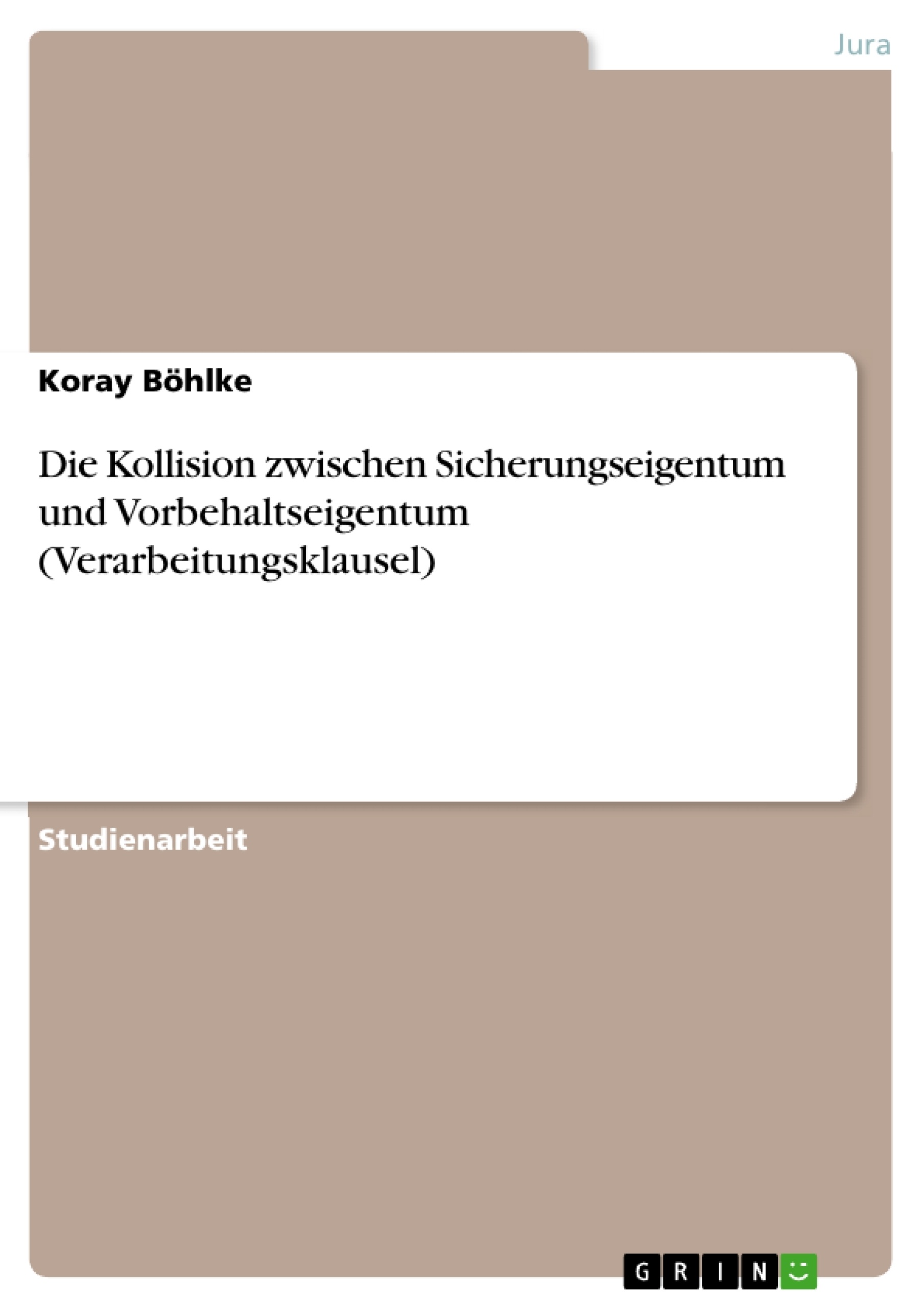Stellen Sie sich vor, ein komplexes Netz aus Eigentumsvorbehalten, Sicherungsübereignungen und verarbeiteten Rohstoffen spinnt sich um ein Unternehmen, das zwischen Waren- und Geldkreditgebern jongliert. In diesem hochspannenden juristischen Thriller, der die Feinheiten des deutschen Sachenrechts seziert, entfaltet sich ein packender Kampf um Sicherheiten und Prioritäten. Die zentrale Frage: Wie lassen sich die Ansprüche von Lieferanten, die Rohstoffe unter Eigentumsvorbehalt liefern, und Banken, die Kredite durch Sicherungsübereignung absichern, in Einklang bringen, wenn das Unternehmen in finanzielle Schieflage gerät? Das Buch nimmt den Leser mit auf eine detailreiche Reise durch die Untiefen des § 950 BGB, der die Eigentumsverhältnisse bei Verarbeitung von Stoffen regelt. Ist diese Vorschrift dispositives oder zwingendes Recht? Kann eine Verarbeitungsklausel, die den Eigentumserwerb des Verarbeiters ausschließt, überhaupt wirksam vereinbart werden? Und welche Rolle spielt die viel diskutierte "Herstellereigenschaft" bei der Bestimmung des Eigentümers der neuen Sache? Anhand praxisnaher Fallkonstellationen werden die unterschiedlichen Lösungsansätze der Rechtsprechung und Literatur kritisch beleuchtet. Von der dinglichen Einigung über den Besitzmittlungswillen bis hin zur antizipierten Sicherungsübereignung – jedes Detail wird unter die Lupe genommen. Der Autor scheut sich nicht, die Schwächen bestehender Theorien aufzudecken und einen eigenen, innovativen Lösungsansatz zu präsentieren: das Näheprinzip. Dieses Prinzip, das ursprünglich im Kontext der Globalzession entwickelt wurde, wird hier auf den sachenrechtlichen Bereich übertragen und modifiziert, um eine interessengerechte Abwägung zwischen Waren- und Geldkreditgebern zu ermöglichen. Ein unverzichtbarer Leitfaden für Juristen, Kreditinstitute und Unternehmen, die sich mit den komplexen Fragen der Kreditsicherung und des Eigentumserwerbs durch Verarbeitung auseinandersetzen müssen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des deutschen Sachenrechts und entdecken Sie, wie sich die verworrenen Fäden von Eigentum und Besitz entwirren lassen. Es werden die Themen Warenkreditgeber, verlängerter Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung, Verarbeitungsklausel, § 950 BGB, Herstellereigenschaft, Kollisionsfälle, antizipierte Sicherungsübereignung, Besitzmittlungswillen und Prioritätsgrundsatz behandelt.
Gliederung
A. Problemstellung
I. Warenkreditgeber
1. Lieferung von Rohstoffen unter Eigentumsvorbehalt
2. Verlust des Eigentums gem. § 950 I BGB
3. Vereinbarung einer Verarbeitungsklausel
II. Geldkreditgeber
1. Absicherung durch Sicherungsübereignung
2. Zustandekommen der Sicherungsübereignung
3. Nutzung durch den Kreditnehmer
III. Kollisionsfall
B. Zulässigkeit einer Verarbeitungsklausel
I. § 950 als dispositives Recht
1. § 950 als Konfliktlösung
2. Analogie zu den Regelungen des Werk- und Werklieferungsvertrages
3. Rechtsfolge - Direkter Eigentumserwerb
4. Anwartschaftsrecht
II. Vereinbarung der Herstellereigenschaft
1. Objektive Sichtweise der Herstellereigenschaft
2. Ermittlung des Herstellers durch Auslegung /p>
3. Rechtsfolge - Direkterwerb
4. Kein Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers
5. Antizipierte Übereignung
6. Mehrere Vorbehaltslieferanten
7. Übersicherung
8. Vereinbarung einer eingeschränkten Verarbeitungsklausel
III. § 950 als zwingendes Recht
1. Originärer Eigentumserwerb
2. Herstellereigenschaft
a. Auslegung nach tatsächlichen Verhältnissen
b. Anhaltspunkte für die Ermittlung der Herstellereigenschaft
3. Eigentumserwerb des Produzenten
4. Antizipiertes Besitzkonstitut
5. Allgemeine Voraussetzungen der Sicherungsübereignung
6. Rechtsfolge - Durchgangserwerb
C. Sicherungsübereignung
I. Bestimmbarkeit
II. Antizipierte Sicherungsübereignung
1. Bestehen eines Besitzmittlungsverhältnisses
2. Warenlager mit wechselndem Bestand
3. Ausführungshandlung aa. Raumsicherungsvertrag bb. Markierungsvertrag
III. Sicherungseigentum in der Insolvenz
1. Sicherungseigentum des Kreditinstituts
2. Sicherungseigentum des Vorbehaltslieferanten 14
D. Kollisionsfälle
I. Kollision bei Abdingbarkeit des § 950
1. Sicherungsübereignung an ein Kreditinstitut 15
2. Übertagung des Anwartschaftsrecht
3. Wertsteigerung durch Verarbeitung
4. Verarbeitung von Sachen verschiedener Eigentümer 17
a. Verarbeitung von Waren des Vorbehaltsverkäufers und -käufers 17
b. Verarbeitung von Vorbehaltseigentum und Sicherungseigentum 17 aa. Sicherungsübereignung ohne Verarbeitungsklausel 17 bb.
bb.Sicherungsübereignung mit Verarbeitungsklausel 18
II. Kollision bei Vereinbarung der Herstellereigenschaft 18
1. Sicherungsübereignung bei uneingeschränkter Verarbeitungsklausel 18
a. Übertragung der Anwartschaft
b. Stillschweigende Vereinbarung
c. Durchgangserwerb der Anwartschaft
d. Verarbeitung von Sicherungseigentum
2. Sicherungsübereignung bei eingeschränkter Verarbeitungsklausel 20
a. Verarbeitung von Vorbehaltsware
b. Verarbeitung von Sicherungseigentum und Vorbehaltsware 20
c. Sicherungseigentum mit Verarbeitungsklausel 20
3. Verhältnis zwischen Geld- und Warenkreditgeber 21
III. Kollision bei Nichtigkeit der Verarbeitungsklausel 21
1. Vorliegen zweier antizipierter Sicherungsübereignungen 21
a. Prioritätsgrundsatz aa. Zeitpunkt der Einigung bb. Zeitpunkt des Erwerbs
b. Besitzmittlungswillen aa. Vorrang des späteren Besitzmittlungsverhältnisses 23 bb. Besitzmittlungswillen für mehrere Erwerber 24
E. Schlussbetrachtung
I. Fazit
1. § 950 steht nicht zur Disposition
2. Ergebnisorientierte Konstruktion des BGH
3. § 950 ist zwingendes Recht
II. Eigener Lösungsansatz
1. Näheprinzip
2. Anwendung auf den Eigentumserwerb
3. Nähe des Vorbehaltslieferanten und des Kreditinstitutes 27
4. Anteilige Nähe
5. Antizipierte Sicherungsübereignung
6. Rechtsfolge
7. Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A. Problemstellung
Das Thema der vorliegenden Seminararbeit hat die Kollision zweier typ i- scher Sicherungsmittel im Kreditgeschäft in Form des verlängerten Eige n- tumsvorbehaltes durch Verarbeitungsklausel und dem Sicherungseigentum zum Thema.
Untersucht wird der Konflikt dieser Sicherungsmittel im Falle der Verwertung zwischen dem Warenkreditgeber auf der einen und dem Geldkreditgeber in Form eines Kreditinstitutes auf der anderen Seite.
Als Ausgangspunkt für die Untersuchung lässt sich folgende Fallkonstellation vorstellen.
I. Warenkreditgeber
Auf der einen Seite lässt sich der Warenkreditgeber in Form eines Lieferanten von Rohstoffen für einen produzierenden Betrieb nennen.
1. Lieferung von Rohstoffen unter Eigentumsvorbehalt
Der Produzent will die Rohstoffe jedoch nicht sofort, sondern erst später aus dem Verkaufserlös der von ihm produzierten Produkte begleichen. Der Lieferant will jedoch das Eigentum an den Rohstoffen vor Begleichung der Kaufpreisforderung nicht verlieren und verkauft deshalb gem. §§ 433, 455 I BGB1unter Eigentumsvorbehalt.
Auf der sachenrechtlichen Seite besteht die dingliche Einigung darin, dass das Eigentum gem. §§ 929, 158 I erst im Fall des Eintritts einer aufschiebenden Bedingung - der Zahlung des Kaufpreises - übergehen soll.
2. Verlust des Eigentums gem. § 950 I BGB
Der Vorbehaltskäufer muss die Rohstoffe jedoch in seinem Betrieb verarbeiten, um sie verkaufen und damit seine Verbindlichkeiten begleichen zu können. So liegt es auch im Interesse des Lieferanten, dem Produzenten gerade diese Verarbeitung zu gestatten, damit dieser die geschuldete Forderung auch begleichen kann2.
Durch die Verarbeitung der Rohstoffe zu einer ne uen Sache erwirbt jedoch der Vorbehaltskäufer gem. § 950 I das Eigentum. Der Lieferant hingegen würde dadurch das Eigentum an seinen Rohstoffen verlieren.
3. Vereinbarung einer Verarbeitungsklausel
Um den Eigentumserwerb durch Verarbeitung zu verhindern wird oftmals eine sog. Verarbeitungsklausel vereinbart, welche die Sicherheit bringen soll, dass sich das Eigentum des Lieferanten an den Rohstoffen als Eige n- tum oder zumindest als Miteigentum fortsetzt3.
II. Geldkreditgeber
Auf der anderen Seite lässt sich in der wirtschaftlichen Realität ein Geldkre- ditgeber in Form eines Kreditinstitutes nennen, welches den Produzenten mit finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Produktionsanlagen, zur Fi- nanzierung der laufenden Kosten aber auch zur Rohstoffbeschaffung aus- stattet.
1. Absicherung durch Sicherungsübereignung
Um diese Darlehen an den Produzenten abzusichern, kann sich das Kredit- institut verschiedener Sicherungsmittel bedienen. Eine Form der Kreditsi- cherung ist die Sicherungsübereignung von Rohstoffen und produzierten Erzeugnissen.
2. Zustandekommen der Sicherungsübereignung
Eine Sicherungsübereignung kommt auf der dinglichen Seite i.d.R. dadurch zustande, dass sich das Kreditinstitut und der Kreditnehmer gem. § 929 S. 1 über den Eigentumsübergang einigen. Die erforderliche Übergabe wird gem. § 930 durch ein Besitzkonstitut ersetzt, damit der Kreditnehmer im unmittelbaren Besitz der Sache bleibt und das Kreditinstitut mittelbarer Be- sitzer wird.
3. Nutzung durch den Kreditnehmer
Diese Form der Sicherungsübereignung ist sachgerecht, damit der Kredit- nehmer die übereigneten Sachen auch wirtschaftlich nutzen kann. So wird dem Kreditnehmer auch bei der Sicherungsübereignung von Rohstoffen gestattet, diese zu verarbeiten. Um das Sicherungseigentum auch an den neuen Produkten zu erhalten, kann ebenfalls eine Verarbeitungsklausel ver- einbart werden4.
III. Kollisionsfall
Zum Konflikt zwischen dem Kreditinstitut und einem anderen Kreditgeber kommt es dann, wenn der Produzent die vom Verarbeitungsvorbehalt erfassten Produkte diesem Kreditinstitut sicherungsweise übereignet und im Sicherungsfall Vorbehaltslieferant und Kreditinstitut diese Produkte gleichermaßen in Anspruch nehmen5.
B. Zulässigkeit einer Verarbeitungsklausel
Für eine Lösung der oben beschriebenen Kollision zwischen Vorbehaltseigentum und Sicherungseigentum ist zunächst eine Interpretation des § 950 notwendig. Zu untersuchen ist primär, ob eine derartige Verarbeitungskla u- sel überhaupt zulässig ist6.
I. § 950 als dispositives Recht
Eine Ansicht sieht im § 950 rein dispositives Recht. Dadurch kann § 950 durch Parteivereinbarung ausgeschlossen werden7.
1. § 950 als Konfliktlösung
Begründet wird diese Ansicht unter anderem damit, dass die Aufgabe des § 950 in der Regelung des Konfliktes der rechtlichen Interessen zwischen Stoffeigentümer und Verarbeiter läge. Ein Konflikt würde sich jedoch nicht ergeben, wenn er durch Vereinbarung zwische n Stoffeigentümer und Verar- beiter im Voraus ausgeräumt ist und der Verarbeiter gar kein Eigentum er- werben will8.
2. Analogie zu den Regelungen des Werk- und Werklieferungsvertrages
Nach einer ähnlichen Ansicht enthält § 950 zwar einen originären Eige n- tumserwerbsgrund, vertragliche Abmachungen zwischen den Lieferanten des Stoffes und dem Hersteller gehen jedoch vor9.
Dieser Ansicht liegt eine Analogie zum Werk- und Werklieferungsvertrag zugrunde. Während beim Werklieferungsvertrag in § 651 die Übereig- nungspflicht explizit erwähnt ist, fehlt eine entsprechende Vorschrift beim Werkvertrag. Daraus wird gefo lgert, dass der Besteller des „Werkes“ beim Werkvertrag - der zugleich Lieferant der Rohstoffe ist - das Eigentum direkt erwirbt10.
3. Rechtsfolge - Direkter Eigentumserwerb
Die neue Sache soll nach dieser Ansicht aufgrund der vertraglichen Aus- schaltung des § 950 an die Stelle des verarbeiteten Stoffes in das frühere Eigentumsvorbehaltsverhältnis treten11. Der Vorbehaltsverkäufer wird durch die Verarbeitungsklausel direkt Eigentümer der neuen Sache. Der Vorbehaltskäufer hingegen wäre zu keinem Zeitpunkt Eigentümer der von ihm produzierten Sache.
4. Anwartschaftsrecht
Aufgrund der Identität der neu erstellten Sache mit dem unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Rohstoffe erwirbt der Vorbehaltskäufer an der neuen Sache Vorbehaltseigentum, d.h., dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung auf den Vorbehaltskäufer übertragen wird12. Dieses hat zur Folge, dass der Vorbehaltskäufer auch das Anwartschaftsrecht an der neuen Sache erhält13.
II. Vereinbarung der Herstellereigenschaft
Der BGH und Teile der Literatur sprechen dem § 950 hingegen zwingenden Charakter zu, der einen originären Eigentumserwerb zur Folge hat14. Einer Verarbeitungsklausel komme aber bei der Ermittlung der Herstellereige n- schaft Bedeutung zu15.
1. Objektive Sichtweise der Herstellereigenschaft
Der BGH geht bei der Ermittlung der Herstellereigenschaft grundsätzlich von einer objektiven Sichtweise aus. So sei die Frage, wer Hersteller im Sinne des § 950 BGB ist, nach der Lebensanschauung zu entscheiden - maßgebend sei der Standpunkt eines objektiven mit den Verhältnissen ver- trauten Beurteilers16.
2. Ermittlung des Herstellers durch Auslegung
Bei der objektiven Ermittlung der Herstellereigenschaft wird jedoch in der Realität nicht darauf abgestellt, wer tatsächlich Hersteller der neuen Sachen ist, sondern eher auf die Vereinbarung der Parteien.
Werden Rohstoffe unter Eigentumsvorbehalt geliefert und ist dabei vereinbart, dass die Verarbeitung für die Lieferfirma zu erfolgen hat, dann ist vom Standpunkt eines objektiven Beurteilers in der Regel diese Firma Hersteller im Sinne des § 95017.
Bei der Anwendung dieser Auslegungsregel wird daher faktisch der zwin- gende Charakter des § 950 ausgehebelt und praktisch zu dispositivem Recht gemacht.
3. Rechtsfolge - Direkterwerb
Nach dieser Ansicht ist der Vorbehaltslieferant durch „objektive“ Auslegung als Hersteller der neuen Produkte anzusehen. Er erwirbt das Eigentum direkt aufgrund Verarbeitung gem. § 950. Der Vorbehaltskäufer hingegen erlangt kein Eigentum an den neuen Produkten.
4. Kein Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers
Problematisch bei dieser Ansicht ist die Tatsache, dass aufgrund der Verarbeitung gem. § 950 II sämtliche an dem verarbeiteten Stoff bestehenden Rechte erlöschen. Aufgrund der Herstellerklausel erwirbt der Vorbehaltsverkäufer direkt Eigentum. Der Vorbehaltskäufer hingegen verliert durch die Verarbeitung sein Anwartschaftsrecht an der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware. Dieses hat zunächst die Folge, dass der Vorbehaltskäufer durch die Verarbeitung weniger erlangt als vorher.
5. Antizipierte Übereignung
Um dieses offensichtlich nicht sachgerechte Ergebnis zu vermeiden, sind zwei Möglichkeiten ersichtlich, um dem Vorbehaltskäufer ein Anwart- schaftsrecht an der neuen Sache zu vermitteln. Zum einen könnte der § 950 II durch Vereinbarung für abbedungen erklärt werden18. Dieser Weg wäre aufgrund des zwingenden Charakters des § 950 nach dieser Ansicht jedoch nicht möglich. Es bliebe nur der Weg, zwischen Vorbehaltsverkäufer und Vorbehaltskäufer eine antizipierte Übereignung unter einer aufschiebenden Bedingung nach §§ 929 S. 2, 158 I anzunehmen, so dass der Vorbehaltsver- käufer nur für eine juristische Sekunde unbelastetes Eigentum erlangt19.
6. Mehrere Vorbehaltslieferanten
Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass Vorbehaltsware mehrerer Lie- feranten verarbeitet wird. Für diesen Fall sichern sich diese durch die Ver- arbeitungsklausel einen Miteigentumsanteil an der neuen Sache20. Fehlt je- doch eine solche Klausel, so ve rliert der Stoffeigentümer sein Eigentum zugunsten derer, die aufgrund der Verarbeitungsklausel als Hersteller i.S.d. § 950 gelten21. Ihm verbleibt nur einen Anspruch aus ungerechtfertigter Be- reicherung22.
7. Übersicherung
Der Hersteller i.S.d. § 950 erwirbt das Alleineigentum an den aus dem Ro h- stoff hergestellten Gegenständen mit der Folge, dass wegen der Übersiche- rung die Unwirksamkeit der Klausel droht, wenn der Wert der neu herge- stellten Sachen gegenüber dem Wert des Materials auch noch um den Wert des Materials erhöht wurde, dass Dritte beigesteuert habe23. Der Verarbei- tungsvorbehalt hat den Zweck, den Vorbehaltslieferanten in dem Umfang zu sichern, wie er die auf Kredit gelieferte Sache weggegeben hat24.
So wurden die AGB eines Lieferanten, die den Eigentumsvorbehalt auch auf die durch Verarbeitung entstandenen Sachen erstreckt, ohne das wertmäßige Verhältnis zu anderen verarbeiteten Teilen zu berücksichtigen, wegen Übersicherung gem. § 9 Abs. 1 AGBG für nichtig erklärt25.
8. Vereinbarung einer eingeschränkten Verarbeitungsklausel
In einem solchen Fall ist daher die Klausel zur Vermeidung von Rechtsnachteilen dahingehend zu fassen, wonach der Vorbehaltslieferant nur einen Bruchteil des Eigentums an der neu hergestellten Sache erwirbt, wobei der zu erwerbende Anteil nach dem Verhältnis des Wertes mehrerer Sachen zueinander bemessen werden kann26. Dieses ist beispielsweise dem Wert des Rohstoffes im Verhältnis zum Wert des Fertigfabrikates oder im Verhältnis der Rohstoffe untereinander möglich27.
III. § 950 als zwingendes Recht
Eine weitere Ansicht28sieht in dem Tatbestand und der Rechtsfolge des § 950 zwingendes Recht.
1. Originärer Eigentumserwerb
Die Verarbeitung ist demnach ein Realakt und kein Rechtsgeschäft. Die rechtliche Wirkung tritt unabhängig von einem darauf gerichteten Willen ein29. Der Erfolg des § 950 kann daher nicht durch die Erklärung des Verar- beiters, für einen anderen herstellen zu wollen, ausgeschlossen werden30. Vielmehr wird die Funktion des § 950 vor allem darin gesehen, einen klaren Ausgangspunkt für die Beurteilung der Eigentumsverhältnisse zu scha ffen31. Durch diese Publizitätswirkung lässt sich der neuen Sache sicherer und er- kennbarer vermögensrechtlicher Stand zuweisen32. Dadurch werden auch die Interessen der Gläubiger des Verarbeiters und allgemein die Int eressen des Geschäftsverkehrs, der darauf vertrauen können soll, dass das neu ge- schaffene Werk dem Hersteller gehört, geschützt33.
Durch eine Verarbeitungsklausel kann demnach § 950 nicht ausgeschaltet werden, so dass der Hersteller Eigentümer an der neu erstellten Sache wird. Eine Verarbeitungsklausel ist somit unwirksam.
2. Herstellereigenschaft
Wie bereits erörtert sieht auch die Rechtsprechung in § 950 einen originären Eigentumserwerb der neuen Sachen, lässt aber - um ein gewünschtes Er- gebnis konstruktiv zu ermöglichen34- den Vorbehaltsverkäufer zum Her- steller werden.
a. Auslegung nach tatsächlichen Verhältnissen
Nach dieser Ansicht ist jedoch bei der Bestimmung der Herstellereigenschaft von einer objektiven Betrachtungsweise auszugehen. Daher ist durch Auslegung der Verarbeitungsklausel oder gar durch die Vereinbarung der Herstellereigenschaft § 950 nicht abdingbar35. Im Gegensatz zum BGH wird bei der Ermittlung der Herstellereigenschaft auf tatsächliche Verhältnisse und nicht auf konstruierte Vereinbarungen abgestellt36.
b. Anhaltspunkte für die Ermittlung der Herstellereigenschaft
Als Anhaltspunkte für eine objektive Herstellereigenschaft wird oftmals das Produktions- und Absatzrisiko für die neuen Produkte gesehen37. So wird im wirtschaftlichen „Normalfall“ die Vorbehaltsware im eigenen Risiko des Vorbehaltskäufers verarbeitet. Er trägt unmittelbar das Produktions- und Absatzrisiko. Die Zahlungspflicht aus dem Kaufvertrag mit dem Vorbehaltslieferanten bleibt jedoch bestehen. Das Interesse des Vorbehaltsverkäufers liegt nur in der Erlangung seines Kaufpreises.
Als weiteres Indiz kann auch darauf abgestellt werden, ob der verarbeitende Betrieb nach seiner Stellung im Wirtschaftsablauf regelmäßig für sich oder für andere verarbeitet38.
Nach diesen aufgestellten Maximen ist daher zu ermitteln, wer Hersteller i.S.d. § 950 ist. Im „Normalfall“ des Vorbehaltslieferanten will dieser nur seine Kaufpreisforderung gesichert haben. Er trägt somit im Regelfall nichts am Verarbeitungsprozess bei, so dass keine Herstellereigenschaft anzune h- men ist.
3. Eigentumserwerb des Produzenten
Nach dieser Ansicht ist eine Verarbeitungsklausel unwirksam. Auch eine Vereinbarung über die Herstellereigenschaft oder die Auslegung einer Ver- arbeitungsklausel in diesem Sinne ist unwirksam. Der tatsächliche Hersteller der neuen Sache - im Regelfall also der Vorbehaltskäufer - wird daher zu- nächst durch Verarbeitung i.S.d. § 950 Eigentümer der neu erstellten Sa- chen.
4. Antizipiertes Besitzkonstitut
Aufgrund der Unwirksamkeit von Verarbeitungsklauseln kann sich der Lie- ferant beim verlängerten Eigentumsvorbehalt nur durch eine vorwegge- nommene - auflösend bedingte - Sicherungsübereignung schützen39. Bei der Vereinbarung einer Verarbeitungsklausel wäre hingegen auch eine Umdeutung der Verarbeitungsklausel gem. § 140 in eine antizipierte Siche- rungsübereignung denkbar. So wird vertreten, dass die unwirksame Verar- beitungsklausel regelmäßig in eine antizipierte und auflösend bedingte Si- cherungsübereignung der neuen Sache umzudeuten sei40.
5. Allgemeine Voraussetzungen der Sicherungsübereignung
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die antizipierte Sicherungsübereignung den allgemeinen Anforderungen - wie dem Bestimmtheitsgrundsatz - ent-spricht41. Bezüglich der genauen Voraussetzungen sei auf das Kapitel Sicherungseigentum verwiesen.
6. Rechtsfolge - Durchgangserwerb
Die Konstellation der antizipierten Sicherungsübereignung führt jedoch aufgrund des vorherigen Eigentumserwerbs des Vorbehaltskäufers zum Durchgangseigentum42.
Der Eigentumserwerb des Vorbehaltskäufers ist zwar zeitlich kaum zu messen und damit praktisch nicht vorhanden, er ist dennoch für die sog. „juristische Sekunde“ vorha nden. In diesem gedanklichen Augenblick des Durchgangs beim Vorbehaltskäufers kann das Eigentum mit gesetzlichen Pfandrechten belastet werden, in den Haftungsverband von Hypotheken fallen oder zur Konkursmasse des Käufers gezogen werden43.
Gerade dieser Aspekt kann die Sicherungsmöglichkeiten für den Vorbe- haltslieferanten einschränken. Bei einem wirtschaftlich gesunden Unter- nehmen ist der Eigentumserwerb durch den Vorbehaltskäufer für die „juris- tische Sekunde“ nicht von Bedeutung. Bei einem Unternehmen mit Zah- lungsschwierigkeiten oder gar in der Insolvenz hingegen kann durch den Durchgangserwerb die Sicherheit für den Vorbehaltslieferanten wertlos werden.
C. Sicherungsübereignung
Wie bereits oben dargestellt, hat der Vorbehaltslieferant bei einer grundsätzlichen Unwirksamkeit von Verarbeitungs- oder Herstellerklauseln nur die Möglichkeit einer antizipierten Sicherungsübereignung.
Auch der Geldkreditgeber in Form eines Kreditinstituts kann sich zur Sicherheit produzierte Waren sicherungshalber übereignen lassen. Im Folgenden sollen kurz grundsätzliche, für dieses Thema relevante Aspekte der Sicherungsübereignung dargestellt werden.
I. Bestimmbarkeit
Der Bestimmtheitsgrundsatz verlangt, dass anhand äußerer Abgrenzungskriterien für jeden Dritten, der Kenntnis von der Sicherungsabrede hat, eindeutig erkennbar ist, welche Sachen von der Sicherungsübereignung erfasst werden und welche nicht44.
Bei einer einzelnen schon existierenden Sache ist dieses Erfordernis relativ leicht zu erfüllen. Bei noch zu erstellenden Produkten in größerer und wechselnder Zahl könnte dieses Erfordernis hingegen Probleme bereiten.
II. Antizipierte Sicherungsübereignung
Bei der antizipierten Sicherungsübereignung ist die Besonderheit, dass es sich um die Übereignung einer Sache handelt, die noch gar nicht existiert. Bei einer antizipierten Sicherungsübereignung einigen sich daher Siche- rungsgeber und Sicherungsnehmer schon jetzt darüber, dass das Eigentum an bestimmten Sachen auf den Sicherungsgeber übergehen soll45.
1. Bestehen eines Besitzmittlungsverhältnisses
Ein Erfordernis für eine erfolgreiche antizipierte Sicherungsübereignung ist das Bestehen eines Besitzmittlungsverhältnisses zu dem Zeitpunkt, in dem der Eigentumsübergang vorgesehen ist46. Der Sicherungsgeber muss bei Vollendung der Sicherungsübereignung noch den Willen haben, dem Siche- rungsnehmer das Eigentum zu übertragen, was jedoch grundsätzlich vermu- tet wird47. Fehlt es jedoch an einem solchen Willen und lässt der Siche- rungsgeber dieses auch nach außen erkennen, kommt die Sicherungsüber- eignung nicht zustande48.
2. Warenlager mit wechselndem Bestand
Beim Warenlager mit wechselnden Bestand verlangt der Bestimmtheits- grundsatz, dass hinsichtlich der später hinzutretenden Waren durch ein ein faches, nach außen erkennbares Geschehen im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs für jeden, der die Parteiabreden kennt, ohne weiteres ersichtlich sein muss, welche individuell bestimmten Sachen übereignet sind49.
3. Ausführungshandlung
Daher ist oftmals eine Ausführungshandlung notwendig. Der Kreditnehmer muss die zur Sicherungsübereignung bestimmten Sachen räumlich absondern oder kennzeichnen, um die Bestimmtheit der vorher nur bestimmbaren zu übereigneten Sachen zu erreichen50. Aus diesem Erfordernis lassen sich folgende Möglichkeiten ableiten.
aa. Raumsicherungsvertrag
Die Ausführungshandlung beim Raumsicherungsvertrag besteht darin, dass die zur Sicherheit übereigneten Sachen getrennt gelagert werden. Es wird ein bestimmter räumlicher Bezirk festgelegt, indem alle Sachen übereignet werden, die sich in diesem räumlichen Bezirk befinden oder später hinein- gebracht werden51.
In diesem Zusammenhang ist es grundsätzlich unschädlich für die Bestimmbarkeit, wenn sich darunter auch Sachen im aufschiebend bedingten Eigentum des Veräußerers befinden, da gleichzeitig i.d.R. auch die Übertragung der Anwartschaftsrechte vereinbart wird52.
bb. Markierungsvertrag
Die Ausführungshandlung beim Markierungsvertrag besteht darin, dass die sicherungshalber übereigneten Sachen entsprechend markiert werden53oder durch Aufnahme in ein Verzeichnis unter genauer Angabe individueller Merkmale konkret umschrieben werden54.
cc. Verarbeitung
Als weitere Ausführungshandlung lässt sich die Verarbeitung von Vorbe- haltsware und Sicherungseigentum gerade in den Fällen vorstellen, wenn eine Verarbeitungsklausel in eine antizipierte Sicherungsübertragung umge- deutet wird.
III. Sicherungseigentum in der Insolvenz
Die sicherungsübereigneten Gegenstände sollen das Kreditinstitut und den Vorbehaltslieferanten gerade auch für den Fall der Insolvenz des Kreditnehmers und Vorbehaltskäufers sichern.
1. Sicherungseigentum des Kreditinstituts
Das Kreditinstitut erwirbt aufgrund der Sicherungsübereignung dinglich gesehen vollwertiges Eigentum. Dieses Eigentum steht dem Kreditinstitut jedoch nicht wirtschaftlich zu, sondern dient nur der Sicherung eines Darlehens. In der Insolvenz des Sicherungsgebers steht dem Kreditinstitut gem. § 51 Nr. 1 InsO daher nur ein Absonderungsrecht zu.
2. Sicherungseigentum des Vorbehaltslieferanten
Problematisch hingegen könnte es bei dem Sicherungseigentum des Vorbe- haltslieferanten werden. Aufgrund eines einfachen Eigentumsvorbehaltes wäre er nach wie vor Eigentümer und somit aussonderungsberechtigt im Sinne von § 47 InsO. Der Vorbehaltslieferant wird aufgrund seines verlä n- gerten Eigentumsvorbehalts (Verarbeitungsklausel) nicht als Aussonde- rungs-, sondern als Absonderungsberechtigter betrachtet, da der Verkäufer die neue Sache nicht behalten will, sondern lediglich zu Sicherungszwecken nutzen will - Ausschlaggebend ist daher die im Vordergrund stehende Si- cherungsfunktion55. Auch der Vorbehaltslieferant ist daher wie das Kredit- institut als Sicherungsnehmer i.S.d. § 51 Nr. 1 InsO zu sehen, dem nur ein Absonderungsrecht zusteht.
D. Kollisionsfälle
Im Teil A wurden die kontroversen Meinungen über die Rechtsnatur des § 950 und über die Zulässigkeit einer Verarbeitungsklausel dargestellt. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass es sich beim Eigentumserwerb des Vorbehaltslieferanten je nach Ansicht um einen direkten Eige n- tumserwerb oder um einen Durchgangserwerb handelt.
Im folgenden soll daher geklärt werden, inwieweit dieser Aspekt bei einer Kollision mit dem Sicherungseigentum eines Kreditinstitutes von Bedeu- tung ist.
I. Kollision bei Abdingbarkeit des § 950
Wie oben festgestellt wurde, erwirbt der Vorbehaltslieferant aufgrund der Ausschaltung des § 950 direkt Eigentum an der neuen Sache. Der Vorbehaltskäufer erhält jedoch das Anwartschaftsrecht an der neuen Sache.
1. Sicherungsübereignung an ein Kreditinstitut
Sollte der Vorbehaltskäufer die zu produzierenden Gegenstände sicherungs- halber ohne Einwilligung des Vorbehaltslieferanten an ein Kreditinstitut übereignen, würde er unberechtigt über fremdes Eigentum verfügen, was eine unwirksame Verfügung durch einen Nichtberechtigten gem. § 185 I darstellt. Die Sicherungsübereignung würde fehlschlagen. In Betracht könnte noch eine gutgläubiger Erwerb gem. §§ 929, 932 I, 933 seitens des Kreditinstituts kommen. Voraussetzung dafür wäre jedoch die Besitzerlangung - ungenügend ist hingegen die Vereinbarung eines Besitz- konstituts gem. § 93056. Dadurch erwirbt das Kreditinstitut kein Sicherungs- eigentum an den produzierten Gegenständen.
2. Übertagung des Anwartschaftsrecht
Die fehlgeschlagene Sicherungsübereignung könnte hingegen in die Über- tragung des Anwartschaftsrecht umgedeutet werden, wonach das Kreditin- stitut analog zu § 268 durch Zahlung des Restkaufpreises an den Vorbe haltsverkäufer ein Ablösungsrecht hätte57. Dieses hätte zur Folge, dass das Kreditinstitut das Sicherungseigentum durch Zahlung des Restkaufpreises erhalten würde.
Diese Möglichkeit gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn der Vorbehaltslieferant zwar noch Eigentümer, die Restschuld aber gering ist. Durch den vergleichsweise geringen Aufwand, sichert sich das Kreditinstitut das Sicherungseigentum an den neuen Sachen.
3. Wertsteigerung durch Verarbeitung
Ein Problem ergibt sich daraus, dass der Vorbehaltslieferant durch seine Eigentümerstellung an der neuen Sache i.d.R. eine größere Sicherheit be- sitzt, als den Wert seiner gelieferten Ware. Der Vorbehaltslieferant soll den Verarbeitungswert jedoch nicht als Sicherung in Anspruch nehmen kön- nen58.
Um dem Vorbehaltskäufer den Verarbeitungswert zu erhalten oder andersherum, dem Vorbehaltslieferanten den Verarbeitungswert nicht als Sicherheit zukommen zu lassen, ließe sich bei freier vertraglicher Disposition des § 950 folgende Lösung vorstellen.
Der Vorbehaltskäufer und Vorbehaltsverkäufer erlangen Miteigentumsantei- le in Höhe des Material- und Verarbeitungswertes59. Dadurch hätte der Vor- behaltslieferant eine Sicherheit in Höhe seiner gelieferten Ware. Der Mitei- gentumsanteil des Vorbehaltskäufers hingegen könnte durch eine antizipier- te Sicherungsübereignung auf das Kreditinstitut übergehen. Dieses würde insbesondere dann in Betracht kommen, wenn der Vorbehalts- lieferant als Kreditnehmer dem Kreditinstitut im Rahmen eines Raumsiche- rungs- oder Markierungsvertrages das Eigentum an den hinzukommenden Gegenständen im Voraus übereignet hat.
Außerdem wird von der antizipierten Sicherungsübereignung auch das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufer an dem Miteigentumsanteil des Vorbehaltsverkäufers erfasst.
4. Verarbeitung von Sachen verschiedener Eigentümer
Weiter ist zu beachten, dass Ware des Vorbehaltskäufers und die anderer Vorbehaltslieferanten sowie Ware, die sicherungsweise übereignet wurde verarbeitet werden könnten. In diesem Zusammenhang lassen sich folgende Fallkonstellationen vorstellen.
a. Verarbeitung von Waren des Vorbehaltsverkäufers und -käufers
Es ließe sich der Fall vorstellen, dass der Vorbehaltskäufer neben den Vorbehaltswaren auch eigene Rohstoffe verarbeitet. Durch die vertragliche Ausschaltung des § 950 würden Vorbehaltskäufer und Vorbehaltsverkäufer Miteigentümer gem. § 947 I im Verhältnis der Ware60.
An dem Anteil des Vorbehaltsverkäufers könnte das Kreditinstitut kein Si- cherungseigentum erwerben. Der Miteigentumsanteil des Vorbehaltskäufers würde wieder im Wege der antizipierten Sicherungsübereignung auf das Kreditinstitut übergehen. Die Folge wäre ein Miteigentum des Vorbehalts- verkäufers in Höhe seiner gelieferten Rohstoffe und ein - im Wege des Durchgangserwerbs erlangtes - Miteigentum des Kreditinstitutes i.H. des Materialwertes des Vorbehaltskäufers und des Verarbeitungswertes. Weiter würde das Kreditinstitut durch die antizipierte Sicherungsübereignung noch die Anwartschaft auf den Miteigentumsanteil des Vorbehaltskäufers erha l- ten.
b. Verarbeitung von Vorbehaltseigentum und Sicherungseigentum
Eine weitere mögliche Konstellation wäre, wenn die eigenen Rohstoffe des Produzenten schon vorher sicherheitshalber an das Kreditinstitut übereignet worden wären.
aa. Sicherungsübereignung ohne Verarbeitungsklausel
Enthielte der Sicherungsvertrag keine Verarbeitungsklausel, würde gem. § 950 zunächst das (Sicherungs-) Eigentum des Kreditinstituts untergehen. Nach der „Miteigentumslösung“ wären zunächst Vorbehaltsverkäufer und der Vorbehaltskäufers Miteigentümer gem. § 947. Die Höhe des Miteige n- tumsanteils des Vorbehaltslieferanten läge - eine entsprechende Vereinba- rung vorausgesetzt - in Höhe seines Materialwertes vor. Der Vorbehaltskäu- fer würde einen Miteigentumsanteil in Höhe des Materialwertes und des Verarbeitungswertes erlangen. Dieser Miteigentumsanteil und das Anwart- schaftsrecht des Vorbehaltskäufers könnten jedoch wieder von einer antizi- pierten Sicherungsübereignung erfasst werden. Es würde jedoch ein Durch- gangserwerb stattfinden.
bb. Sicherungsübereignung mit Verarbeitungsklausel
Bei einem Sicherungsvertrag mit Verarbeitungsklausel61läge das Eigentum dann beim Vorbehaltslieferant und dem Kreditinstitut. Sie wären Miteige n- tümer gem. § 947 I. Bei konsequenter Betrachtung könnte bei der „Mitei- gentumslösung“ dann das Miteigentum bei dem Vorbehaltslieferanten, dem Kreditinstitut und in der Höhe des Verarbeitungswertes bei dem Produzen- ten liegen. In dieser Konstellation lässt sich aber eher eine Vertragsgestal- tung vorstellen, in der das Kreditinstitut62(oder aber auch der Vorbehaltslie- ferant) durch die Verarbeitungsklausel auch den Verarbeitungswert anteilig in sein (Mit-) Eigentum übernimmt.
II. Kollision bei Vereinbarung der Herstellereigenschaft
Wie bereits oben festgestellt, erwirbt der Vorbehaltslieferant aufgrund seiner Herstellereigenschaft direkt und originär Eigentum aufgrund Verarbeitung gem. § 950 I an der neuen Sache. Das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers geht zunächst gem. § 950 II unter.
1. Sicherungsübereignung bei uneingeschränkter Verarbeitungsklausel
Durch den direkten Eigentumserwerb des Vorbehaltslieferanten an der ne u- en Sache bei einer uneingeschränkten Verarbeitungsklausel ist keine Sicherungsübereignung an das Kreditinstitut möglich, da der Vorbehaltskäufer zu keinem Zeitpunkt Eigentümer geworden ist.
a. Übertragung der Anwartschaft
Aber auc h durch den Verlust des Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers liefe eine Sicherungsübereignung an das Kreditinstitut ins Leere. Die einzige Sicherungsmöglichkeit für das Kreditinstitut wäre eine Übertra- gung des Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers, wenn dieser sich die neue Sache aufschiebend bedingt von dem Vorbehaltslieferanten übereige- nen lassen hat.
Bei dieser Konstellation stände das Kreditinstitut jedoch hinter dem Vorbehaltskäufer. Für das Kreditinstitut eröffnet sich allerdings die Möglichkeit, analog zu § 268 abzulösen und dadurch das Eigentum zu erla ngen63.
b. Stillschweigende Vereinbarung
Falls diese Möglichkeit nicht ausdrücklich vereinbart ist, spricht jedoch die Interessenlage für eine stillschweigend vereinbarte bedingte Übertragung des Anwartschaftsrechts64.
c. Durchgangserwerb der Anwartschaft
Es ist jedoch zu beachten, dass der Vorbehaltskäufer das Anwartschaftsrecht für ein sog. „juristische Sekunde“ innehat. Dieses führt wiederum zum Durchgangserwerb für das Kreditinstitut mit den oben erörterten Folgen.
d. Verarbeitung von Sicherungseigentum
Problematisch für das Kreditinstitut ist weiter der Aspekt, dass das Sicherungseigentum an Rohstoffen durch die Verarbeitung untergeht. Durch die Verarbeitungsklausel wird der Vorbehaltsverkäufer als Hersteller i.S.d. § 950 I Alleineigentümer der neuen Sache.
Als Sicherungsmöglichkeit für das Kreditinstitut bliebe wiederum nur die Übereignung des durch bedingter Übereignung an den Vorbehaltskäufer entstandenen Anwartschaftsrechts.
2. Sicherungsübereignung bei eingeschränkter Verarbeitungsklausel
Bisher wurde von der Verwendung einer uneingeschränkten Verarbeitungs- klausel ausgegangen. Wegen der schon dargestellten Gefahr der Übersiche- rung wird im Folgenden von einer eingeschränkten Verarbeitungsklausel ausgegangen.
a. Verarbeitung von Vorbehaltsware
Bei der Verarbeitung von Vorbehaltsware bietet sich folgender Weg an, um eine Übersicherung und somit eine Nichtigkeit der Verarbeitungsklausel zu verhindern. Verarbeitet der Vorbehaltskäufer die Ware des Vorbehaltsliefe- ranten, werden beide im Verhältnis von Stoffwert und Verarbeitungswert Miteigentümer65.
Dadurch würde das Kreditinstitut mittels einer antizipierten Sicherungs- übereignung den Miteigentumsanteil des Vorbehaltskäufers - also seines Kreditnehmers - erhalten. Bezüglich der Anwartschaft auf den Miteige n- tumsanteil des Vorbehaltskäufers sei auf das schon oben erörterte verwie- sen.
b. Verarbeitung von Sicherungseigentum und Vorbehalts ware
Sind die eigenen Rohstoffe vorher an das Kreditinstitut sicherungshalber übereignet worden, verliert dieses sein Sicherungseigentum gem. § 950 II aufgrund der Verarbeitung. Bei einer eingeschränkten Verarbeitungsklausel werden im Gegensatz zur uneingeschränkten Verarbeitungsklausel Vorbehaltslieferant und Vorbehaltskäufer anteilig Miteigentümer gem. § 1008. Der Miteigentumsanteil des Vorbehaltskäufers wäre durch die antizipierte Sicherungsübereignung des Kreditinstitutes erfasst. Bezüglich des Anwartschaftsrechtes sei auf das schon Gesagte verwiesen.
c. Sicherungseigentum mit Verarbeitungsklausel
Um sich das Eigentum an den neuen Produkten zu sichern, kann in einem Sicherungsvertrag zwischen Produzenten und dem Kreditinstitut ebenfalls eine Verarbeitungsklausel vereinbart werden66. Das Kreditinstitut würde dann einen Miteigentumsanteil bei Verarbeitung erhalten, dessen Größe sich nach dem Verhältnis der jeweiligen Rohstoffanteile bestimmt. Bezüglich der Anwartschaft auf den Miteigentumsanteil des Vorbehaltslieferanten gilt das Gesagte.
3. Verhältnis zwischen Geld- und Warenkreditgeber
Die Fälle der uneingeschränkten Verarbeitungsklausel lösen sich in der Weise auf, dass sie aufgrund der Übersicherung nichtig sind. In diesem Fall gebe es zumindest keinen Konflikt zwischen dem Kreditinstitut und dem Vorbehaltslieferanten.
In den Fällen der eingeschränkten Verarbeitungsklausel kollidieren die Sicherheiten der beiden Sicherungsnehmer nicht wirklich. Sie stehen vielmehr im Verhältnis der auch zu sichernden Forderung nebeneinander. Bezüglich des Miteigentumsanteils, der den Verarbeitungswert umfasst lässt sich noch anführen, dass eine Vereinbarung möglich ist, wonach sich der Miteigentumsanteil nur auf den Materialwert bezieht oder auch anteilig den Verarbeitungswert mitumfasst67. Dieses würde die Sicherheit der Kreditgeber anteilig noch um den Verarbeitungswert erhöhen.
III. Kollision bei Nichtigkeit der Verarbeitungsklausel
Bei einer Nichtigkeit einer Verarbeitungsklausel aufgrund zwingenden Rechtes des § 950 wurde im Teil B festgestellt, dass eine Sicherung des Vorbehaltslieferanten nur über eine antizipierte Sicherungsübereignung möglich ist und eine Verarbeitungsklausel in eine solche umgedeutet wird. Diese Konstellation führt nach der Produktion der neuen Sache zum Durchgangserwerb für den Vorbehaltslieferanten, da der Vorbehaltskäufer für eine „juristische Sekunde“ Eigentümer wird.
1. Vorliegen zweier antizipierter Sicherungsübereignungen
Durch eine Sicherungsübereignung an das Kreditinstitut lägen damit jedoch zwei antizipierte Sicherungsübereignungen vor.
a. Prioritätsgrundsatz
Eine Möglichkeit, um die Kollision zwischen der Sicherungsübereignung zu entscheiden, wäre auf den zeitlichen Aspekt abzustellen. Wie bei der Kolli- sion zwischen Globalzession und der Vorausabtretung aus dem verlängerten Eigentumsvorbehalt könnte der Prioritätsgrundsatz Anwendung finden. Nach dem Prioritätsgrundsatz hat die zuerst vereinbarte Abtretung grund- sätzlich Vorrang68. Im Falle mehrerer antizipierter Sicherungsübereignun- gen müsste dementsprechend darauf abgestellt werden, zu welchem Zeit- punkt, die jeweilige Sicherungsübereignung vollzogen wurde. Im Regelfall hat der Vorbehaltskäufer und Kreditnehmer des Kreditinstituts das Waren- lager zu einem früheren Zeitpunkt die Neuzugänge antizipiert auf das Kre- ditinstitut übereignet.
aa. Zeitpunkt der Einigung
Wenn auf diesen Einigungszeitpunkt abgestellt wird, liegt die Sicherungs- übereignung an das Kreditinstitut zeitlich vor der an den Vorbehaltslieferan- ten. Die Kollision würde dahingehend aufgelöst, dass der Vorbehaltsliefe- rant kein Eigentum erworben hätte. Die Sicherungsübereignung an den Vorbehaltskäufer wäre faktisch eine unberechtigte Verfügung eines Nicht- berechtigten. Auch ein gutgläubiger Erwerb scheidet aufgrund des Besitzer- fordernisses aus § 933 aus.
bb. Zeitpunkt des Erwerbs
Durch die Einigung ist eine Sicherungsübereignung jedoch noch nicht zu- stande gekommen. Diese Einigung in Form des Eigentumsverschaffungswillen gem. § 929 1 ist unverbindlich69. Das Prioritätenprinzip regelt jedoch den Vorrang des Erwerbers, dessen Erwerb sich als erster vollendet70. Vollendet ist der Erwerb jedoch erst, wenn die neue Sache produziert wird. Dadurch würden der Vorbehaltslieferant und das Kreditinstitut zum gleichen Zeitpunkt Eigentümer. Daher kann die Kollision nicht mittels des Prioritätsgrundsatz aufgelöst werden. Etwas grundsatz aufgelöst werden. Etwas anderes würde sich ergeben, wenn die Sicherungsübereignung der Rohstoffe an das Kreditinstitut keine Verarbeitungsklausel enthalten würde. Läge die Ausführungshandlung darin, dass die neue Sache im Rahmen einer Raumsicherungsübereignung erst in den vorgesehenen Raum gebracht werden muss, würde der Vorbehaltslieferant schon vorher - im Zeitpunkt der Fertigstellung - Eigentümer. Die Sicherungsübereignung an das Kreditinstitut liefe ins Leere.
b. Besitzmittlungswillen
Wie im Teil C festgestellt wurde, ist für eine erfolgreiche Sicherungsübereignung erforderlich, dass der Besitzmittlungswille des Veräußerers zum Zeitpunkt des geplanten Eigentumsübergangs noch vorhanden ist, da die Sicherungsübereignung ansonsten scheitern würde.
Bei mehrfachen Übereignungen durch vorweggenommenes Besitzmittlungsverhältnis ist daher entscheidend, an wen der Veräußerer bei Besitzerlangung veräußern will und nicht, mit wem der erste Übereignungsvertrag geschlossen wurde71.
aa. Vorrang des späteren Besitzmittlungsverhältnisses
Der BGH vertritt in diesem Zusammenhang den Standpunkt, dass der unmittelbare Besitzer mit der Vereinbarung des späteren Besitzmittlungsverhältnisses zum Ausdruck bringe, dass er nicht mehr für den bisherigen mittelbaren Besitzer besitzen wolle72. Die später erfolgte Sicherungsübereignung hätte demnach Vorrang.
Je nachdem, welche antizipierte Sicherungsübereignung später vereinbart wurde, begünstigt dieser Ansicht entweder den Vorbehaltslieferanten oder das Kreditinstitut. Ist beispielsweise ein Darlehen an den Vorbehaltskäufer durch eine Raumsicherungsübereignung abgesichert, wird diese bei später unter verlängertem Eigentumsvorbehalt gelieferter Ware ins Leere laufen. Diese Konstellation dürfte zudem der Regelfall sein. Die Raumsicherungs- übereignung wird voraussichtlich nicht laufend erneuert, wobei Ware - ge- liefert unter Anerkennung der AGB des Vorbehaltslieferanten - des öfteren gekauft und unter der (umgedeuteten) Verarbeitungsklausel verarbeitet wird. Darum kann gesagt werden, dass diese Lösung eher den Vorbehalts- lieferanten begünstigt und er das Sicherungseigentum an der neuen Sache erhält. Die Sicherungsübereignung des Kreditinstituts hingegen liefe ins Leere.
bb. Besitzmittlungswillen für mehrere Erwerber
Eine andere Ansicht sieht in der Lösung, die Kollision zweier antizipierter Sicherungsübereignungen aufgrund des Besitzmittlungswillen des Siche- rungsgebers abzustellen, die Gefahr, dass die Kreditsicherheit der beiden Kreditgeber - hier in Form des Vorbehaltslieferanten und des Kreditinstituts von der Willkür des Herstellers abhängt73.
Um eine sachgerechte, anteilmäßig ausgewogene Verteilung des Siche- rungsgutes zu erreichen soll dem Besitzmittler der Willen unterstellt wer- den, den Sicherungsnehmern gemeinschaftliches Eigentum nach Bruchteilen zu verschaffen, wobei sich dieser Anteil aus dem Verhältnis der beigesteuer- ten Stoffe bemisst74.
Mit diesem Ansatz wird erreicht, dass Vorbehaltslieferant(en) und das Kre- ditinstitut ihrem Kreditrisiko anteilmäßig abgesichert wären. Es käme zu keiner Kollision der Sicherungsübereignungen, sondern zu einer Aufteilung des Sicherungseigentums im Rahmen von Miteigentum nach Bruchteilen gem. § 1008.
E. Schlussbetrachtung
I. Fazit
Im Teil A dieser Arbeit wurden die unterschiedlichen Auffassungen zur Vereinbarkeit von Verarbeitungsklauseln mit dem § 950 dargestellt. In bezug auf die Abdingbarkeit des § 950 und der Vereinbarkeit der Herstellereigenschaft ergeben sich folgende Bedenken.
1. § 950 steht nicht zur Disposition
Es ist durchaus nachvollziehbar, wenn die Vertreter der Abdingbarkeit des § 950 als Argument anführen, dass § 950 einen Konflikt lösen will und daher § 950 entbehrlich ist, wenn es keinen Konflikt gäbe.
Jedoch ist der § 950 ein originärer Erwerbstatbestand, der eine Form des Eigentumserwerbes regelt. Daher hat der Verarbeiter zunächst auch Eige n- tum zu erwerben.
Jemand, der allerdings kein Eigentum will, braucht auch keines aufgedrängt zu bekommen. Da existiert jedoch die Möglichkeit der antizipierten Über- eignung. Daher ist grundsätzlich eine Abdingbarkeit des § 950 zu verneinen.
2. Ergebnisorientierte Konstruktion des BGH
Bei der objektiven Auslegung der Herstellereigenschaft, die praktisch die Ausheblung des § 950 darstellt, wird der Eindruck erweckt, dass der BGH, um den Vorbehaltslieferanten zu schützen, ergebnisorientiert arbeitet. Es soll hier offen bleiben, ob das vom BGH gewünschte Ergebnis erstre- benswert ist oder nicht. Es kann aber nicht sein, dass aufgrund eines ge- wünschten Ergebnisses, einen originäreren Eigentumserwerb durch eine Konstruktion über die Herstellereigenschaft praktisch auszuhebeln. Es ist auch gerade in bezug auf den Möglichkeiten des Miteigentums sehr fragwürdig, als was die Miteigentümer gelten. Sie müssten alles Mitherstel- ler sein.
3. § 950 ist zwingendes Recht
Aus diesen und auch den schon im Teil B dargelegten Gründen ist eine Dispositionsfreiheit oder die Vereinbarung der Herstellereigenschaft abzule h- nen. § 950 ist als originärer Erwerbstatbestand zu sehen und der Hersteller ist auch im Interesse der Rechtssicherheit objektiv zu ermitteln.
II. Eigener Lösungsansatz
Für die Auflösung einer Kollision zwischen Vorbehaltseigentum und der Sicherungsübereignung wäre unter Zugrundelegung des zwingenden Charakters des § 950 folgender Lösungsweg denkbar.
1. Näheprinzip
Die Grundlage dieses Lösungsweges wäre eine sinngemäße Anwendung eines für die Konfliktlösung zwischen Globalzession und Vorausabtretung entwickelten Ansatzes.
Nach dem sog. Näheprinzip ist dem Warenlieferanten der Vorzug zu geben, weil der Warenwert in der Forderung verkörpert ist und der Warenlieferant deshalb der Forderung näher stehe75. Dieser Grundsatz könnte in modifizier- ter Form auch bei einem Konflikt zwischen dem Vorbehaltskäufe r (Verar- beitungsklausel) und dem Sicherungseigentümer Anwendung finden.
2. Anwendung auf den Eigentumserwerb
Aufgrund des sachenrechtlichen Aspekts der Übereignungskollision müsste das Näheprinzip umgedeutet werden. Der Warenlieferant würde bei der Übereignung den Vorrang erhalten. Die neue Sache verkörpert die von dem Vorbehaltslieferanten gelieferte Ware - sie existiert eben in verarbeiteter Form weiter. Deshalb könnte angenommen werden, der Vorbehaltslieferant stehe der neuen Sache näher als das Kreditinstitut.
3. Nähe des Vorbehaltslieferanten und des Kreditinstitutes
Die grundsätzliche Aussage, dass der Vorbehaltslieferant der neuen Sache näher stehe, kann jedoch so nicht gehalten werden. Richtig ist, dass die Sachsubstanz der neuen Sache die Nähe zum Vorbehaltslieferanten begrün- det. Der Wertzuwachs, der durch die Verarbeitung entsteht, kann jedoch nur durch Produktionsanlagen, Mitarbeiter, etc. erwirtschaftet werden. Anlagen und auch laufende Kosten werden jedoch gerade auch durch die Geldkredit- geber finanziert. Dadurch kann auch dem Kreditinstitut Nähe zur neuen Sa- che bescheinigt werden.
4. Anteilige Nähe
Es wäre daher sachgerecht, dem Vorbehaltslieferanten und dem Kreditinstitut „anteilsmäßige Nähe“ zu bezeugen. Der Vorbehaltslieferant ist in dem Umfang näher an der Sache, in der seine Lieferung wertmäßig in der neuen Sache vorhanden ist. Das Kreditinstitut ist auf den Wert bezogen der neuen Sache insoweit näher, der die Verarbeitung umfasst. So ist bruchteilsmäßig zu bestimmen, wie die Nähe „aufgeteilt“ wird.
Wenn der Wert einer neuen Sache 100,-- DM beträgt und die Materialkosten, die der Vorbehaltslieferant geliefert hat, 20,00 DM, so ist das „Näheverhältnis“ vier zu eins.
Dieses Verhältnis könnte bei der Bestimmung von Bruchteilen beim Miteigentum gem. § 1008 Anwendung finden.
5. Antizipierte Sicherungsübereignung
Der Vorbehaltskäufer würde aber erst aufgrund des zwingenden Charakters des § 950 Eigentümer, wobei grundsätzlich die Gefahren des Durchgangseigentums auftreten. Im Verhältnis zwischen Waren- und Geldkreditgeber würde der Vorbehaltskäufer das Miteigentum anteilsmäßig antizipiert an den Waren- und den Geldkreditgeber übertragen.
6. Rechtsfolge
Die Rechtsfolge dieses Konstruktion ist eine Verhinderung einer Kollision und ein sachgerechtes „Miteinander“ der Sicherungsgeber. Das sachgerechte „Miteinander“ besteht darin, dass Kreditinstitut und Vorbehaltslieferant im Verhältnis ihres Risikos gesichert sind.
Dieser Lösungsweg erscheint durch die anteilsmäßige Sicherung der Kre- ditgeber ergebnisorientiert konstruiert. Dieses ist in Teilen sogar beabsic h- tigt. Gerade im Hinblick auf den Eigentumsverschaffungswillen ist es schwierig, festzustellen, an wen der Vorbehaltskäufer die neue Sache über- eigen wollte.
Hier stellt dieser Lösungsansatz auf einen mutmaßlichen, zu unterstellenden Willen des Vorbehaltskäufers ab. Im Gegensatz zum BGH sollte aber nicht unterstellt werden, dass die letzte antizipierte Übereignung den Eigentumsverschaffungswillen begründet, sondern der Wille des Vorbehaltskäufers, seine Kreditgeber auch nur zu dem Teil zu sichern, den sie auch als Warenoder Geldkredit zur Verfügung gestellt haben.
7. Ausblick
Trotz der hier vertretenen Auffassung lässt sich jedoch für die Rechtsanwendung feststellen, dass die Verarbeitungsklauseln in Form der Vereinbarung der Herstellereigenschaft aufgrund der Rechtsprechung des BGH in der Praxis zur Zeit die entscheidende Bedeutung haben. Demnach wird in der Praxis der Konflikt im Interesse des Warenkreditgebers gelöst.
Göttingen, 31.Mai 2001
[...]
1Folgende Paragraphen ohne Angabe sind solche des BGB.
2 Wolf, SR, Rn. 446; Lwowski, Kreditsicherung, Rn. 596.
3 Brox, BS, Rn. 113; Lwowski, Kreditsicherung, Rn. 968.
4Mustervertrag in: Lwowski, Kreditsicherung, S. 796.
5 Jeng, Der Konflikt zwischen Waren- und Geldkreditgebern, S. 46.
6Wadle, JuS 1982, 477.
7Baur, SR, S. 626; Flume, NJW 1950, 841 (844); Soergel-Mühl, § 950, Rn. 3.
8Flume, NJW 1950, 841 (843).
9Büllow, Kreditsicherheiten, Rn. 1288
10 Baur, SR, S. 626; Büllow, Kreditsicherheiten, Rn. 1287.
11Flume, NJW 1950, 841 (844).
12Flume, NJW 1950, 841 (844).
13Flume, NJW 1950, 841 (844).
14BGHZ 20, 159; Serick, EV u. SÜ2, S. 108 S. 108; Lwowski, Kreditsicherung, Rn. 968.
15Serick, EV u. SÜ2, S. 108.
16 BGHZ 20, 159 (163).
17 BGHZ 20, 159 (164); ähnlich: Serick, EV u. SÜ (4), S. 157.
18Flume, NJW 50, 841, 844.
19Nierwetberg, NJW 83, 2235.
20BGHZ 46, 117.
21Lwowski, Kreditsicherung, Rn. 596.
22Lwowski, Kreditsicherung, Rn. 596.
23Hess, § 47 InsO, Rn. 70.
24BGHZ 46, 117 (120).
25 Landgericht Bonn, Zip 1993, 692.
26Hess, § 47 InsO, Rn. 71.
27Hess, § 47 InsO, Rn. 71.
28Nachweise - siehe folgende Fußnoten.
29Schwab, SR, Rn. 462; Palandt-Bassenge, § 950, Rn. 1, 2; Erman-Hefermehl, § 950,
Rn. 5; Westermann, Sachenrecht, S. 442; Pottschmidt, Kreditsicherungsrecht, Rn. 428.
30Westermann, Sachenrecht, S. 442.
31Medicus, BR, Rn. 519.
32Erman - Hefermehl, § 950, Rn. 1.
33 Wolf, SR, Rn. 447; ähnlich: Pottschmidt, Kreditsicherungsrecht, Rn. 428.
34Pottschmidt, Kreditsicherungsrecht, Rn. 428.
35Medicus, BR, Rn. 519; Staudinger-Wiegand, § 950, Rn. 34; Wolf, SR, Rn. 447; Palandt- Bassenge, § 950, Rn. 8; Erman-Hefermehl, § 950, Rn. 7; Jauernig-Jauernig, § 950, Rn. 8.
36MüKo-Quack, § 950, Rn. 24.
37 Staudinger-Wiegand, § 950, Rn. 34; Erman-Hefermehl, § 950, Rn. 7; Jauernig-Jauernig, 950, Rn. 8.
38Erman-Hefermehl, § 950, Rn. 7.
39Palandt-Bassenge, § 950, Rn. 13.
40 Westermann, Sachenrecht, S. 442; MüKo-Quack, § 950, Rn. 31.
41MüKo-Quack, § 950, Rn. 31.
42Palandt-Bassenge, § 950, Rn. 13.
43 Pottschmidt, Kreditsicherungsrecht, Rn. 429.
44Palandt-Bassenge, § 930, Rn. 2; Reinicke, Kreditsicherung, Rn. 460.
45Smidt, § 51 InsO, Rn. 5; Büllow, Kreditsicherheiten, Rn. 1105; Pottschmidt, Kreditsicherungsrecht, Rn. 519.
46Erman - Hefermehl, § 950, Rn. 7; Palandt-Bassenge, § 930, Rn. 7.
47Reinicke, Kreditsicherung, Rn. 467; Palandt-Bassenge, § 930, Rn. 11.
48 Palandt-Bassenge, § 930, Rn. 11.
49Hess, § 47 InsO, Rn. 199.
50Büllow, Kreditsicherheiten, Rn. 1108; Palandt-Bassenge, § 930, Rn. 10; Pottschmidt, Kreditsicherung, Rn. 520; Hess, § 47 InsO, Rn. 200.
51Büllow, Kreditsicherheiten, Rn. 1109; Hess, § 47 InsO, Rn. 195; Palandt-Bassenge,
§ 930, Rn. 4; Reinicke, Kreditsicherung, Rn. 460; Pottschmidt, Kreditsicherung, Rn. 525.
52Reinicke, Kreditsicherung, Rn. 462; Palandt-Bassenge, § 930, Rn. 3; Hess, § 47 InsO, Rn. 202; Pottschmidt, Kreditsicherung, Rn. 532.
53Büllow, Kreditsicherheiten, Rn. 1111; Palandt-Bassenge, § 930, Rn. 4.
54 Reinicke, Kreditsicherung, Rn. 460; Pottschmidt, Kreditsicherung, Rn. 528.
55 Eickmann, § 51 InsO, Rn. 3; Smid, § 51 InsO, Rn. 15.
56 Jauernig - Jauernig, § 932, Rn. 4
57Jeng, Der Konflikt zwischen Waren- und Geldkreditgebern, S. 57.
58Flume, NJW 1950, 841 (844).
59 Flume, NJW 1950, 841 (844).
60 Flume, NJW 1950, 841 (844)
61Lwowski, Kreditsicherung, S. 795, 796 (Mustervertrag).
62 Lwowski, Kreditsicherung, S. 796 (Mustervertrag).
63siehe auch die Vereinbarung im Mustervertrag in: Lwowski, Kreditsicherheiten, S. 795.
64 Nierwetberg, NJW 1983, 2235.
65 BGHZ 46, 117, 119.
66siehe Mustervertrag: Lwowski, Kreditsicherung, S. 795.
67 BGHZ46, 117.
68Wolf, Sachenrecht, Rn. 530.
69Büllow, Kreditsicherheiten, Rn. 1120.
70Jeng, Der Konflikt zwischen Geld und Warenkreditgeber, S. 66.
71Hess, § 47 InsO, Rn. 178; Palandt-Bassenge, § 930, Rn. 11.
72 BGH WM 1960, 1223 (1225).
73Hofman, NJW 1962, 1802.
74 Rimmelspacher, Kreditsicherungsrecht, Rn. 196.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Gliederung?
Die Gliederung befasst sich mit der Kollision von zwei typischen Sicherungsmitteln im Kreditgeschäft: dem verlängerten Eigentumsvorbehalt durch Verarbeitungsklausel und dem Sicherungseigentum. Untersucht wird der Konflikt dieser Sicherungsmittel zwischen Warenkreditgebern und Geldkreditgebern (Kreditinstituten) im Falle der Verwertung.
Was sind die Ausgangspunkte der Untersuchung?
Die Untersuchung beginnt mit der Vorstellung einer typischen Fallkonstellation, in der ein Warenkreditgeber Rohstoffe unter Eigentumsvorbehalt liefert, während ein Geldkreditgeber dem Produzenten Kredite gewährt, die durch Sicherungsübereignung von Rohstoffen und Erzeugnissen abgesichert sind.
Was ist eine Verarbeitungsklausel und warum wird sie verwendet?
Eine Verarbeitungsklausel wird vereinbart, um zu verhindern, dass der Vorbehaltskäufer (Produzent) durch die Verarbeitung der Rohstoffe Eigentum an der neuen Sache erwirbt (§ 950 BGB), wodurch der Warenkreditgeber (Lieferant) sein Eigentum verlieren würde.
Wie kommt eine Sicherungsübereignung zustande?
Eine Sicherungsübereignung kommt in der Regel dadurch zustande, dass sich Kreditinstitut und Kreditnehmer über den Eigentumsübergang einigen (§ 929 S. 1 BGB). Die Übergabe wird durch ein Besitzkonstitut ersetzt (§ 930 BGB), damit der Kreditnehmer im Besitz der Sache bleibt und das Kreditinstitut mittelbarer Besitzer wird.
Wann kommt es zum Konflikt zwischen Waren- und Geldkreditgeber?
Der Konflikt entsteht, wenn der Produzent die vom Verarbeitungsvorbehalt erfassten Produkte dem Kreditinstitut sicherungsweise übereignet und im Sicherungsfall sowohl der Vorbehaltslieferant als auch das Kreditinstitut die Produkte beanspruchen.
Ist eine Verarbeitungsklausel zulässig?
Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob eine Verarbeitungsklausel zulässig ist. Eine Ansicht sieht § 950 BGB als dispositives Recht, das durch Parteivereinbarung ausgeschlossen werden kann. Andere sehen § 950 als zwingendes Recht, das einen originären Eigentumserwerb zur Folge hat. Der BGH spricht § 950 zwar grundsätzlich zwingenden Charakter zu, gesteht aber der Verarbeitungsklausel Bedeutung bei der Ermittlung der Herstellereigenschaft zu.
Was bedeutet die "Herstellereigenschaft" in diesem Zusammenhang?
Die Herstellereigenschaft bestimmt, wer im Sinne des § 950 BGB als Hersteller der neuen Sache gilt. Nach der Rechtsprechung des BGH wird bei der Ermittlung der Herstellereigenschaft grundsätzlich eine objektive Sichtweise eingenommen, wobei es oft auf die Vereinbarung der Parteien ankommt (Verarbeitungsklausel).
Was ist ein Anwartschaftsrecht?
Ein Anwartschaftsrecht entsteht für den Vorbehaltskäufer, der noch nicht Eigentümer ist, aber eine gesicherte Rechtsposition auf den Eigentumserwerb hat, wenn die aufschiebende Bedingung (vollständige Kaufpreiszahlung) eintritt.
Was ist bei der Sicherungsübereignung zu beachten?
Bei der Sicherungsübereignung ist der Bestimmtheitsgrundsatz zu beachten, der verlangt, dass anhand äußerer Kriterien erkennbar ist, welche Sachen von der Sicherungsübereignung erfasst werden. Bei einem Warenlager mit wechselndem Bestand ist eine Ausführungshandlung (z.B. Raumsicherungsvertrag, Markierungsvertrag) notwendig, um die Bestimmtheit zu gewährleisten.
Wie wirkt sich die Insolvenz des Kreditnehmers aus?
In der Insolvenz des Kreditnehmers haben sowohl das Kreditinstitut als auch der Vorbehaltslieferant (aufgrund seines verlängerten Eigentumsvorbehalts) ein Absonderungsrecht (§ 51 Nr. 1 InsO) an den sicherungsübereigneten Gegenständen.
Was passiert, wenn § 950 BGB für abdingbar gehalten wird?
Wenn § 950 BGB für abdingbar gehalten wird, erwirbt der Vorbehaltslieferant direkt Eigentum an der neuen Sache, während der Vorbehaltskäufer ein Anwartschaftsrecht erhält. Eine Sicherungsübereignung an das Kreditinstitut würde scheitern, es sei denn, es erfolgt ein gutgläubiger Erwerb oder eine Übertragung des Anwartschaftsrechts.
Was passiert, wenn eine uneingeschränkte Verarbeitungsklausel vereinbart wurde?
Bei einer uneingeschränkten Verarbeitungsklausel erwirbt der Vorbehaltslieferant aufgrund seiner Herstellereigenschaft direkt Eigentum an der neuen Sache. Eine Sicherungsübereignung an das Kreditinstitut ist nicht möglich, da der Vorbehaltskäufer zu keinem Zeitpunkt Eigentümer geworden ist.
Was passiert, wenn eine eingeschränkte Verarbeitungsklausel vereinbart wurde?
Bei einer eingeschränkten Verarbeitungsklausel werden Vorbehaltslieferant und Vorbehaltskäufer im Verhältnis von Stoffwert und Verarbeitungswert Miteigentümer. Das Kreditinstitut kann mittels einer antizipierten Sicherungsübereignung den Miteigentumsanteil des Vorbehaltskäufers erhalten.
Wie löst man die Kollision, wenn die Verarbeitungsklausel nichtig ist?
Bei Nichtigkeit der Verarbeitungsklausel aufgrund zwingenden Rechts wird eine Verarbeitungsklausel in eine antizipierte Sicherungsübereignung umgedeutet. Liegen zwei antizipierte Sicherungsübereignungen vor, könnte der Prioritätsgrundsatz Anwendung finden. Eine andere Lösung besteht darin, auf den Besitzmittlungswillen des Veräußerers abzustellen.
Welchen Lösungsansatz schlägt die Arbeit vor?
Die Arbeit schlägt einen eigenen Lösungsansatz vor, der auf einer sinngemäßen Anwendung des "Näheprinzips" basiert. Demnach sollte dem Vorbehaltslieferanten und dem Kreditinstitut "anteilsmäßige Nähe" zu der neuen Sache zugesprochen werden. Die Bruchteile beim Miteigentum (§ 1008 BGB) könnten im Verhältnis des Materialwertes und des Verarbeitungswertes bestimmt werden.
- Citar trabajo
- Koray Böhlke (Autor), 2001, Die Kollision zwischen Sicherungseigentum und Vorbehaltseigentum (Verarbeitungsklausel), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104019