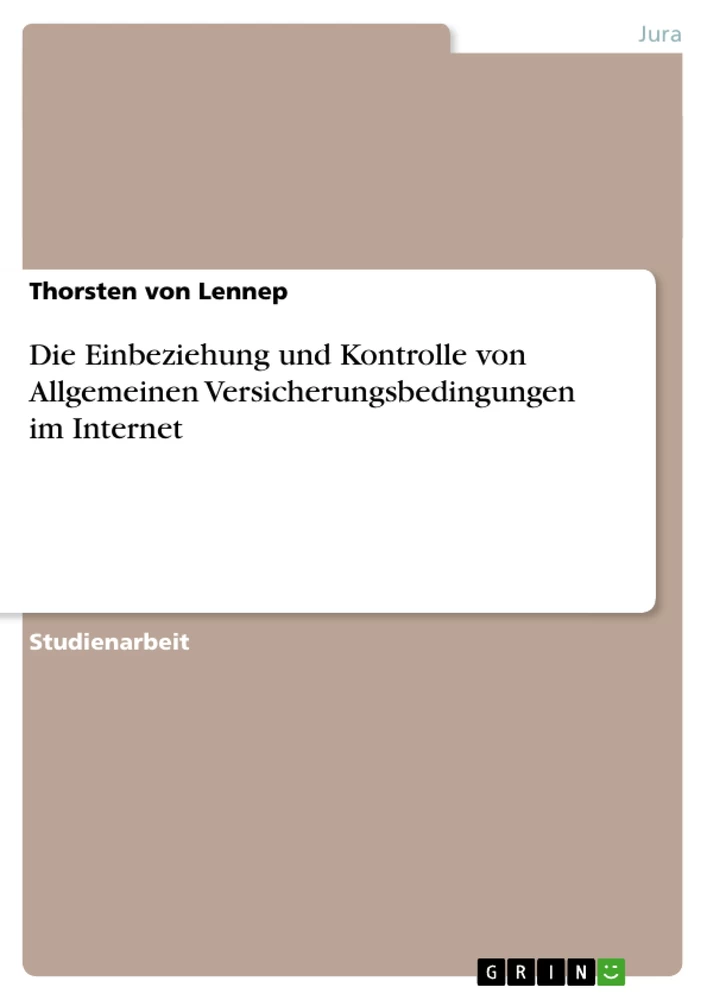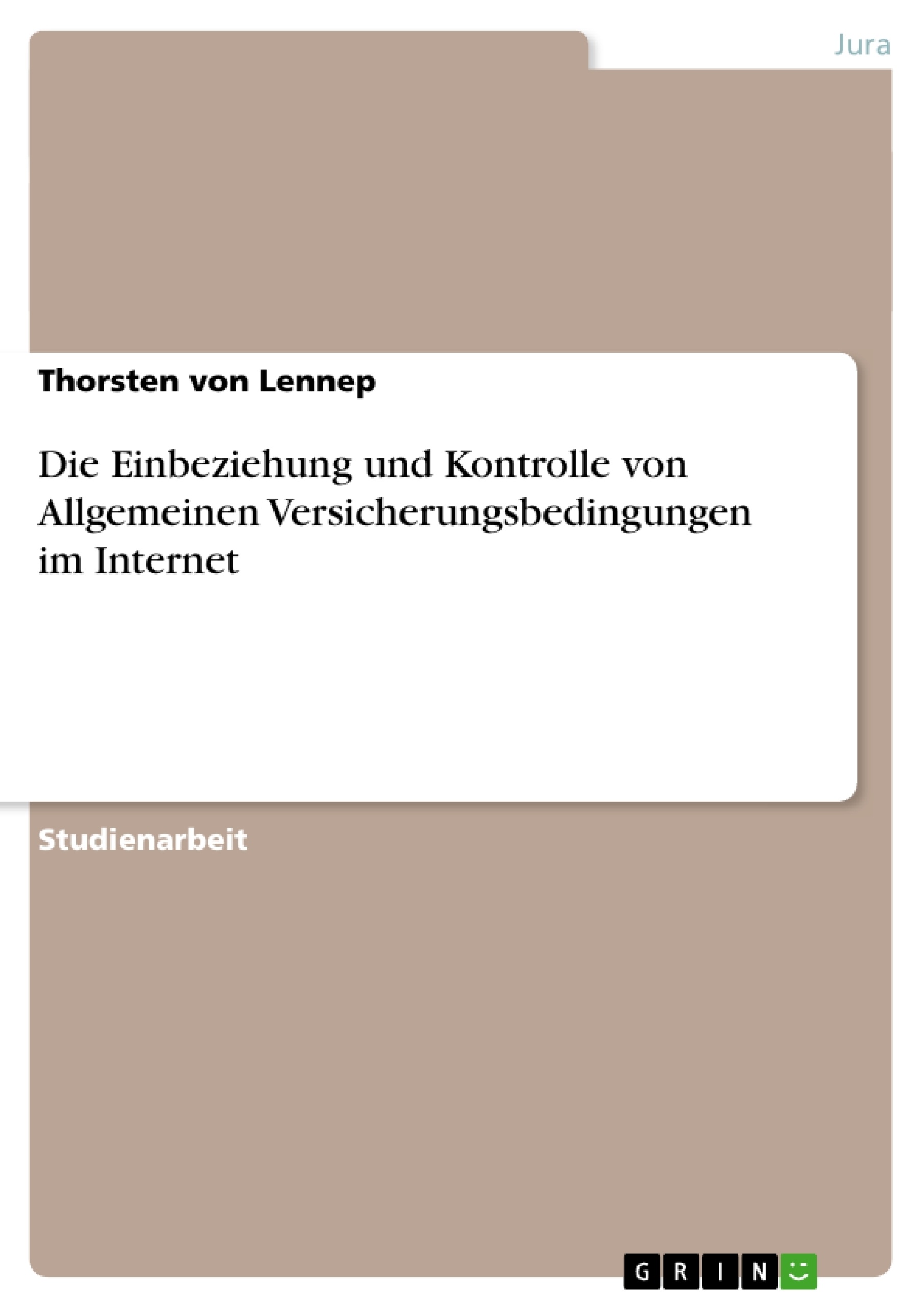Gliederung:
Einleitung
Teil 1 : Einbeziehung von AGB /AVB bzw. Folgen der Nichteinbeziehung
A. Beim Vertragsschlußunter Anwesenden
I. Anwendbarkeit des AGBG
II. Vorliegen von AGB gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 AGBG
III. Sind AGB Vertragsbestandteil geworden?
1. Wirksame Einbeziehung gemäß § 2 AGBG
a. Ausdrücklicher Hinweis
b. Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme
c. Einverständnis des Kunden
d. Überraschende Klauseln
2. Ergebnis
IV. Nichtanwendbarkeit gemäß § 4 AGBG
V. Auslegung der AGB gemäß § 5 AGBG
VI. Nachträgliche Änderung bestehender AGB / AVB
VII. Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit
gemäß § 6 AGBG bzw. § 5a VVG
B. Besonderheiten beim Vertrag im Internet / Welches Recht gilt?
I. Anwendbarkeit des AGBG
1. Deutschlandweit
2. Im internationalen Geschäftsverkehr / EGBGB / AGBG
II. AGB Vertragsbestandteil?
1. Hinweis in geeigneter Form, § 2 I Nr. 1 AGBG
a. Webseite als Angebot oder invitatio ad offerendum?
aa. Stand der Diskussion
bb. Stellungnahme
b. Problem für die Einbeziehung / Konsequenzen für das Internet
c. Lösungsmöglichkeiten
aa. Auslegung über §§ 133, 157 BGB / Vorrang des § 2 AGBG
bb. Vergleich zu schriftlichen Vertragsschlüssen
cc. Auffassung Koehlers in Bezug auf Internetverträge
dd. Stellungnahme
2. Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme, § 2 I Nr. 2 AGBG
a. Stand der Diskussion
b. Stellungnahme
c. Verständlich / Lesbar (Problem der Sprache)
3. Einverständnis des Kunden
C. Besonderheiten beim Versicherungsvertrag
I. Wegfall der aufsichtbehördlichen Genehmigung
II. Wirksame Einbeziehung gemäß § 2 AGBG / Problem der körperlichen Aushändigung i.V.m. dem Versicherungsrecht (§§ 10a VAG / 5a VVG)
1. Antragsmodell
2. Policenmodell
3. Folgen für die Einbeziehung von AVB im Internet
III. Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG
IV. Nachträgliche Änderung der AGB / AVB
D. Ergebnisse bei der Einbeziehung von AGB / AVB
Teil 2: Kontrolle von AGB / AVB
A. Beim Vertragsschluß unter Anwesenden
I. Inhaltskontrolle von AGB / AVB, §§ 8ff. AGBG
1. Sinn und Zweck der Inhaltskontrolle
2. Schranken der Inhaltskontrolle, § 8 AGBG
3. Klauselverbote, §§ 10, 11 AGBG
4. Generalklausel, § 9 AGBG
a. Unwirksamkeit, § 9 II Nr. 1 und 2 AGBG
b. Unwirksamkeit, § 9 I AGBG
5. Rechtsfolgen der Unwirksamkeit, § 6 AGBG
II. Wer kontrolliert AGB?
B. Besonderheiten beim Vertrag im Internet
I. Inhaltskontrolle von AVB / AGB
II. Wer kontrolliert AGB / AVB im Internet
III. Erweiterte Inhaltskontrolle gemäß § 24a AGBG
IV. Nachträgliche Veränderung durch den Verwender
C. Besonderheiten beim Versicherungsvertrag im Internet
D. Ergebnisse bei der Kontrolle von ABG /AVB
Teil 3: Schlußbetrachtung / These
A. Schlußbetrachtung / Aktuelle Beispiele
B. These zumThema
Literaturverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
Das Thema, „Einbeziehung und Kontrolle von AGB bei Internet-Verträgen“, wirft eine Reihe von Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die spezielle Form des Vertrages, dem Versicherungsvertrag, die im folgenden näher betrachtet und erläutert werden sollen. Ist es überhaupt möglich, AGB bzw. AVB bei Internet-Verträgen einzubeziehen, wiederrum im Hinblick auf den Versicherungsvertrag, der nach der Auffassung des BAV eine besondere Art darstellt, in der der Verbraucher besonderen Schutz genießen muß? Können eventuell einbezogene AGB / AVB kontrolliert werden? Genießt der Kunde den gleichen Schutz wie bei einem gewöhnlichen Vertragsabschluß? Das Thema wird in folgende Themenkomplexe gegliedert: Es wird geprüft, ob AGB / AVB in einen Internetvertrag einbezogen werden können. Ist es vielleicht sogar möglich, diese nachträglich einzufügen oder abzuändern? Es wird ferner unterschieden zw ischen dem gewöhnlichen Vertragabschluß im Geschäft oder Versicherungsbüro und dem Internetvertrag, um die Besonderheiten des Internets herausstellen zu können. Beim Internetvertrag wird wieder unterteilt in die Betrachtung von Verträgen im allgemeinen und dem Versicherungsvertrag im besonderen. Sollte eine Einbeziehung möglich sein, stellt sich die Frage, ob Klauseln dann auch kontrolliert werden können und wem im
Einzelfall die Kontrolle obliegt. Auch hier wird wieder eine Unterscheidung vorgenommen zwischen dem gewöhnlichen Vertragsabschluß und dem Internet-Vertrag. Die Arbeit wird beendet mit einer eigenen Schlußbetrachtung sowie einer allgemeinen These zum Thema.
Teil 1: Einbeziehung von AGB / AVB bzw. Folgen der Nichteinbeziehung
Bei der Einbeziehung von AGB / AVB sollten drei verschiedene Fallgestaltungen unterschieden werden: 1. Der Vertragsschluß unter Anwesenden, um näher erläutern zu können, welche Voraussetzungen für eine wirksame Einbeziehung generell erforderlich sind, 2. die Besonderheiten beim Internetvertrag und 3. beim Versicherungsvertrag.
A. Beim Vertragsschluß unter Anwesenden
Der Vertragsschluß unter Anwesenden, bei dem regelmäßig AGB bzw. AVB einbezogen werden, ist dadurch gekennzeichnet, daß der Kunde die AGB im Geschäft des Unternehmers einsehen kann, diese auf der Rückseite des Vertrages aufgeführt sind oder ausgehändigt bekommt.
I. Anwendbarkeit des AGBG
Das AGBG muß gemäß §§ 23, 24, 24a AGBG anwendbar sein.
- 23 AGBG beschreibt den sachlichen Anwendungsbereich als Negativ-Katalog. Es wird aufgeführt, wo das AGBG keine Anwendung findet (§ 23 I AGBG), bzw. welche Klauseln bei einzelnen Verträgen nicht zur Anwendung kommen (§ 23 II AGBG). Hier ist nur § 11 Nr. 12 AGBG (Laufzeit von Dauerschuldverhältnissen) für den Versicherungsvertrag ausgeklammert. Somit findet das AGBG bei gewöhnlichen Verträgen (auch Versicherungsverträgen) Anwendung. § 23 III AGBG finde beim Versicherungsvertrag keine Anwendung mehr, da AVB nicht mehr genehmigt werden müssen.1Somit müssen die Voraussetzungen von § 2 AGBG erfüllt sein. Die Ausnahme stelle hier § 5a VVG dar, wonach Versicherungsbedingungen auch dann, unabhängig von den Voraussetzungen des § 2 AGBG, Vertragsbestandteil werden, wenn sie dem VN mit der Police zugeschickt werden und dieser nicht innerhalb von 14 Tagen widerspreche.2
- 24 AGBG beschreibt den persönlichen Anwendungsbereich des AGBG. Hiernach finden einzelne Klauseln keine Anwendung, wenn die AGB gegenüber einem Kaufmann, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. Da es sich i.d.R. bei den zu untersuchenden Verträgen um einen Verbraucher oder einen VN (Privatperson) handelt, findet das AGBG Anwendung.
II. Vorliegen von AGB gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 AGBG
Zunächst müssen AGB i.S.d. AGBG vorliegen. Gemäß § Abs. 1 S. 1 AGBG sind AGB alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluß des Vertrages stellt, es sei denn, sie sind im einzelnen ausgehandelt worden (§ 1 Abs. 2 AGBG). Das Merkmal „für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert“ sei bei Verbraucherverträgen keine zwingende Voraussetzung mehr für die Annahme von AGB.3Verbraucherverträge sind gemäß § 24a AGBG Verträge, die ein Unternehmer mit einer natürlichen Person schließt, vorausgesetzt, dieser Vertragsschluß ist weder der gewerblichen noch einer selbständigen beruflichen Tätigkeit der natürlichen Person zuzurechnen (Verbraucher). Unter diesen Voraussetzungen finden die Kernvorschriften des Gesetzes, §§ 5,6, 8 bis 12 AGBG Anwendung, auch wenn die Bedingungen nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind (§ 24a Nr. 2 AGBG). Somit liegen regelmäßig in Fällen des Vertragabschlusses im Geschäft AGB vor, das AGBG findet Anwendung. Die Besonderheit, daß Verträge zwischen Kaufleuten geschlossen werden, soll an dieser Stelle nicht näher erläutert werden. Hier gelten besondere Bestimmungen, das AGBG findet nur eingeschränkt Anwendung.
AVB seien dadurch charakterisiert, daß sie vom VU als Verwender dem VN gestellt, d.h. nicht frei ausgehandelt, sondern dem VN vielmehr einseitig auferlegt werden.4AVB erfüllen die begrifflichen Voraussetzungen des § 1 AGBG5und bilden somit AGB der VU. Bis zum 29.07.1994 unterlagen die AVB der Versicherer der aufsichtsbehördlichen Genehmigung durch das BAV. Bis dahin wurden diese genehmigten AVB auch Vertragbestandteil, auch wenn
- 2 AGBG nicht erfüllt war. Neue AVB, die ein Versicherer erstmals ab dem 01.07.1994 verwende, seien grds. nicht mehr genehmigungspflichtig.6§ 23 III AGBG gelte für diese Bedingungen nicht mehr, somit seien die Voraussetzungen des § 2 AGBG stets einzuhalten.7
III. Sind AGB Vertragsbestandteil geworden?
Die AGB müssen Vertragsbestandteil werden.
1. Wirksame Einbeziehung gemäß § 2 AGBG
Die AGB müssen gemäß § 2 AGBG wirksam einbezogen werden und dürfen außerdem nicht als überraschend gemäß § 3 AGBG angesehen werden.
a. Ausdrücklicher Hinweis, § 2 I Nr. 1 AGBG
Gemäß § 2 I Nr. 1 AGBG ist ein ausdrücklicher Hinweis erforderlich. Ein ausdrücklicher Hinweis liege nur dann vor, wenn er vom Verwender bei Vertragsschluß unmißverständlich und für den Kunden klar erkennbar geäußert worden sei.8Ein fremdsprachlicher Hinweis reiche grundsätzlich nur dann aus, wenn er in der Verhandlungssprache erfolge.9Der Hinweis sei in den Vertragverhandlungen mit dem jeweiligen Kunden zu äußern,10wobei dieser sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen könne, je nach Vertragstyp.11Bei schriftlichen Angeboten des Verwenders werde grundsätzlich auch ein schriftlicher Hinweis auf die AGB im Angebotstext verlangt, soweit diese nicht - wie bei Formularverträgen - integraler Bestandteil des vorformulierten Angebots seien.12 Die bloße Wiedergabe auf der Rückseite des Angebotsschreibens reiche nicht aus, vielmehr müsse der ausdrückliche Hinweis im Angebotstext vorhanden sein.13Auch die Berufung auf einem Sonderblatt ohne Hinweis im Angebot reiche nicht aus14. Am Textende versteckt angebrachte15oder auf der Rückseite des Vertragstexts abgedruckte16oder sonst schwer lesbare Hinweiserklärungen seien regelmäßig nicht geeignet, das Merkmal des ausdrücklichen Hinweises zu erfüllen.17Geht das Angebot vom Kunden aus, so könne er auf einer Seite ein vom Verwender stammendes Formular oder Bestellschein verwenden, auf denen sich ein solcher Hinweis befinde.18Gleiches gelte, wenn der Kunde sich in seinem Angebot auf die AGB beziehe.19Auf der anderen Seite erfordere es jedoch ein neues Angebot von Seiten des Verwenders gemäß § 150 II BGB, wenn der Kunde die AGB in seinem Angebot, z.B. nach einer invitatio ad offerendum auf einem selbst entworfenen Papier, nicht ausdrücklich erwähne.20Bei fernmündlichen Vertragsschlüssen hat der Verwender während des Gesprächs ausdrücklich auf seine AGB hinzuweisen.21Bei Geschäften mit Ausländern habe der Verwender auf seine AGBG lediglich in der Verhandlungs- bzw. Vertragssprache hinzuweisen.22In Ausnahmefällen (häufige Geschäfte des täglichen Lebens) läßt der Gesetzgeber es ausreichen, wenn am Ort des Vertragsschlusses AGB deutlich sichtbar aushängen. Hierbei sei die besondere Form des Aushangs zu beachten sowie eine einfache Erreichbarkeit des Aushangs müssen gewährleistet werden.23
Bei Versicherungsverträgen ist ein mündlicher Vertrag sehr selten, fast undenkbar. Bei schriftlichen Verträgen habe es sein Bewenden mit den sich aus dem AGB-Gesetz ergebenden allgemeinen Anforderungen.24. Ein Aushang am Ort des Vertragabschlusses reiche beim Versicherungsvertrag, ausgenommen bei der Garderobenversicherung, wegen der Komplexität der Verträge nicht aus.25Dieser Ansicht ist zuzustimmen. Viele Versicherungsunternehmen bieten eine Vielzahl von Versicherungen an mit einer Vielzahl von verschiedenen Bedingungen. Diese alle am Ort des Abschlusses auszuhängen, ist schier unmöglich.
b. Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme, § 2 I Nr. 2 AGBG
Gemäß § 2 I Nr. 2 AGBG muß der Vertragspartner die Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme erhalten. Die Kenntnisverschaffung müsse bei Vertragsschluß bestehen, eine nachträgliche Aushändigung reiche nicht aus.26In der Regel erfolgt dies bei schriftlichen Verträgen durch die Aushändigung vor Vertragsschluß. Bei mündlichen Verträgen könnte man sich die unpraktikable Lösung des Vorlesens vorstellen. Die h.M.27löse dieses Problem, indem der Kunde bei telefonischem Hinweis auf die AGB diese verlangen müsse. Unterlasse er dies, habe er sich konkludent mit der Einbeziehung einverstanden erklärt. Die Kenntnisverschaffung muß jedoch auch zumutbar sein. Dies bedeute, daß der normale Durchschnittskunde keine unverhältnismäßig große Mühe auferlegt werden dürfe, um die AGB zu erlangen.28Einfache Erreichbarkeit, mühelose Lesbarkeit, Mindestmaß an Übersichtlichkeit und Verständlichkeit und ein vertretbarer Umfang zum Geschäft seien dabei zu beachten.29
Beim Versicherungsvertrag impliziere die zumutbare Kenntnisnahme, daß die AVB für den Versicherungsnehmer sowohl vor wie auch nach Vertragsschluß vorhanden sein müßten, demnach also ein Aushändigung unausweichlich sei (§ 10a VAG).30
c. Einverständnis des Kunden
Desweiteren muß sich die Vertragspartei mit den ABG einverstanden erklärt haben. Dies geschieht bei allen angesprochenen Verträgen durch Unterschrift auf dem Antrag. Aber auch konkludentes Verhalten kann im Einzelfall zu einer Einbeziehung führen (vgl. unten S. 7).
d. Überraschende Klauseln
Die AGB dürfen keine überraschenden Klauseln gemäß § 3 AGBG beinhalten. Überraschende Klauseln, mit denen der Vertragspartner unter keinen Umständen rechnen konnte, weil diese so ungewöhnlich sind, werden nicht Vertragsbestandteil.
2. Ergebnis
Für den Fall, daß § 2 AGBG erfüllt ist und die AGB keine überraschenden Klauseln i.S.d. § 3 AGBG enthalten, sind die AGB Vertragsbestandteil geworden.
IV. Nichtanwendbarkeit gemäß § 4 AGBG
AGB-Klauseln sind gemäß § 4 AGBG nicht anwendbar, wenn Individua labreden getroffen wurden. Ob die Abweichung zwischen AGB-Inhalt und Individualabrede schon bei Vertragsschluß vorhanden sei oder sich erst aufgrund späteren individueller Änderung oder Ergänzung ergebe, sei dabei ohne Belang.31Ob die Vereinbarung schriftlich oder mündlich getroffen worden sei, sei unerheblich. Die Individualvereinbarung könne auch stillschweigend oder schlüssig geschlossen werden.32Diese sind im Bereich der gewöhnlichen Verträge im Geschäft eher selten.
Bei Versicherungsunternehmen können Individualvereinbarunge n vorkommen, insbesondere bei Prämiensatzvereinbarungen33, Ausschlüssen bestimmter Ris iken34, Datum des Versicherungsbeginns35, Kaskoversicherung mit Abgabe der Doppelkarte, wenn dem VN nichts anderes erklärt wird36. Aber auch hier sind Individualabreden i.d.R. selten, denn der überwiegende Teil ist in den AVB ausdrücklich geregelt.
V. Auslegung der AGB gemäß § 5 AGBG
Die AGB müssen gemäß § 5 AGBG nach Inhalt und Umfang klar bestimmbar sein. Dies ist bei gewöhnlichen Verträgen sowie Versicherungsverträgen i.d.R. gegeben. Zweifel bei der Auslegung von AGBG / AVB gehen zu Lasten des Verwenders, d.h. § 5 finde nur Anwendung, wenn nach Ausschöpfung der in Betracht kommenden Auslegungsmethoden ein nicht behebbarer Zweifel bleibt, bloßer Streit über die Auslegung reiche nicht aus.37
VI. Nachträgliche Änderung bestehender AGB / AVB
Später geänderte Fassungen können i.d.R. nur mit neuer Genehmigung bzw. Einigung Vertragsbestandteil werden, eine bloße Zusendung der neuen Unterlagen reiche nicht aus.38Eine Klausel in den Bedingungen , die dies einräumen würde, wäre gemäß § 10 Nr. 4 AGBG unzulässig. Als ausnahmsweise zulässig werde es angesehen, wenn bei dauernden Geschäftsbeziehungen mit vielen neuen Diensten, z.B. bei Banken, eine Einbeziehungsvereinbarung getroffen wurde. Wenn der Kunde nach Erhalt der neuen AGB das Vertragsverhältnis weiterführe, habe er sie akzeptiert.39
Beim Versicherungsvertrag ist ebenfalls eine Änderung mit ausdrücklicher Zustimmung des VN erlaubt, jedoch soll hier das Schweigen nach Zusendung nicht ausreichen, es werde vielmehr eine ausführliche Aufklärung durch das VU gefordert.40 Es sei aber auch zulässig, eine Bedingungsanpassungsklausel mit dem VN zu vereinbaren; die Folgen der Änderungen müßten allerdings für den VN zumutbar, sowie konkret oder mit einem entsprechenden Ausgleich versehen sein.41
VII. Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit gemäß
- 6 AGBG bzw. § 5a VVG
Gemäß § 6 I AGBG bleibt der Vertrag auch dann wirksam, wenn AGB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden sind. Der Vertrag richtet sich dann gemäß § 6 II AGBG nach den gesetzlichen Vorschriften. Nur, wenn dies für einen der Vertragspartner eine unzumutbare Härte darstellt, ist der Vertrag gemäß § 6 III ABGB unwirksam.
Im Versicherungsrecht, ausgenommen sind Verträge mit Pensionskassen und Verträge mit genehmigten AVB (hier gilt § 6 AGBG weiter), wird die Vorschrift des AGBG durch die Besonderheiten des § 5a VVG überlagert. § 5 a VVG schafft somit eine „Reparaturmöglichkeit“ im Falle eines Unterlassens des Versicherers oder Vertreters bzgl. der Einbeziehung von AVB. Der VN hat gemäß § 5a II S. 5 VVG eine einjährige Widerspruchsfrist. Nach dem Ablauf soll es dem Versicherer möglich sein, eine Vertragsbeziehung auf Grundlage der AVB herbeizuführen.42
B. Besonderheiten beim Vertrag im Internet / Welches Recht gilt?
Die Problematik der Einbeziehung von AGB stellt sich insbesondere bei Internetverträgen. Hier ist es nicht so, daß AGB ausgehändigt werden oder daß der Kunde mit seiner Unterschrift bestätigen kann, daß er die AGB akzeptiert. Auch stellt die Anonymität im Internet ein großes Problem dar, insbesondere wenn der Kunde nicht weiß oder erkennt, daß er mit einem ausländischen Händler korrespondiert. Gilt in diesen Fällen überhaupt das AGBG und würde eine fremde Sprache an der Einbeziehung etwas ändern? Das Vorliegen von AGB sowie die Erfordernisse aus §§ 4, 5 und 6 AGBG sind i.d.R. unproblematisch gegeben, so daß im Folgenden nur auf die Besonderheiten hinzuweisen ist.
I. Anwendbarkeit des AGBG
Das AGBG müßte generell anwendbar sein, insbesondere bei Verträgen mit Auslandsbezug.
1. Deutschlandweit
Bei Verträgen, in denen sowohl der Verbraucher als auch der Anbieter (i.d.R. der Unternehmer) in Deutschland ansässig sind, bestimmt sich die Anwendbarkeit problemlos nach den §§ 23, 24, 24a ABGB. Dies wurde oben bereits näher ausgeführt (vgl. S. 2). Andere Regeln dürfen auch nicht für das Internet gelten.43
2. Im internationalen Geschäftsverkehr / EGBGB / AGBG
Erheblich Probleme bereitet die Anwendbarkeit des AGBG bei Internetverträge im internationalen Geschäftsverkehr, inbesondere wenn der Unternehmer im Ausland ansässig ist. Fraglich ist, ob hier das AGBG überhaupt zur Anwendung kommt, dem Verbraucher also ein Schutz zu Gute kommen kann. Art. 27 I Satz 1 EGBGB, in dem geregelt wird, daß ein Vertrag im Grundsatz dem von den Parteien gewählten Recht unterliegt und § 28 I Satz 1 EGBGB, nach dem ein Vertrag im Grundsatz dem Recht des Staates unterliegt, mit dem er die engste Verbindung aufweist (i.d.R. dort, wo die Partei, die „vertragstypische Leistung“ erbringe44), können hier außer Acht gelassen werden. Sollte sich nach diesen Bestimmungen ergeben, daß der Vertrag deutschem Recht unterliegt, stellt es kein Problem dar, ob das AGBG anwendbar ist. Problematisch wird es, wenn sich aus diesen Normen ergibt, daß der Vertrag ausländischem Recht unterliegt.
Dann stellt sich die Frage, ob das deutsche AGB-Gesetz dennoch zur Anwendung kommt. Es wird nach Art. 29, 29a EGBGB unterschieden, ob eine Rechtswahl von den Parteien getroffen wurde oder nicht. Ist dies nicht der Fall, so bestimmt sich die Anwendbarkeit problemlos nach Art. 29 II EGBGB, der Sitz des Verbrauchers ist ausschlaggebend. Ist eine Rechtswahl getroffen, die auch in den AGB vereinbart werden könne45, so bestimmt sich die Anwendung nach § 29a EGBGB, wonach das deutsche AGBG dann zur Anwendung kommt, wenn der Vertrag einen engen Bezug zum Verbraucherstaat aufweist und es sich nicht um ein Recht eines Mitgliedstaates der EU oder eines anderen Staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum handelt. Hier hat der Verbraucher ausreichend Rechsschutz zu erwarten, er benötigt keine zusätzliche Bevorzugung. Eine Berufung auf das deutsche AGBG gegen das richtlinienkonforme AGBG-Recht eines anderen Mitgliedstaates sei dann nicht mehr möglich.46Ein enger Bezug liege im Internet schon vor, wenn der ausländische Anbieter, der sich an Kunden wende, eine geschäftliche Tätigkeit entfalte, die einer öffentlichen Werbung gleichstehe.47
Somit führen beide Normen in den problematisten Fällen zu der Anwendung des AGBG, wenn der Verbraucher vom häuslichen (in Deutschland stehenden) Computer sein Angebot an den Anbieter abschickt.
II. AGB Vertragsbestandteil?
Die AGB müssen, genau wie bei Verträgen unter Anwesenden, zunächst Vertragsbestandteil gemäß § 2 AGBG werden. Im Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 AGBG muß der Verwender von AGB die andere Vertragspartei ausdrücklich auf seine AGB hinweisen oder, wenn dies nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, am Ort des Vertragabschlusses einen deutlich sichtbaren Aushang der AGB anbringen. Darüber hinaus muß die andere Vertragspartei die Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme erhalten haben.
1. Hinweis in geeigneter Form, § 2 Abs. 1 Nr. 1 AGBG
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. AGBG ist es für eine Einbeziehung zwingend erforderlich, daß der Verwender die andere Vertragspartei bei Abschluß des Vertrags ausdrücklich auf die AGB hinweist, oder - in Ausnahmefällen - auf AGB durch Aushang am Ort des Vertragsabschlusses ausdrücklich hinweist (vgl. S. 5). Letzteres ist bei Internetgeschäften nicht näher zu erläutern, da die h.M.48einen ausdrücklichen Hinweis auf die AGB im Internet für möglich hält und der „Ort des Vertragsabschlusses“ nicht genau bestimmbar ist. Ein ausdrücklicher Hinweis liege nur dann vor, wenn vom Verwender bei Vertragsabschluß unmißverständlich und klar erkennbar geäußert werde, daß seine AGB Vertragsbestandteil werden sollen.49Frühere Hinweise reichen ebensowenig aus wie allgemeine Hinweise, die keinen Bezug zum konkreten Vertragsschluß aufweisen.50Der Hinweis sei grafisch so anzubringen, daß er nicht übersehen werden könne, ein versteckter Hinweis am unteren Bildrand würde nicht ausreichen.51Es werde allerdings das Problem nicht näher erläutert, von wem nun das Angebot ausgeht, sondern mit dem allgemeinen Hinweis, daß ein ausdrücklicher Hinweis, z.B. mit Hilfe eines Links, möglich sei52, übergangen. Wird das Angebot vom Verwender unter Hinweis auf seine AGB abgegeben, so kann der Kunde dieses mit einem bloßen „Ja“ annehmen. Die AGB würden einbezogen werden. Geht allerdings das Angebot vom Kunden aus, so wird dieser auf die feindlichen AGB nicht explizit hinweisen. Bei letzterer Fallkonstellation ist dann fraglich und problematisch, wie ein ausdrücklicher Hinweis beschaffen sein müsse und wo er zu plazieren ist. Fraglich ist also zunächst, ob die Webseiten als Angebot oder invitatio ad offerendum anzusehen sind.
a. Webseite als Angebot oder invitatio ad offerendum?
Zunächst muß geklärt werden, ob es sich bei den Webseiten um verbindliche Angebote des Anbieters i.S.d. § 145 BGB oder um eine invitatio ad offerendum, also eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, handelt, d.h. das Angebot würde dann vom Kunden ausgehen. Dies ist von erheblicher Bedeutung für die Einbeziehung von AGB, denn das Angebot des Kunden beinha ltet nicht die AGB des Verwenders. Diese müssen dann vom Verwender ggf. bei der Annahme einbezogen werden.
aa. Stand der Diskussion
Nach einer Ansicht53handele es sich immer dann um ein Angebot des Anbieters, wenn dieser nicht ausdrücklich darauf hinweise, daß er sich rechtlich nicht binden möchte, was i.d.R. nicht geschehe. Begründet werde dies damit, daß nicht der innere Wille des Antragenden maßgeblich sei, sondern der objektive Erklärungswert seines Verhaltens. Es komme nach ständiger Rechtsprechung54nicht darauf an, ob der Anbieter sich rechtlich binden wolle, sondern vielmehr darauf, wie der Empfänger dies verstehen könne. Der juristisch nicht vorgebildete Nutzer werde aber nicht erkennen können, daß Ware zwar angeboten werde, es sich aber dennoch um kein Angebot handele, weil der Rechtsbindungswillen fehle. Nach dieser Ansicht können dann, wenn die Voraussetzungen des § 2 AGBG vorliegen, die AGB einbezogen werden, da sie im Angebot des Anbieters mit integriert werden. Nach anderer, überwiegender Meinung55handele es sich lediglich um eine invitatio ad offerendum. Es sei nicht erkennbar, daß der Anbieter sich bereits rechtlich binden wolle. Vergleichbar wäre das Angebot mit einem Katalog oder einer Preisliste, die ebenfalls nur als Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten angesehen werden.56Nach der Bestellung per Email oder mit auszufühlendem Bestellformular stehe es dem Anbieter frei, dies anzunehmen oder abzulehnen. Nach dieser Ansicht unterbreitet erst der Kunde das Angebot, in dem er nicht unbedingt die „feindlichen“ AGB einbeziehen möchte. Es bedarf nach dieser Ansicht einer genaueren Betrachtung, wie die AGB einbezogen werden können.
bb. Stellungnahme
Das Argument, daß es auf den Empfänger ankommt, überzeugt nicht. Es kann dem Verwender nicht zugemutet werden, mit jedem, der auf seine Webseite gelangt, Verträge abschließen zu müssen. Jedem soll das Recht gewahrt bleiben, sich seinen Vertragspartner auszusuchen, auch im Internet. Der Vertrag wird in aller Regel noch von weiteren Faktoren abhängen, z.B. von Lieferbarkeit der Waren oder Bonität des Kunden. Dem Anbieter einer Webseite muß die Möglichkeit bleiben, diese Dinge zu überprüfen, um sich dann erst zum Vertragsschluß zu entschließen. Er ist zu behandeln wie das Versenden eines Kataloges oder einer Preisliste, weil auch hier der Empfänger nicht unbedingt den fehlenden Rechtsbindungswillen des Verwenders erkennt. Es ist also somit der h.M. zu folgen, daß es sich bei einer Webseite lediglich um eine invitatio ad offerendum handelt.
b. Problem für die Einbeziehung / Konsequenzen für das Internet
Konsequenz ist nun, daß nicht der Verwender das Angebot mit seinen AGB stellt, sondern der Antrag (das Angebot) vom Kunden ausgeht. Der Vertrag komme dann durch die mittels Computererklärung erfolgte Annahme des Verkäufers zustande.57Hier ist nun fraglich, ob das Angebot des Kunden die AGB des Verwenders enthält, so daß dieser mit einem bloßen „Ja“ das Angebot mit seinen AGB annehmen könnte. Dies wird im Zweifel nicht anzunehmen sein. Andernfalls bliebe dem Verkäufer nur die Möglichkeit, das Angebot des Kunden unter der Erweiterung der Einbeziehung seiner AGB anzunehmen. Dies wäre dann gemäß § 150 Abs. 2 BGB eine erweitere Annahme, die eine Ablehnung verbunden mit einem neuen Angebot darstelle.58Der Kunde müßte dieses neue Angebot annehmen.
c. Lösungsmöglichkeiten
Unproblematisch und logisch erscheint es, daß, wenn das Angebot vom Kunden ausgeht, für die Einbeziehung der Verkäufer-AGB die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 AGBG erfüllt sein müßten.59Streit bestehe aber darin, ob es bei einer invitatio ad offerendum ausreiche, wenn ein ausdrücklicher Hinweis auf die AGB gegeben werde, der Kunde diese aber bei seiner Bestellung, also seinem Angebot, nicht in Bezug nehme.60
aa. Auslegung über §§ 133, 157 BGB / Vorrang des § 2 AGBG
Das Problem könnte zu lösen sein mit Hilfe der Auslegungsregeln des BGB, hier insbesondere der §§ 133, 157 BGB. Auslegung einer Willenserklärung sei die Ermittlung ihres rechtlich maßgeblichen Sinnes.61 Abzustellen sei hier auf den wahren Willen des Erklärenden unter Berücksichtigung der Sichtweise des Verwenders als Erklärungsempfänger.62Der wahre Wille des Erklärenden bestehe darin, daß er die AGB nicht einbeziehen möchte, was der Erklärungsempfänger auch erkennen könnte.63Einer Entscheidung, welcher dieser beiden Aspekte größeres Gewicht zukommt, bedarf es indes nicht, denn das Problem wird nach der Rechtsprechung des BGH64mit dem Vorrang des § 2 AGBG gelöst. Durch den ausdrücklichen Hinweis werde der Einbeziehungsvorgang formalisiert. § 2 AGBG stelle einen lex specialis gegenüber anderen Vorschriften dar, aus denen sich die vertragliche Geltung der AGB ergeben, also auch gegenüber den Auslegungsregeln.65 Es sei deshalb ausgeschlossen, den Hinweis des Verwenders im Wege der Auslegung seiner sonstigen auf den Vertragsschluß zielenden Erklärungen zu gewinnen.66Somit reiche es aus, wenn ein ausdrücklicher Hinweis vorab gegeben war, auch wenn das Angebot vom Kunden ausgehe.67
bb. Vergleich zu schriftlichen Vertragsschlüssen
Auch der Vergleich zu „gewöhnlichen“ Vertragsschlüssen könnte zu einem sinnvollen Ergebnis führen, z.B. ein Vergleich mit einer Bestellung aus Katalogen oder Preislisten. Das Internet wäre mit einem „virtuellen Katalog“ vergleichbar. Bei Bestellung nach Katalogen wird vertreten, daß ein schriftlicher Hinweis im Katalog ausreiche, wonach eine Bestellung nur mit Einbeziehung der AGB akzeptiert werde.68Nach anderer Ansicht69müsse dieser Hinweis allerdings im Bestellformular ausdrücklich genannt sein, ein Fehlen bzw. ein bloßer Hinweis im Katalog verhindere die Einbeziehung.
cc. Auffassung Koehlers in Bezug auf Internetverträge
Nach der Auffassung Koehlers70komme es darauf an, wie der Kunde die Bestellung abgebe. Wenn der Kunde sein Angebot mittels Antragsformular auf einer Web-Seite des Unternehmers abgebe, reiche es aus, daß dort ein deutlicher Hinweis gegeben sei.71Wähle der Kunde allerdings den Weg über Email, so könnte der Unternehmer nur gemäß § 150 Abs. 2 BGB ein neues Angebot unter Bezugnahme auf seine AGB abgeben, welches der Kunde annehmen müsse. Ansonsten würde er auf die Einbeziehung seiner AGB verzichten.
dd. Stellungnahme
Gemäß § 2 I Nr. 1 AGBG ist es zwingend erforderlich, daß der Hinweis auf die Einbeziehung der AGB “ausdrücklich” erfolgt. Ob das Angebot nun vom Verwender ausgeht oder vom Kunden, darf keinen Unterschied machen. Wenn der Kunde vorher genau darauf hingewiesen wird, daß der Vertrag nur unter der Voraussetzung der Einbeziehung der AGB zustandekommt, so weiß er, auch bei Abgabe seines Angebots, daß diese Voraussetzung erfüllt sein muß, wenn er dies nicht mehr explizit sichtbar macht. Auch darf es keine Unterscheidung geben zwischen einer Bestellung per Email oder direkt per Bestellformular. Der Kunde war vor seiner Bestellung auf der Web-Seite des Anbieters, hat dort den ausdrücklichen Hinweis wahrgeno mmen, daß ein Vertrag nur unter Einbeziehung der AGB zu Stande kommt. Somit kann er sich dann später nicht darauf berufen, daß er in seiner Email die AGB nicht aufgeführt hat. Dies würde zu einer problemlosen Umgehung kommen und den Verwender zu stark benachteiligen. Um sowohl dem Merkmal der „Ausdrücklichkeit“ gerecht zu werden als auch den Schutz des Verbrauchers zu gewährleisten, ist es daher zwingend erforderlich, daß der Verwender entweder den Hinweis in einem Bestellformular für den Durchschnittskunden deutlich sichtbar anbringt oder aber darauf hinweist, daß bei einer Bestellung außerhalb dieses Formulars ein Vertrag nur zustandekommen kann, wenn die AGB akzeptiert werden. Mit Hilfe der oben aufgeführten Lösungsmöglichkeiten72sowie der h.M.73ist es somit möglich, bei Vertragsschluß im Internet einen ausdrücklichen Hinweis auf die AGB anzubringen, auch für den Fall, daß das Angebot des Kunden per Email abgegeben wird.
2. Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme, § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGBG
Desweiteren muß der Kunde gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGBG die Möglichkeit haben, in zumutbarer Weise von den AGB Kenntnis zu nehmen. Die andere Vertragspartei müsse in die Lage versetzt werden, die Rechtsfo lgen und Risiken seines Vertragentschlusses einschätzen zu können.74Neben den allgemeinen Voraussetzungen (vgl. S. 5/6) kommen für den Internetverkehr noch besondere Anforderungen hinzu, die mit den Anforderungen verglichen werden, die für Btx gesehen werden. Dabei geht es um die Frage, in welcher Weise müßten die AGB dem Kunden zugänglich gemacht werden bzw. welche Folgen hat das „Nichtübergeben“, sondern das flüchtige Betrachten am Bildschirm.
a. Stand der Diskussion
Uneinigkeit besteht darin, welche besonderen Anforderungen zu welchem Zeitpunkt erfüllt sein müssen, um bejahen zu können, daß die Kenntnisnahme in zumutbarer Weise möglich war. Als ausreichend werde es empfunden, wenn zur Kenntnisnahme ein sogenanntes Hyperlink, also eine Verknüpfung zu den Seiten der AGB, bestehe; die AGB müßten sich nicht auf der Bestellseite selbst befinden.75Dem Kunden müsse nur die Möglichkeit eingeräumt werden, die AGB zur Kenntnis zu nehmen, so daß es nicht erforderlich ist, daß der Kunde diese vorher lesen muß. Es dürfen im Internet keine anderen Voraussetzungen gelten als im Falle gedruckter AGB. Die Frage nach der Länge der AGB und das Problem der nachträglichen Veränderung bereiten hier oftmals Schwierigkeiten. Bei Btx- AGB werde eine Einbeziehung nur bejaht, wenn es sich um kurze Texte handele,76während das OLG Köln sogar 7 Textseiten für zulässig hielt.77Auch werde bei Btx-Verträgen eine generelle Ablehnung der Einbeziehung vertreten, da am Bildschirm die AGB nicht mehr vorhanden seien.78 Ebenfalls werde von der Literatur79der Einwand der Abänderbarkeit der AGB nach Vertragsschluß erhoben. Dieses Problem werde allerdings mit der Möglichkeit des Herunterladens der AGB abgeschwächt, die dem Kunden erlauben, dem Verwender Betrug zu beweisen. Der Verwender werde sich nicht einem derart hohen Risiko aussetzen. Darüber hinaus sind noch besondere Anforderungen an das Merkmal der Zumutbarkeit geknüpft. Bisher wurde nicht klar zwischen der Möglichkeit der Kenntnisnahme auf der einen und der Zumutbarkeit auf der anderen Seite unterschieden.80Nicht alles, was möglich sei, sei auch zumutbar.81Die Zumutbarkeit richte sich grundsätzlich nach den Umständen bei Vertragsschluß und nach den Bedürfnissen der beteiligten Kundenkreise.82Es müsse lediglich gewährleistet sein, daß die AGB für einen Durchschnittskunden mühelos lesbar seien und daß sie ein Mindestmaß an Übersichtlichkeit sowie einen im Verhältnis zur Bedeutung des Geschäfts vertretbaren Umfang haben.83Diese Voraussetzungen müssen insbesondere auch erfüllt sein, wenn die AGB auf einer WebSeite des Verwenders zur Ansicht bereitgehalten werden.84
b. Stellungnahme
Der Vergleich mit Btx-AGB ist nicht möglich. Die Btx-Technik unterscheidet sich gravierend vom Internet. Bildschirmseiten werden im Internet wesentlich schneller aufgebaut und übertragen, Darstellungsmöglichkeiten am Bildschirm sind wesentlich klarer, eine Speicherung der AGB ist i.d.R. immer möglich, in sehr vielen Fällen sogar durch Ausdruck dokumentierbar. Diese Argumente zeigen, daß einer Nichteinbeziehung wie bei Btx AGB (vgl. S. 16) nicht zugestimmt werden kann. Bei der Länge der AGB im Internet ist dem oben Gesagten zuzustimmen (vgl. S. 16). Es ist wichtig, das eine angemessene Relation zwischen AGB und Geschäftsinhalt hergestellt werde.85Bei Alltagsgeschäften mit geringem Volumen darf die Länge der AGB nicht unverhältnismäßig hoch sein. Das Maß der Zumutbarkeit wäre einzuhalten, wenn der Kunde problemlos die AGB am Bildschirm betrachten kann. Bei Geschäften mit größerem Volumen ist es auch sinnvoll und angebracht, längere AGB zu akzeptieren. Dem Kunden kann dann zugemutet werden, sich mit längeren AGB auseinanderzusetzten. Der Problemkreis der nachträglichen Veränderung bedarf keiner weiteren Betrachtung. Die Risiken, insbesondere Beweisrisiken, treffen den Verwender, der kaum in der Lage sein wird, den Beweis anzutreten, daß nachträglich geänderte Bedingungen Vertragsbestandteil geworden sind. Der Kunde, der sich i.d.R. nicht auf diese AGB berufen wird, kann mit Hilfe der AGB einen Gegenbeweis antreten, die er sich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses heruntergeladen und eventuell sogar ausgedruckt hat. Letztlich ergeben sich diese Probleme auch beim Vertragsschluß unter Anwesenden. Der Vergleich zeigt, daß es beim Vertragsschluß im Internet einfacher ist, die AGB zur Kenntnis zu nehmen. Im Geschäft wird man kaum Gelegenheit haben, sich in aller Ruhe die AGB durchzulesen. Auch ist die Ansicht im Geschäft erschwert, denn dort sind die AGB i.d.R. wesentlich kleiner abgedruckt, am PC Bildschirm lassen sich diese einfacher lesen, weil beliebig vergrößerbar. Für den Fall, daß es dem Kunden möglich ist, die AGB kostenlos, herunterladen zu können, um sie dann entweder auf einer Diskette zu speichern oder am Drucker auszudrucken, ist eine Einbeziehung nach dem AGBG möglich und zu bejahen. Die anfallenden Provider-Gebühren führen nicht dazu, daß die Kenntnisnahme unzumutbar sei.86
c. Verständlich / Lesbar (Problem der Sprache)
Die AGB müssen darüber hinaus noch verständlich und vor allem lesbar dargestellt werden. Hier ergibt sich im Internet häufig das Problem, daß man ausländischen Anbietern begegnet, die ihre AGB in Ihrer Sprache fassen. An der Möglichkeit der Kenntnisnahme ließe sich dann zweifeln. Nach einer Ansicht87komme eine Einbeziehung von AGB in fremder Sprache nur in Betracht, wenn der Verbraucher diese Sprache nachweislich beherrsche bzw. diese in der Verhandlungssprache abgefaßt sei. Andere88vertreten, daß bei Distanzgeschäften auf die Sprache des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Adressaten abzustellen sei. Die h.M.89vertrete die Auffassung, daß sich derjenige, der sich auf einer Internetseite auf eine bestimmte Sprache als Korrespondenzsprache eingelassen habe, sich später nicht darauf berufen könnte, die AGB seien nicht einbezogen, weil sie nicht in seiner Sprache verfaßt seien. Dieser Auffassung ist zuzustimmen, da sie sowohl Belange des Verwenders wie auch den Schutz des Kunden berücksichtigt. Es kann dem Verwender nicht zugemutet werden, seine Internetangebot in sämtlichen, zumindest gängigen Sprachen, bereitzustellen. Der Verbraucher, der auf einer ausländischen Seite surft, darf keine Bestellung aufgeben, wenn er die Sprache der ausländischen Anbieter nicht so beherrscht, daß er Erklärungen versteht. Ein nachträglicher Schutz wäre hier nicht angebracht.
3. Einverständnis des Kunden
Das Einverständnis, das erforderlich ist, um die AGB einzubeziehen, gibt der Kunde zum Ausdruck, indem er seine Willenserklärung entweder per Email oder als Bestellformular im Internte an den Unternehmer abschickt.
C. Besonderheiten beim Versicherungsvertragsschluß außerhalb und im Internet
Auch Versicherungsunternehmen drängen verstärkt ins Internet, um ihre Produkte im Netz anzubieten.90Geklärt wurde bereits, daß auch AVB AGB i.S.d. AGBG darstellen (vgl. S. 3). Neben allgemeinen Problemen der Einbeziehung von Geschäftsbedingungen, ergeben sich bei Vertragsschluß im Internet für die Einbeziehung von AVB einige Besonderheiten.
I. Wegfall der aufsichtsbehördlichen Genehmigung
Diese Besonderheit wurde oben bereits näher betrachtet (vgl. S. 3).
II. Wirksame Einbeziehung gemäß § 2 AGBG / Problem der
körperlichen Aushändigung i.V.m. dem Versicherungsrecht (§§ 10a VAG / 5 a VVG)
AVB müssen sowohl beim Vertragsschluß unter Anwesenden wie auch im Internet, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der Versicherungsgesetze, gemäß § 2 AGBG wirksam einbezogen werden. Hierzu ist erneut ein geeigneter Hinweis sowie die Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme erforderlich. Ein geeigneter Hinweis sei bei Internetgeschäften unter gewissen Voraussetzungen durchaus möglich. Problematisch ist erneut das Merkmal der Möglichkeit einer zumutbaren Kenntnisnahme. Generell sei eine Einbeziehung von AGB, hier AVB, nach dem AGBG möglich, auch ohne körperliche Aushändigung, wenn das VVG nichts anderes bestimme.91Es werde jedoch impliziert, daß für den Versicherungsnehmer die AVB bei und grundsätzlich auch nach Vertragsschluß verfügbar sein müssen.92Die AVB müssen hierzu ausgehändigt werden,93eine körperliche Aushändigung ist somit Pflicht. Dieser Tatbestand ergibt sich aus der in § 10a VAG festgelegten Informationspflicht. Diese Pflicht erstreckt sich auch auf die AVB. Problematisch ist hier insbesondere das Erfordernis der Schriftlichkeit, die im Internet generell nicht erfüllt werden könne.94Andere95 unterscheiden zunächst nach den verschiedenen Modellen des Abschlusses von Versicherungsverträgen, namentlich dem Antrags- bzw. Policenmodell. Hier wird versucht, eine Einbeziehung im Rahmen des Internet genauer zu untersuchen.
1. Antragsmodell
Beim Antragsmodell werden sämtliche Verbraucherinformationen, insbesondere die AVB, dem Kunden vorab ausgehändigt, um somit die Verpflichtung aus 10a VAG zu erfüllen. Der Versicherungsvertrag komme dann zustande, wenn das Versicherungsunternehmen den Antrag des VN annehme.96Im Internet könne das Unternehmen diese Vorabinformation aber nicht erfüllen, denn es fehle an der körperlichen Aushänd igung, die aus dem Erfordernis der Schriftlichkeit des § 10a II VAG folge. Das Antragsmodell könne daher zum OnlineVertragabschluß mit natürlichen Personen nicht generell genutzt werden.97In der Praxis (z.B. Victoria Versicherung) wird versucht, dieses Schriftformerfordernis im Internet zu vereinfachen, indem mit dem Kunden eine Vereinbarung getroffen werde, daß sich dieser verpflichte, die erforderlichen Unterlagen vor Vertragsschluß selbst auszudrucken. Nach dem BAV98ist dies allerdings sehr bedenklich und umstritten, ein Vertragsabschluß werde eher verneint.
2. Policenmodell
Beim Policenmodell ergebe sich erneut das Problem des Schriftlichkeitserfordernisses, allerdings diesmal in Bezug auf die Belehrung gemäß § 5 a II S. 1 VVG.99Bei diesem Modell werden die Verbraucherinformationen erst nach Antragstellung mit der Police dem VN überlassen. Der VN muß allerdings über das 14tägige Widerspruchsrecht gemäß § 5a Abs. 2 Satz. 1 VVG belehrt werden. Geschieht dies nicht, werde die Widerspruchsfrist nicht in Gang gesetzt, der Vertrag sei bis zu einem Jahr nach Zahlung der ersten Prämie schwebend unwirksam. Danach komme er dann auf Grundlage des Versicherungsscheins, der Verbraucherinformation und unter Einbeziehung der AVB wirksam zustande.100Diese Belehrung könne somit im Internet ebenfalls nicht erfolgen.101Da es dem Versicherer gemäß § 3 I VAG möglich wäre, eine Police über das Internet zu übermitteln, bleiben dem Unternehmen beim Policenmodell in Bezug auf das Internet zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte man die Antragsformalitäten im Internet abwickeln, dann aber per Post die Police, in der auch die Belehrung erfo lgen kann, zuzusenden. Dies wäre dann kein vollständiger Online-Vertragsabschluß. Zum anderen könnte sich der Versicherer dem Risiko aussetzen, daß der Vertrag für ein Jahr schwebend unwirksam ist, der Kunde also innerhalb diesen Jahres diesen Tatbestand ausnutzen kann. Generell eignet sich auch das Policenmodell nicht zum kompletten Vertragsabschluß im Internet bzw. der kompletten Einbeziehung von AVB.
3. Folgen für die Einbeziehung von AVB im Internet
Als Folge ergibt sich, daß es zwar möglich erscheint, auch einen Versicherungsvertrag im Internet abzuschließen, dies aber mit wesentlich größeren Problemen behaftet ist, als sich dies beim „gewöhnlichen“ Vertragsschluß im Internet der Fall ist. Weder das Policenmodell noch das Antragsmodell eignen sich derzeit für die Einbeziehung von AVB beim Internetgeschäft, insbesondere weil dem Erfordernis der Schriftlichkeit nicht genüge getan werden kann. Dieses Problem müßte durch den Gesetzgeber in Bezug auf das Internet beseitigt werden, bevor ein kompletter Vertragabschluß und somit auch die Einbeziehung von AVB erfolgen kann.
III. Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG
Verschiedene EG-Richtlinien haben versucht, die oben beschriebenen Probleme in den Griff zu bekommen. Zunächst wurde eine Richtlinie102 erlassen, die einen wirksamen virtuellen Vertragsabschluß und einen EG-weiten Mindeststandard im Verbraucherschutz gewähren sollte. Leider wurden gemäß Art. 3 I Fernabsatz-RiLi Finanzdienstleistungen, zu denen auch das Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft zählt, aus dem Anwendungsbereich herausgenommen. Aus diesem Grunde hat bereits Ende 1997 die Generaldirektion XV und XXIV Entwürfe über eine Fernvertragsrichtlinie über Finanzdienstleistungen vorgelegt. Die Richtlinie103wird erlassen werden, um gemäß Art. 17 I Finanz-RiLiV bis 30.06.2002 in den Mitgliedsstaaten umgesetzt zu werden. Diese schließt gemäß Art. 2 b Versicherungsdienstleistungen ein. Gemäß Art. 3a Nr. 1 und 2 der Entwürfe reicht es dann aus, wenn der Anbieter dem Verbraucher die Vertragsbedingungen entweder vorher oder nachher auf Papier oder einem dauerhaften Datenträger übermittelt. Als dauerhafter Datenträger bezeichnet die Richtlinie gemäß Art. 2 f jedes Medium, das es dem Verbraucher gestattet, an ihn persönlich gerichtete spezifische Informationen insbesondere auf Diskette, CD-ROM oder der Festplatte zur Speicherung von per E-Mail übermittelten Daten auf seinem Computer aufzubewahren. Somit löst die Richtlinie die bisher nach deutschem Recht bestehenden Probleme des Schriftformerfordernisses. Als ausreichenden Schutz für den Verbraucher sieht die Richtlinie in Art. 4 a und b ein 14tägiges Widerspruchsrecht vor. Der Widerspruch ist ohne Angabe von Gründen sowie ohne eine etwaige Vertragstrafe möglich. Sollte der Versicherer die Vertragsbedingungen vor Vertragsschluß ausgehändigt haben, beginnt die Frist mit dem Tag des Vertragabschlusses. Ist auf Ersuchen des Verbrauchers der Vertrag vor Zusendung der entsprechenden Unterlagen geschlossen worden, beginnt die Frist erst mit nachträglicher Zusendung der Unterlagen.
IV. Nachträgliche Änderung der AGB bzw. AVB
Auch im Internet wird es vorkommen, daß AGB bzw. AVB geändert werden. Hier kann auf die obigen Voraussetzungen verwiesen werden (vgl. S. 7/8). Hier ist allerdings darauf zu achten, welche Art von Vertrag vorliegt. Beim gewöhnlichen Vertrag, bei dem eine Ware bezogen wurde, macht es wenig Sinn, die AGB nachträglich zu verändern. Beim Versicherungsvertrag kann eine Änderung im Internet nur unter verhältnismäßig großen Schwierigkeiten vollzogen werden. Der Kunde ist nicht verpflichtet, regelmäßig im Internet etwaige Änderungen abzurufen. Es kann nur eine Email an Kunden verschickt werden, die um wirksam zu werden, angenommen werden muß, ggf. per Email.
D. Ergebnisse bei der Einbeziehung von AGB / AVB
Die Einbeziehung von AGB bei Vertragabschlüssen unter Anwesenden außerhalb des Internets ist problemlos möglich und wird regelmäßig nach dem AGBG geregelt. Auch im Internet ist es möglich, insbesondere bei Verträgen des täglichen Lebens, AGB in den Vertrag einzubeziehen. Die Einbeziehung von AVB im Internet ist derzeit noch nicht problemlos möglich. Ein reiner Onlinevertrag wirft eine Reihe von Schwierigkeiten auf, die bisher noch nicht bewältigt werden könnten, insbesondere nicht das zwingende Formerfordernis der Schriftlichkeit. Die neue Richtlinie soll dieses Problem lösen, so daß spätestens ab 2002 auch die Einbeziehung von AVB im Internet möglich wird.
Teil 2: Kontrolle von AGB / AVB
Kommt man nun zu dem Ergebnis, daß die AGB bzw. AVB ordnungsgemäß in den Vertrag einbezogen sind, entweder im Internet oder bei anwesenden Vertragspartnern, so stellt sich die Frage, welchen weiteren Schutz der Vertragsgegner genießt. Hierbei ist entscheidend, wie die Vertragspartner auftreten. Für AGB und vorformulierte Klauseln in Verbraucherverträgen seien strengere Inhaltsschranken notwendig als die allgemeinen Grenzen der Vertragsfreiheit.104Daher sehe das AGBG zum Schutz des anderen Teils einen Katalog verbotener Klauseln vor (§§ 10,11).105Eine nur kasuistische Regelung dieser Art sei notwendigerweise lückenhaft, so daß sie durch eine Generalklausel, § 9 ABGB, ergänzt werde.106Sie lege zugleich den Maßstab der Inhaltskontrolle fest und sei zugleich Auffangtatbestand.107Für die Reihenfolge der Prüfung ergebe sich daher, daß zunächst die Verbote des § 11 AGBG (keine Wertungsmöglichkeit) heranzuziehen seien, dann die des § 10 AGBG (mit Wertungsmöglichkeit), dann § 9 II AGBG und erst zuletzt § 9 I AGBG.108 Die Inhaltskontrolle nach dem AGBG kompensiere die für den Vertragpartner fehlende Möglichkeit der inhaltlichen Einflußnahme auf die AGB,109somit gewährt das Gesetz dem Verbraucher einen in gewisser Weise nachträglichen Rechtsschutz. Gemäß § 8 AGBG muß allerdings beachtet werden, welche AGB-Klauseln überhaupt kontrollfähig sind. Fraglich kann allerdings sein, ob und ggf. welche Klauseln zur Anwendung kommen. Eine EG-Richtlinie110hat dort wesentliche Veränderungen gebracht und wurde durch die AGBG - Novelle vom 19.07.1996 in das deutsche Recht umgesetzt. So wurde z.B. als wichtige Änderung § 24a AGBG speziell für Verbraucherverträge eingefügt. Hiernach sind bei Verträgen zw ischen einer natürlichen Person, die den Vertrag zu privaten Zwecken abschließt (Verbraucher), und einem Unternehmer gemäß Nr. 3 auch die Begleitumstände des Vertragsschlusses zu berücksichtigen. Da die Kriterien bei Verträgen des täglichen Lebens sowie Versicherungsverträgen erfüllt sind, gilt § 24a AGBG auch für die folgenden zu untersuchenden Verträge.
A. Beim Vertragsschluß unter Anwesenden
Beim gewöhnlichen Vertragsschluß unter Anwesenden, insbesondere beim Versicherungsvertrag, wird man in aller Regel zu dem Ergebnis kommen, daß AGB bzw. AVB in den Vertrag einbezogen worden sind. Hier kann dann in den Grenzen des § 8 AGBG eine Kontrolle der Klauseln stattfinden.
I. Inhaltskontrolle von AGB / AVB, §§ 8ff. AGBG
Gemäß §§ 8ff. AGBG kann eine Inhaltskontrolle von AGB stattfinden.
1. Sinn und Zweck der Inhaltskontrolle
Warum ist es überhaupt erlaubt, eine Inhaltskontrolle durchzuführen, obwohl darin ein gravierender Eingriff durch staatliche Gerichte in das System der freien Marktwirtschaft gesehen werde?111Die wohl h.M.112, der zuzustimmen ist, rechtfertigt dies mit zwei zentralen Argumenten: Zunächst handelt es sich i.d.R. um einen Verbraucher, der nur die Möglichkeit hat, entweder den Vertrag unter Hinzunahme der AGB abzuschließen oder auf den Vertrag ganz zu verzichten. Für ihn besteht demnach keinerlei Aushandels- oder Ausweichmöglichkeit. Ein gewisser, nachträglicher Rechtsschutz soll dies ausgleichen. Desweiteren soll gerichtliche Kontrolle verhindern, daß der Verwender seine Stellung ausnutzt und es zum Mißbrauch privatautonomer Gestaltungsfreiheit kommt. Bei AVB war bis 1994 eine Vorabkontrolle durch das BAV erforderlich. Seit sie entfiel (vgl. S. 3), soll eine regelmäßige Kontrolle durch das AGBG stattfinden. Folgende Ausführungen gelten für Versicherungsverträge demnach entsprechend.
2. Schranken der Inhaltskontrolle, § 8 AGBG
Nicht alle Klauseln sind nach dem AGBG kontrollfähig. Gemäß § 8 AGBG gelten die §§ 9-11 AGBG nur für solche Bestimmungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Daraus folge, daß z.B. Leistungsbeschreibungen, die den Gegenstand der Hauptleistung unmittelbar festlegen, nicht kontrollfähig seien.113 Desweiteren seien Preisvereinbarungen, soweit sie Art und Umfang der Vergütung unmittelbar regeln, nicht kontrollfähig.114Auch „deklaratorische Klauseln“, also mit normativen Regelungen übereinstimmende AGB unterliegen nicht der Inhaltskontrolle.115
Bei AVB finden diese Vorschriften ähnliche Anwendung. „Deklaratorische“ Klauseln, die lediglich den Wortlaut der für den Vertrag maßgeblichen Vorschriften des VVG wiederholen, seien ebenfalls nicht krontrollfähig.116Bestimmungen, die den Hauptgegenstand des Versicherungsvertrages festlegen, unterliegen grundsätzlich keiner Inhaltskontrolle nach dem AGBG117. Probleme bereite hier allerdings die Abgrenzung.118In einigen älteren Meinungen wird gefordert, die Kontrolle stark zu beschränken, was im Hinblick auf die besondere Schutzbedürftigkeit von Versicherungsnehmern nicht zu vertreten ist. Daher ist der Ansicht der Rechtsprechung119zu folgen, daß bloße Leistungsbeschreibungen kontrollfrei seien, da diese nur Art, Umfang und Güte der geschuldeten Leistung festlegen, aber die für die Leistung geltenden gesetzlichen Vorschriften unberührt lassen. Klauseln, die das Hauptleistungsversprechen einschränken, verändern, ausgestalten oder modifizieren, seien hingegen inhaltlich zu kontrollieren.
3. Klauselverbote, §§ 10, 11 AGBG
Die Klauselverbote der §§ 10, 11 AGBG seien lediglich beispielhafte Anwendungsfälle der Generalklausel des § 9 AGBG. Sie seien keineswegs vollständig, sondern erfassen nur ein Reihe typischerweise besonders gefährlicher Klauseln.120§ 11 AGBG Gesetz enthält einen Katalog von Klauselverboten ohne Wertungsmöglichkeiten, der als lex specialis dem des § 10 AGBG und der Generalklausel des § 9 AGBG vorgehe.121 Wertungsmöglichkeit bedeute, daß unbestimmte
Rechtsbegründungen verwendet werden, die Feststellung der Unwirksamkeit also eine richterliche Wertung erfordere.122Durch § 10 AGBG folgt, daß nicht bereits die Erfüllung des Tatbestands die Unwirksamkeit der Klausel begründet, erforderlich wird eine Bewertung der in den Klauseln vorkommenden unbestimmten Rechtsbegriffe (z.B. „angemessen“ in § 10 Nr. 1, 2, 5 AGBG oder „ohne sachlich gerechtfertigten Grund“ in § 10 Nr. 3 AGBG). Die in § 11 zusammengefaßten Verbote gelten ohne Wertungsmöglichkeit, d.h. eine hierunter fallende Klausel sei schlechthin unwirksam.123
4. Generalklausel, § 9 AGBG
Die Generalklausel des § 9 I AGBG lege den grundlegenden Wertungsmaßstab für die richterliche Inhaltskontrolle von AGBG fest124, während § 9 II AGBG versuche, die Generalklausel zu konkretisieren125, indem er typisch rechtliche Kriterien angibt, die i.d.R. die Unwirksamkeit der Klausel begründen.
a. Unwirksamkeit, § 9 II Nr. 1 und 2 AGBG
Die besondere Bedeutung des § 9 II liegt darin, daß die Vorschrift an einige in der bisherigen Rechtsprechung in bestimmten Fallgruppen entwickelte Prüfungsgrundsätze anknüpft und so auch künftig die Bildung typischer Sachverhalte in gewissem Umfang erleichtern könnte. Eine dieser Fallgruppen der unangemessenen Benachteiligung beschreibt § 9 Abs. 2 Nr.1 AGBG damit, daß sie mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist. Für den wesentlichen Grundgedanken sei entscheidend, ob die durch dispositives Recht abgedungene Norm einem wesentlichen Schutzbedürfnis des Vertragspartners diene.126Als gesetzliche Regelung gelten alle Gesetze im materiellen Sinne, auch Gewohnheitsrecht sowie Verordnungen. Ebenfalls zählen hierunter die von Rechtsprechung und Lehre durch Analogie und Rechtsfortbildung entwickelten Rechtsgrundsätze sowie Vorschriften des EG-Rechts.127Unvereinbar ist es dann, wenn ein Eingriff in die geschützten Interessen des Vertragspartners in nicht unerheblichem Maße vorliegt. Als Beispiel wäre hier zu nennen, wenn bei einem Kaufvertrag das Wandlungsrecht für den Fall eingeschränkt wird, daß eine Nachbesserung fehlgeschlagen ist. Desweiteren läge auch ein Verstoß gegen § 9 II Nr. 1 AGBG vor, wenn bei Reisebedingungen jegliche Haftung ausgeschlossen wird.
Eine Unterscheidung zwischen § 9 II Nr. 1 und 2 AGBG ist sehr schwer, da eine Einschränkung wesentlicher Rechte und Pflichten i.d.R. auch nach Nr. 1 eine unangemessene Benachteiligung darstellt.
Gemäß § 9 II Nr. 2 AGBG liegt eine solche vor, wenn sie wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, so einschränkt, daß die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Als wesentliche Rechte gelten hier die sogenannten Kardinalpflichten (Hauptpflichten)128, aber auch Nebenpflichten von großer Bedeutung (z.B. Schutz-, Obhuts- und Sorgfaltspflichten)129. Die Natur des Vertrages ergebe sich zum einen aus dem allgemeinen Sinn eines jeden Vertrages, der Bindung an ein Versprechen, sowie zum anderen aus den Besonderheiten des jeweiligen Vertragstyps.130Der jeweilige Vertrag habe für den Vertragspartner nach Inhalt und Zweck gewisse Gewährleistungen zu erfüllen131. Diese dürfen nicht gefährdet werden. Als Beispiel für die Anwendung des § 9 II Nr. 1 AGBG ist hier der Autowaschvertrag zu nennen: Der Kunde hat die Erwartung, daß der Wagen nicht schuldhaft beschädigt wird. Eine Haftungsbeschränkung ist daher unzulässig.
b. Unwirksamkeit, § 9 Abs. 1 AGBG
Wenn § 2 II Nr. 1 und 2 AGBG keine Anwendung finden, bestehe noch die Möglichkeit, eine Überprüfung anhand der Generalklausel vorzunehmen.132Als Leitlinie hat die Rechtsprechung folgendes aufgestellt: Die Klausel ist unangemessen, in der der Verwender mißbräuchlich eigene Interessen auf Kosten des Vertragspartners durchsetzten versucht, ohne von vornherein die Interessen eines Partners hinreichend zu berücksichtigen und ihm Ausgleich zu zuspechen.133Auszugehen sei immer von der Vorschrift des dispositiven Rechts, die ohne die Klausel gelten würde.134Es muß eine Interessenabwägung erfolgen und die Abweichung muß Nachteile von einigem Gewicht begründen.135Als Beispiel kann hier ein Verstoß gegen das Transparenzgebot genannt werden, d.h. der Kunde konnte nicht hinreichend erkennen, welche Nachteile die Klausel für ihn hatte.
5. Rechtsfolgen der Unwirksamkeit, § 6 AGBG
Bei den Rechtsfolgen kann auf obige Ausführungen verwiesen werden (vgl. S. 8 ).
II. Wer kontrolliert AGB?
Es ist zum Teil nicht ersichtlich, daß den §§ 8-11 AGBG eine erhebliche Tragweite zukommt, da alle vorformulierten Vertragsbedingungen alle der Kontrolle unterliegen, ohne Rücksicht darauf, ob behördlich genehmigt, notariell beurkundet, klar oder mißverständlich formuliert oder auch, wenn sie kurz und knapp seien.136Eine Kontrolle kann durch jeden Rechtsanwender von Amts wegen vorzunehmen sein, eine Berufung auf Unangemessenheit ist dabei nicht erforderlich. Rechtspfleger, Notare, sogar Behörden können dazu berufen sein, AGB zu kontrollieren und zu beanstanden. I.d.R. sind es allerdings Gerichte, die aufgrund von Unklarheiten aufgerufen werden, diese zu kontrollieren. Zusätzlich kann eine Kontrolle und Beanstandung von AVB durch das BAV durchgeführt werden, auch nach dem Wegfall der präventiven Kontrolle. Es obliege dem BAV sogar, eine Klausel zu untersagen.137
B. Besonderheiten beim Vertrag im Internet
Leider fehlt es in Literatur und Rechtsprechung an Stellungnahmen zur Kontrolle von AGB / AVB im Internet138, die Texte beziehen sich immer nur auf die Einbeziehung von ABG / AVB bzw. die generelle Kontrollfähigkeit von Klauseln. Hieraus muß gefolgert werden, daß neben einigen Sonderproblemen, die sich aber auch schon bei der Einbeziehung ergeben haben, eine Kontrolle im Internet auch nachträglich nach den Maßstäben der gewöhnlichen Inhaltskontrolle stattfindet.
I. Inhaltskontrolle von AVB / AGB
Somit kann bei der Inhaltskontrolle im Internet auf die allgemeinen Bestimmungen des AGBG verwiesen werden (vgl. S. 23ff.).
II. Wer kontrolliert AGB / AVB im Internet?
Auch bei AGB /AVB -Verwendung im Internet findet eine nachträgliche Kontrolle durch Gerichte bzw. BAV statt.
III. Erweiterte Inhaltskontrolle nach § 24a AGBG
Bei der erweiterten Inhaltskontrolle, in der die besonderen Umstände des Vertragsschlusses zu berücksichtigen sind, kann es gerade im Internet für den Verbraucher zu nachteiligen Auslegungen kommen.139Beim Online Vertrag geht die Initiative i.d.R. vom Verbraucher aus, der sehr gute Möglichkeit hat, vorab Bedingungen zu kontrollieren und genau abzuwägen, welche Folgen die Klauseln für ihn haben. Eine Einwirkung von seiten des Verwenders hat nicht stattgefunden.
IV. Nachträgliche Veränderung durch den Verwender
Einzig problematisch erscheint hier die Kontrolle, wenn der Verwender seine AGB nachträglich, ohne Wissen des Verbrauchers, verändert. Bereits oben wurde auf diese Problematik kurz eingegangen (vgl. S. 7/8; 23). Der Verwender beruft sich auf eine Klausel, die nach Meinung des Verbrauchers nicht in den Bedingungen enthalten war. Einer nur behaupteten Abänderung stehe entgegen, daß sich der Verwender einem Strafbarkeitsrisiko wegen Betruges aussetze.140Desweiteren ist anzumerken, daß dem Verwender, der sich auf die geänderte Klausel berufe, die Darlegungs- und Beweislast sowohl für die Einbeziehung,141wie auch für deren Inhalt bei Vertragsschluß obliege.142Der Internetkunde sollte sich demnach immer die AGB vor Vertragsschluß ausdrucken, so daß eine problemlose Kontrolle möglich ist.
C. Besonderheiten beim Versicherungsvertrag im Internet
Beim Versicherungsvertrag ist nach der obigen Meinungen ein reiner Online- Vertrag derzeit noch nicht möglich, dem VN sind die AVB immer noch gesondert zuzuschicken (vgl. S.20/21). Nach der Umsetzung der EG-Richtlinie im Jahre 2002 kann es auch beim Versicherungsvertrag im Internet zu dem Problem kommen, daß der Versicherer die AVB nachträglich abändert. Hier ist auf die obige Lösung zu verweisen (vgl S. 7/8; 23)
D. Ergebnisse bei der Kontrolle von AGB / AVB
Bei der Kontrolle von AGB / AVB wird es keinen Unterscheid machen, ob der Vertrag im Internet abgeschlossen wurde oder nicht. Eine Kontrolle kann, vorausgesetzt dem Kunden liegen die bei Vertragsschluß gültigen Bedingungen vor, in gleichem Umfang stattfinden. Die Kontrollmöglichkeiten sind sehr vielseitig; es gibt eine Reihe von guten Möglichkeiten, eine nachteilige Klausel durch das Gericht für unwirksam erklären zu lassen. Probleme bestehen allerdings darin, daß es für den Verbraucher mit größerem Aufwand verbunden ist, wenn er eine Klausel gerichtliche kontrollieren läßt. Ein gerichtliches Verfahren wird aller Regel nach nicht zu umgehen sein, da sich der Vertragsgegner im Zweifel nicht mir einer Unwirksamkeit abfinden wird.
Einfacher erscheint dies daher beim Versicherungsvertrag. Hier kann sich ein VN an das BAV wenden, das eine Überprüfung einleitet, mit der Folge, daß Klauseln, die den VN in großem Maße benachteiligen, untersagt werden können.
Teil 3:Schlußbetrachtung / These
A. Schlußbetrachtung / Aktuelle Beispiele
Der Internetvertrag wirft in Bezug auf Einbeziehung und Kontrolle von ABG bzw. AVB eine Reihe von Problemen auf, die mit großer Sorgfalt vom Verbraucher berücksichtigt werden sollten, damit es nach Vertragsschluß nicht zu erheblichen Schwierigkeiten kommt, die er aber im Regelfall gar nicht erkennt. Durch die EG-Richtlinie, die 2002 umgesetzt werden soll, wird sicherlich der Vertragsschluß im Internet vereinfacht werden. Bis dahin überwiegen die Probleme und Schwierigkeiten gegenüber den Vorteilen bei Abschluß im Internet. Zu einem Vertragsschluß im Internet ist daher nur zu raten, wenn zum einen der Vertragspartner zumindest in Deutschland ansässig ist, zum anderen ausreichende Möglichkeiten des Schutzes bestehen. Es sollte bedacht werden, daß der Internetvertrag zwar Vorteile aufweist, aber erhebliche Nachteile angezeigt sein können, insbesondere, wenn die Ware nicht ordnungsgemäß geliefert wird.
Anzumerken ist darüber hinaus, daß erst wenige Unternehmen, hier besonders Versicherungsunternehmen, den Vertrag per Internet unterstützen. Die Victoria Versicherung143 bietet derzeit einen kompletten Onlinevertrag an, allerdings mit einer Zusatzvereinbarung, um das Erfordernis der Schriftlichkeit erfüllen zu können. Der Kunde muß sich verpflichten, die erforderlichen Verbraucherinformationen selbst auszudrucken. Sollte sich der Kunde später darauf berufen wollen, daß er diese nie erhalten hätte, wäre dies rechtsmißbräuchlich. Die HUK-Coburg Versicherungen und Bausparen144hat sogar ein zusätzliches Unternehmen gegründet, um das Internetgeschäft trotz vieler Bedenken aufzubauen. Hier ist jedoch kein Vertragsschluß im eigentlichen Sinne möglich, sondern lediglich die Antragsstellung, Der Vertrag kommt dann auf der Grundlage der Police zu Stande, bei der das Widerrufsrecht sowie die Verbraucherinformationen enthalten sind. Der Vertragsschluß richtet sich somit nach § 5a VVG. B Generell sind aber Unternehmen sehr zurüchaltend, da die rechtlichen Schwierigkeiten überwiegen, und die Kunden den Vertragsschluß per Internet noch nicht ausreichend nutzen. Lediglich die Zahl der Anbieter,145 die Geschäfte des alltäglichen Lebens (z.B. Bücherbestellungen; Reisebuchungen Telekommunikaitonsware, etc.) anbieten, nimmt stark zu. Aber auch hier wird anzunehmen sein, daß es sich lediglich um Anträge der Kunden handelt, daß ein Vertragsschluß vielmehr durch die Übersendung der Unterlagen entgültig zu Stande kommt.
B. These zum Thema
Für eine Privatperson ist es mittlerweile problemlos möglich, einen Internetvertrag abzuschließen, auch einen Versicherungsvertrag. Leider ist der Vertragsschluß im Internet noch mit vielen rechtlichen Unsicherheiten behaftet. Einem Internetvertrag ist nur zuzustimmen, wenn es sich zumindest um einen in Deutschland ansässigen Anbieter handelt, denn hier hat der Kunde den Schutz der Verbrauchergesetze. Hier wird sich in aller Regel aber die Problematik ergeben, daß für den Kunden schwer bzw nicht ersichtlich sein wird, wo der Anbieter seinen eigentlichen Sitz hat.
Krefeld, 20.11.2000
Thorsten von Lennep
[...]
1Palandt/Heinrichs, AGBG 23, Rn. 10; Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, § 23 AGBG, Rn. 55.
2Dörner/Hoffmann, NJW 1996, 153, (155); Heinrichs, NJW 1996, 1381, (1383); E. Lorenz, VersR 1995, 616, (625f.); Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, § 23 AGBG, Rn. 55.
3Heinrichs, NJW 1993, 1817, (1818); Ulmer, EuZW 1993, 337, (343);
4Hemmer, Die Einbeziehung von AVB, S. 7.
5Hübner in: Karlsruher Forum 1997 (VersR-Schriften 3). S. 47. Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 42, Rn. 94ff;
Hemmer, Die Einbeziehung von AVB, S. 8.
6Präve, VW 1994, 556, (558).
7Staudinger/Schlosser, § 23 AGBG, Rn. 43. Palandt/Heinrichs, AGBG 23, Rn. 10; Hübner in: Karlsruher Forum 1997 (VersR-Schriften 3), S. 49.
8Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, § 2 AGBG, Rn. 24; MünchKomm-Kötz, § 2 AGBG, Rn. 6.
9Staudinger/Schlosser, § 2 AGBG, Rn. 4, 28.
10Ulmer/Brandner/Hensen, § 2 AGBG, Rn. 24.
11Palandt/Heinrichs, AGBG 2, Rn. 5.
12Erman/Hefermehl, Werner, § 2 AGBG, Rn. 5; Ulmer/Brandner/Hensen, § 2 AGBG, Rn. 29.
13Staudinger/Schlosser, § 2 AGBG, Rn. 4-6; Erman/Hefermehl, Werner, § 2 AGBG, Rn. 5.
14Staudinger/Schlosser, § 2 AGBG, Rn. 6.
15OLG Düsseldorf, VersR 1982, 872, (872), Urt. v. 15.10.81 - 18U 50/81.
16Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, § 2 AGBG, Rn. 29.
17Erman/Hefermehl, Werner, § 2 AGBG, Rn. 5; Ulmer/Brandner/Hensen, „ 2 AGBG, Rn. 29.
18MünchKomm-Kötz, § 2 AGBG, Rn. 8;
19 Erman/Hefermehl, Werner, § 2 AGBG, Rn. 5. Erman/Hefermehl, Werner, § 2 AGBG, Rn. 5.
20MünchKomm-Kötz, § 2 AGBG, Rn. 8.
21Soergel/Stein, § 2 AGB-Gesetz, Rn. 12; MünchKomm-Kötz, § 2 AGBG, Rn. 8.
22Erman/Hefermehl, Werner, § 2 AGBG, Rn. 7.
23Erman/Hefermehl, Werner, § 2 AGBG, Rn. 9, 10.
24Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 55, 56, Rn. 141 ff.
25 Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 56, Rn. 150.
26MünchKomm-Kötz, § 2 AGBG, Rn. 12.
27Palandt/Heinrichs, AGBG 2, Rn. 11; Staudinger/Schlosser, § 2 AGBG, Rn. 33.
28Soergel/Stein, AGB-Gesetz § 2, Rn. 19; MünchKomm-Kötz, § 2 AGBG, Rn. 14.
29Palandt/Heinrichs, AGBG 2, Rn. 13.
30Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 57, Rn. 152.
31Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, § 4 AGBG, Rn. 13;
Staudinger/Schlosser, § 4 AGBG, Rn. 19.
32Soergel/Sein, AGB-Gesetz § 4 , Rn. 6; MünchKomm-Kötz, § 4 AGBG, Rn. 3.
33AG Lübeck, VersR 1981, 627, Urt. v. 28.07.1980 - 14a C 94/80.
34OLG Karlsruhe, VersR 1984, 829, (839), Urt. v. 30.6.1983 - 12U 123/82.
35BGHZ 84, 268, (269f.), Urt. v. 16. Juni 1982 - Iva ZR 270/80.
36 BGH VersR 1986, 541, (542), Urt. v. 19.3.1986 - IVa ZR 182/84.
37Palandt/Heinrichs, AGBG 5, Rn. 8.
38Staudinger/Schlosser, § 2 AGBG, Rn. 46.
39Staudinger/Schlosser, § 2 AGBG, Rn. 47.
40Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 163, Rn. 471.
41 Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 152, Rn. 446ff.
42Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 70, Rn. 198.
43Waldenberger in: Handbuch Multimedia Recht 1999, Teil 13.4, Rn. 35ff.
44Waldenberger in: Handbuch Multimedia Recht 1999, Teil 13.4, Rn. 92.
45http://www.sakowski.de/onl-r/onl-r42.html.
46http://www-fernabsatzgesetz.de/datenbank/index.php3?snr=500.
47Ulmer/Brandner/Hensen - H. Schmidt, § 12 AGBG, Rn. 11; Moritz, CR 2000, Rn. 61, (65); Heinrichs, NJW 1999, 1596, (1599); Junker, RIW 1999, 809, (816).
48Löhnig, NJW 1997, 1688, (1689); Waldenberger, BB 1996, 2365, (2365); H. Köhler, NJW 1998, 185, (188).
49Mehrings, BB 1998, 2373, (2374).
50Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, § 2 AGBG, Rn. 24.
51Waldenberger in: Handbuch Multimedia Recht 1999, Teil 13.4, Rn. 39; Moritz, CR 2000, 61, (64).
52Löhnig, NJW 1997, 1688, (1689f.); Waldenberger, BB 1996, 2365, (2368); Ph. Köhler, MMR 1998, 289, (290); Moritz, CR 2000, 61, (64); Scherer, DB 2000, 1009, (1014); Kaiser/Voigt, K & R 1999, 445, (450).
53Mehrings, BB 1998, 2372 (2375).
54BGHZ 103, 275, (280), Urt. v. 24. Februar 1988 - VII ZR 145/87. BGH, NJW 1992, 1446, (1446/1447), Urt. v. 12.3.1992 - IX ZR 141/91.
55Ernst, NJW-CoR 1997, 165, (165); Ph. Köhler, MMR 1998, 289, (290); H. Köhler, NJW 1998, 185, (187); Waldenberger, BB 1996, 2365, (2365); Löhnig, NJW 1997, 1688, (1688); Rüßmann, K & R 1998, 129, (129).
56MünchKomm-Kramer, § 145, Rn. 8; Soergel-M.Wolf, § 145, Rn. 7.
57Mehrings, MMR 1998, 30, (31).
58Vgl. Mehrings, BB 1998, 2372, (2375).
59Ph. Koehler, MMR 1998, 289, (290); MünchKomm-Kötz, § 2 AGBG, Rn. 6.
60Mehrings, BB 1998, 2373, (2376); Ph. Koehler, MMR 1998, 289, (290).
61Palandt/Heinrichs, § 133 BGB, Rn. 1.
62Mehrings, BB 1998, 2374, (2375, 2376); Palandt/Heinrichs, § 133 BGB, Rn. 7.
63Brinkmann, BB 1981, 1183, (1189).
64BGH, NJW-RR 1987, 112, (113), Urt. v. 18.06.1986 - VIII ZR 137/85.
65Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, Einl., Rn. 42 i.V.m. § 2 AGBG, Rn. 19.
66 BGH, NJW-RR 1987, 112, (113), Urt. v. 18.06.1986 - VIII ZR 137/85.
67Paefgen, JuS 1988, 592, (595f.); Lachmann, NJW 1984, 405, (408); Brinkmann, BB 1981, 1183, (1189); Bartl, DB 1982, 1097, (1101); Wolf/Horn/Lindacher - Wolf, § 2 AGBG, Rn. 12.
68Vgl. Fußnote 57.
69Soergel/Stein, § 2 AGBG, Rn. 11; Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, § 2 AGBG, Rn. 30, 32.
70Ph. Koehler, MMR 1998, 289, (290), ebenso Soergel/Stein, § 2 AGBG, Rn. 11.
71So auch Ulmer/Brandner/Hensen - Ulmer, § 2 AGBG, Rn. 35a.
72Nähere Erläuterungen bei Mehrings, BB 1998, 2373, (2375, 2376).
73Waldenberger, BB 1996, 2365, (2368); Löhnig, NJW 1997, 1688, (1688, 1689); Mehrings, BB 1998, 2373, (2376); Ernst, BB 1997, 1057, (1057, 1058).
74Soergel-Stein, § 2 AGBG, Rn. 17.
75Ernst, JuS 1997, 776, (777); H. Köhler, NJW 1997, 185,(187).
76Bartl, DB 1982, 1097, (1101); Auerbach, CR 1988, 18, (22); LG Aachen, NJW 1991, 2159, (2160), Urt. v. 24.1.1991 - 6 S 192/90.
77OLG Köln, CR 1998, 244, (245), Urt. v. 21. Nov. 1997 - 19U 128/97.
78Wolf/Horn/Lindacher - Wolf, § 2 AGBG, Rn. 24.
79Mehrings, BB 1998, 2373, (2378); Waldenberger, BB 1996, 2365, (2368, 2369).
80Vgl. Waldenberger, BB 1996, 2365, (2368); Ernst, NJW-CoR 1997, 165, (167); Löhnig, NJW 1997, 1688, (1689).
81Mehrings, BB 1998, 2373, (2378); Ph. Koehler, MMR 1998, 289, (291).
82Wolf/Horn/Lindacher - Wolf, § 2 AGBG, Rn. 30; LG Freiburg, NJW-RR 1992, 1018, (1018), Urt. v. 7.4.1992 - 9S 139/90.
83Palandt-Heinrichs, § 2 AGBG, Rn. 13.
84Ph. Koehler, MMR 1998, 289, (291).
85So auch Mehrings, BB 1998, 2373, (2379)
86Löhnig, NJW 1997, 1688, (1689).
87Wolf/Horn/Lindacher - Anh. § 2 AGBG, Rn. 42; Erman/Hefermehl, Werner, § 2 AGBG, Rn. 7.
88Staudinger-Schlosser, § 2 AGBG, Rn. 4.
89Ulmer/Brandner/Hensen - Anh. § 2 AGBG, Rn. 18; Waldenberger, BB 1996, 2365, (2369); PH. Koehler, MMR 1998, 289, (293); i.E. auch BGH, NJW 1983, 1489, (1489), Urt. v. 10.3.1983 - VII ZR 302/82.
90Vgl. Hoppmann, ZfV 1999, 21, (21); Hoppmann/Moos, NVerZ 1999, 197, (197).
91Hoppmann/Moos, NVerZ 1999, 197, (199).
92Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 57, Rn. 152.
93Präve, VW 1992, 596; 1994, 556, (557, 558); Schirmer, DAR 1993, 321, (324); OLG München, NJW-RR 1992, 349, (350), Urt. v. 15.10.91 - 9U 1979/91; Bach/Geiger, VersR 1993, 659, (664); LG Frankfurt/M., NJW-RR 1992, 441, (442), Urt. v. 3.12.91 - 2/13 O 253/91 Schimikowski, R+S 1996, 1.
94Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 58/59, Rn. 154, 157;
95Wolf/Horn/Lindacher - Wolf, § 2 AGBG, Rn. 24. Schimikowski, R+S 1996, 1; Hoppmann/Moos, NVerZ 1999, 197, (199).
96Hoppmann/Moos, NVerZ 1999, 197, (199).
97http:://www.barkemeyer.de/versicherung.html
Hoppmann/Moos, NVerZ 1999, 197, (199).
98VerBAV 1999, S. 219.
99http://www.barkemeyer.de/versicherung.html;
Hoppmann/Moos, NVerZ 1999, 197, (199);
100Schimikowski, R+S 1996, 1, (4); Hoppmann/Moos, NVerZ 1999, 197, (200).
101http://www.barkemeyer.de/versicherung.html;
Hoppmann/Moos, NVerZ 1999, 197, (200).
102Fernabsatzrichtlinie 97/7/EG, ABIEG Nr. L 144 vom 4.6.1997, S. 00019-0027.
103Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG.
104Medicus, Bürgerliches Recht, S. 47, Rn. 71;
105Palandt/Heinrichs, Vorbem v. AGBG 8, Rn. 1;
106Medicus, Bürgerliches Recht, S. 47, Rn. 71
107Palandt/Heinrichs, Vorbem v. AGBG 8, Rn. 1;
108 Erman/Hefermehl, Werner, AGBG Vor § 10, Rn. 1.
109Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 117, Rn. 333.
110Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5.4.1993 über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen.
111Staudinger/Schlosser, § 9 AGBG, Rn. 1.
112Palandt/Heinrichs, Vorbem v AGBG 8, Rn. 1f; Staudinger/Schlosser, § 9, Rn. 1f.
113BGHZ 100, 158, (173), Urt. v. 12. März 1987 - VII ZR 37(86. NJW 93, 2369, (2369),
114Urt. v. 23.6.1993 - IV ZR 135/92. Palandt/Heinrichs, AGBG 8, Rn. 1;
115BGHZ 106, 42, (46), Urt. v. 24.November 1988 - III ZR 188/87. BGHZ 117, (119), Urt. v. 19. November 1991 - X ZR 63/90. BGH NJW 1992, 1753, (1754), Urt. v. 14.4.1992 - XI ZR 22/91.
116LG Stuttgart, VersR 1998, 1406, (1407), Urt. v. 22.9.1998 - 20 O 467/96. Heinrichs, NJW 1999, 1596, (1602).
117Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 119, Rn. 339.
118Zum Meinungsstand ausführlich: Präve, Versicherungsbedingungen und AGB Gesetz, S. 119ff., ab Rn. 341.
119BGH, VersR 1993, 830, (831), Urt. v. 21.4.1993 - IV ZR 33/92. BGH, VersR 1993, 957, (958), Urt. v. 23.6.93 - IV ZR 135/92.
120so auch Präve, Versicherungsbedingungen und AGB-Gesetz, S. 121, Rn. 352. Erman/Hefermehl, Werner, Vor § 10 AGBG, Rn. 1.
121Palandt/Heinrichs, Vorbem v. AGBG 8, Rn.1
122Palandt/Heinrichs, AGBG 10, Rn. 1.
123MünchKomm-Basedow, § 10 AGBG, Rn. 1.
124MünchKomm-Kötz, § 9 AGBG, Rn. 1.
125Palandt/Heinrichs, AGBG 9, Rn. 1.
126Wolf/Horn/Lindacher - Wolf, § 9 AGBG, Rn. 72.
127MünchKomm-Kötz, § 9 AGBG, Rn. 13.
128MünchKomm-Kötz, § 9 AGBG, Rn. 15.
129Palandt/Heinrichs, AGBG 9, Rn. 27.
130Wolf/Horn/Lindacher - Wolf, § 9 AGBG, Rn. 83.
131MünchKomm-Kötz, § 9 AGBG, Rn. 17.
132Wolf/Horn/Lindacher - Wolf, § 9 AGBG, Rn. 99.
133Dargestellt in Wolf/Horn/Lindacher - Wolf, § 9 AGBG, Rn. 100.
134Palandt/Heinrichs, AGBG 9, Rn. 6, 7.
135 MünchKomm-Kötz, § 9 AGBG, Rn. 2.
136MünchKomm-Kötz, Vor § 8 AGBG, Rn. 1.
137BVerwG, NJW 1998, 3216, (3216), Urt. v. 25.6.98 - 1A 6/96.
138Einzig ansprechend: Waldenberger in: Handbuch Multimedia Recht 1999, Teil 13.4, Rn. 50ff. / auch bei Auslandsbezug erwähnend von: Junker, RIW 1999, 809, (816).
139Dargestellt: Waldenberger in: Handbuch Multimedia Recht 1999, Teil 13.4., Rn. 52f.
140Waldenberger, BB 1996, 2365, (2369);
141BGH NJW-RR 1997, 112, (113), Urt. v. 18.6.1986 - VIII ZR 137/85.
142Soergel/Stein, § 2 AGBG, Rn. 18.
143http://www.victoria.de.
144http://www.huk24.de : Die HUK24 Online
Häufig gestellte Fragen zu Einbeziehung und Kontrolle von AGB bei Internet-Verträgen
Was sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)?
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die von einer Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Vertragsabschluss gestellt werden. Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) sind die AGB, die von Versicherungsunternehmen verwendet werden.
Gilt das AGB-Gesetz (AGBG) auch für Verträge im Internet?
Ja, das AGBG gilt grundsätzlich auch für Verträge, die im Internet geschlossen werden, sowohl innerhalb Deutschlands als auch im internationalen Geschäftsverkehr, wobei spezielle Regelungen des EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) und EU-Recht zu beachten sind.
Wie müssen AGB / AVB in einen Internetvertrag einbezogen werden, damit sie wirksam sind?
Für die wirksame Einbeziehung von AGB / AVB in einen Internetvertrag müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Hinweis: Der Verwender muss ausdrücklich auf die AGB hinweisen (z.B. durch einen deutlichen Link).
- Kenntnisnahme: Der Kunde muss die Möglichkeit haben, die AGB in zumutbarer Weise zur Kenntnis zu nehmen (z.B. durch Anklicken eines Links, der zu den AGB führt).
- Einverständnis: Der Kunde muss sich mit den AGB einverstanden erklären (z.B. durch Anklicken eines Kästchens oder Absenden einer Bestellung).
Gilt eine Webseite als Angebot oder als "invitatio ad offerendum"?
In der Regel gilt eine Webseite als "invitatio ad offerendum", d.h. als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Das Angebot geht somit vom Kunden aus, nicht vom Anbieter. Das bedeutet, dass der Anbieter das Angebot des Kunden annehmen muss, wobei er gegebenenfalls seine AGB einbeziehen kann (was einer Annahme unter Erweiterung gleichkommt).
Was passiert, wenn AGB / AVB nicht wirksam in den Vertrag einbezogen wurden?
Wenn AGB / AVB nicht wirksam in den Vertrag einbezogen wurden, bleibt der Vertrag grundsätzlich wirksam. Anstelle der AGB / AVB gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Im Versicherungsrecht kann § 5a VVG (Versicherungsvertragsgesetz) eine "Reparaturmöglichkeit" bieten, wonach die AVB unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich Vertragsbestandteil werden können.
Können AGB / AVB kontrolliert werden, auch wenn sie wirksam in den Vertrag einbezogen wurden?
Ja, auch wenn AGB / AVB wirksam in den Vertrag einbezogen wurden, können sie einer Inhaltskontrolle nach den §§ 8 ff. AGBG unterzogen werden. Dabei wird geprüft, ob die Klauseln den Kunden unangemessen benachteiligen. Es gibt bestimmte Klauselverbote (§§ 10, 11 AGBG) und eine Generalklausel (§ 9 AGBG), die zur Anwendung kommen können.
Wer kontrolliert AGB / AVB?
Die Kontrolle von AGB / AVB kann von verschiedenen Stellen durchgeführt werden, insbesondere von Gerichten im Rahmen von Streitigkeiten. Im Versicherungsbereich kann auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Überprüfung einleiten.
Welche Besonderheiten gibt es bei Versicherungsverträgen im Internet?
Bei Versicherungsverträgen im Internet gibt es besondere Herausforderungen im Hinblick auf die Einhaltung des Schriftformerfordernisses (z.B. § 10a VAG, § 5a VVG). Die AVB müssen dem Versicherungsnehmer in geeigneter Form zugänglich gemacht werden, was im Internet nicht immer einfach ist. Die geplante Umsetzung der EU-Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen soll diese Problematik entschärfen.
Was ist bei nachträglichen Änderungen von AGB / AVB zu beachten?
Nachträgliche Änderungen von AGB / AVB sind grundsätzlich nur mit Zustimmung des Kunden wirksam. Eine Klausel, die dem Verwender ein einseitiges Änderungsrecht einräumt, wäre in der Regel unzulässig. Der Kunde sollte sich die AGB / AVB zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausdrucken, um im Streitfall den Inhalt beweisen zu können.
Gibt es aktuelle Beispiele für Versicherungsunternehmen, die Verträge im Internet anbieten?
Einige Versicherungsunternehmen bieten bereits Verträge im Internet an, allerdings oft mit Zusatzvereinbarungen, um das Schriftformerfordernis zu erfüllen (z.B. die Verpflichtung des Kunden, die erforderlichen Unterlagen selbst auszudrucken). Andere Unternehmen bieten lediglich die Antragsstellung im Internet an, der eigentliche Vertragsabschluss erfolgt dann auf der Grundlage der Police.
- Arbeit zitieren
- Thorsten von Lennep (Autor:in), 2001, Die Einbeziehung und Kontrolle von Allgemeinen Versicherungsbedingungen im Internet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104020