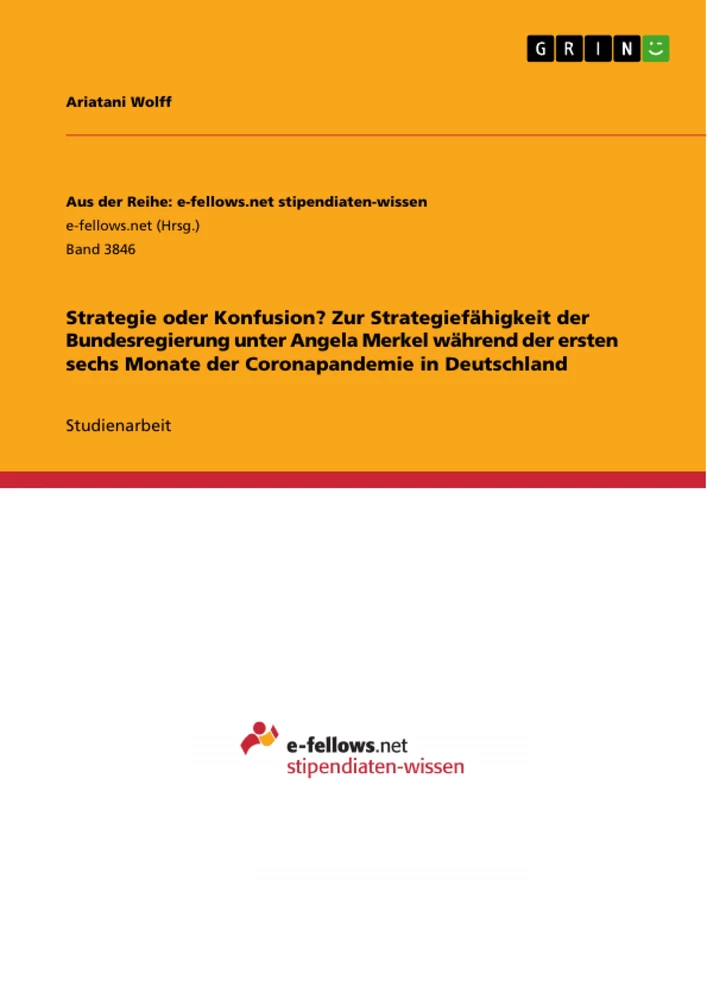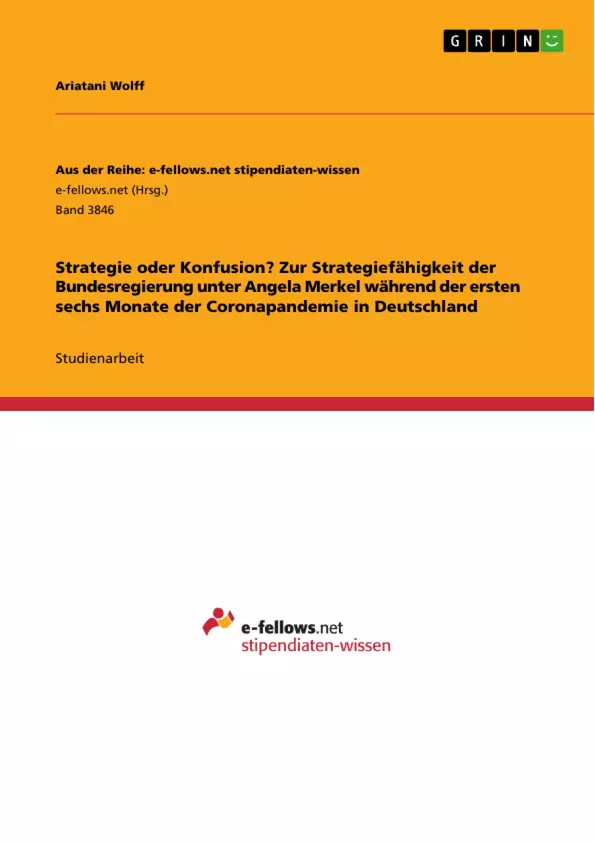In der Arbeit wird untersucht, inwiefern Bundeskanzlerin Angela Merkel fähig war, während der ersten Monate der Coronapandemie in Deutschland ein Strategisches Zentrum (im definitorischen Sinne von Raschke und Tils) aufzubauen und davon ausgehend die Pandemie wirksam und strategisch zu bearbeiten.
"Strategiefähigkeit ist ein entscheidendes Element der Politik. Ohne die geht nichts. Es ist nicht das Einzige. In kurzer Hand können auch strategisch schlechte Leute sehr wichtig und erfolgreich sein. Aber langfristig ist alles, was eine erfolgreiche Partei macht, in irgendeiner Weise mit Strategiefähigkeit verwoben." Fritz Kuhn bezieht sich in diesem Zitat zwar auf Parteien, seine Aussage kann jedoch auf andere strategische Kollektivakteure wie etwa die Bundesregierung übertragen werden. (Auch) ihr Erfolg ist eng mit Strategiefähigkeit verknüpft und wird insbesondere in Krisenzeiten auf die Probe gestellt.
Seit über einem Jahr befinden wir uns in solch einer Krise, denn die Coronapandemie hält die Welt in Atem und stellt nicht nur jeden einzelnen Menschen, sondern auch politische Systeme vor Herausforderungen gigantischen Ausmaßes. Es gilt gesundheitliche Risiken und wirtschaftliche Verluste gegenüber einander abzuwägen, soziale Verwerfungen zu vermeiden und kommunikative Brücken zu errichten, während die dynamische pandemische Situation durch ständig hinzugewonnene Informationen und neue Entwicklungen nach wie vor schwer einschätzbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HAUPTTEIL
- Teil I: Der politische Strategiebegriff & zugehörige Begrifflichkeiten
- Strategie(n)
- Ziel-Mittel-Umwelt-Kalkulationen
- Strategische Akteure
- Strategisches Handeln bzw. strategische Handlungen
- Teil II: Strategiefähigkeit der Bundesregierung in der Anfangsphase der Coronapandemie
- Das Orientierungsschema strategischen Denkens & Handelns
- Problempolitik am empirischen Beispiel der Coronapolitik des Bundes
- Begrenzungen des Handlungsspielraumes
- Abwägung zwischen verschiedenen Problemlösungslogiken
- Akteurinteraktionen im Entscheidungsfindungsprozess
- Politische Erfolgsfaktoren in der Coronapandemie
- Führung & Leadership
- Strategiefähigkeit
- Problemlösungs-Performanz
- Leistungen öffentlicher Kommunikation
- Teil I: Der politische Strategiebegriff & zugehörige Begrifflichkeiten
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Strategiefähigkeit der Bundesregierung unter Angela Merkel während der ersten sechs Monate der Coronapandemie in Deutschland. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Frage, inwiefern die Bundesregierung in dieser Phase ein strategisches Zentrum bilden und eine Strategie zur Pandemiebekämpfung etablieren konnte. Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Elementen des politischen Strategiebegriffs und analysiert, wie diese in der Anfangsphase der Coronapandemie Anwendung fanden. Dabei wird die Frage nach den Herausforderungen und Grenzen des Handlungsspielraumes der Bundesregierung in Bezug auf die Pandemiebekämpfung im Vordergrund stehen.
- Der politische Strategiebegriff und seine Anwendung in der Praxis
- Die Strategiefähigkeit der Bundesregierung in der Anfangsphase der Coronapandemie
- Die Herausforderungen und Grenzen des Handlungsspielraumes der Bundesregierung
- Die Relevanz von Führung und Kommunikation in der Krisenbewältigung
- Die Analyse der politischen Erfolgsfaktoren in der Coronapandemie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz von Strategiefähigkeit in Krisenzeiten. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die Bundesregierung in der Anfangsphase der Coronapandemie (Februar-Juni 2020) ein strategisches Zentrum bilden und eine Strategie zur Pandemiebekämpfung etablieren konnte.
- Teil I: Der politische Strategiebegriff & zugehörige Begrifflichkeiten: Dieser Teil definiert den politischen Strategiebegriff und seine Elemente. Die Arbeit bezieht sich dabei insbesondere auf die Forschungen von Prof. Dr. Joachim Raschke und Prof. Dr. Ralf Tils, welche die Bedeutung von Ziel-Mittel-Umwelt-Kalkulationen und strategischem Handeln im Kontext von Kollektivakteuren wie der Bundesregierung hervorheben.
- Teil II: Strategiefähigkeit der Bundesregierung in der Anfangsphase der Coronapandemie: Dieser Teil analysiert die Strategiefähigkeit der Bundesregierung in der Anfangsphase der Coronapandemie. Es werden die Herausforderungen und Grenzen des Handlungsspielraumes der Bundesregierung, die Abwägung zwischen verschiedenen Problemlösungslogiken und die Akteurinteraktionen im Entscheidungsfindungsprozess diskutiert. Der Teil beleuchtet auch die politischen Erfolgsfaktoren, die in der Coronapandemie eine Rolle spielen, wie z.B. Führung, Kommunikation und Problemlösungs-Performanz.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des politischen Strategiebegriffs, der Strategiefähigkeit der Bundesregierung, der Coronapandemie, dem Krisenmanagement, der politischen Kommunikation und der Erfolgsfaktoren im Krisenmanagement. Wichtige Konzepte in der Arbeit sind die Ziel-Mittel-Umwelt-Kalkulationen, strategisches Handeln, Akteurinteraktionen, Führung und Leadership.
- Quote paper
- Ariatani Wolff (Author), 2021, Strategie oder Konfusion? Zur Strategiefähigkeit der Bundesregierung unter Angela Merkel während der ersten sechs Monate der Coronapandemie in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040226