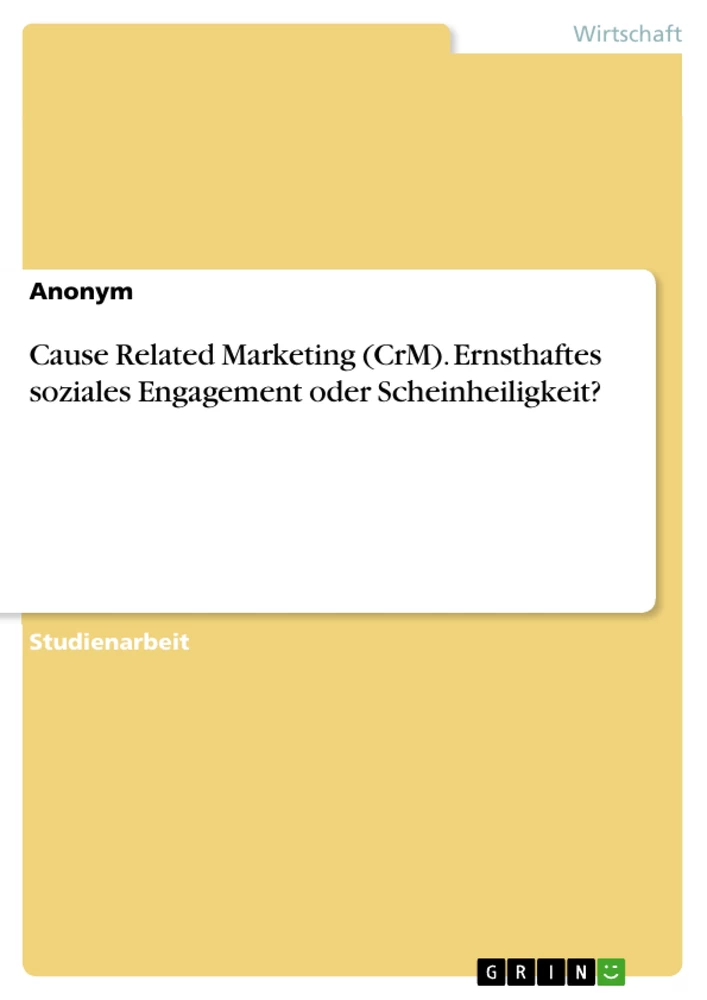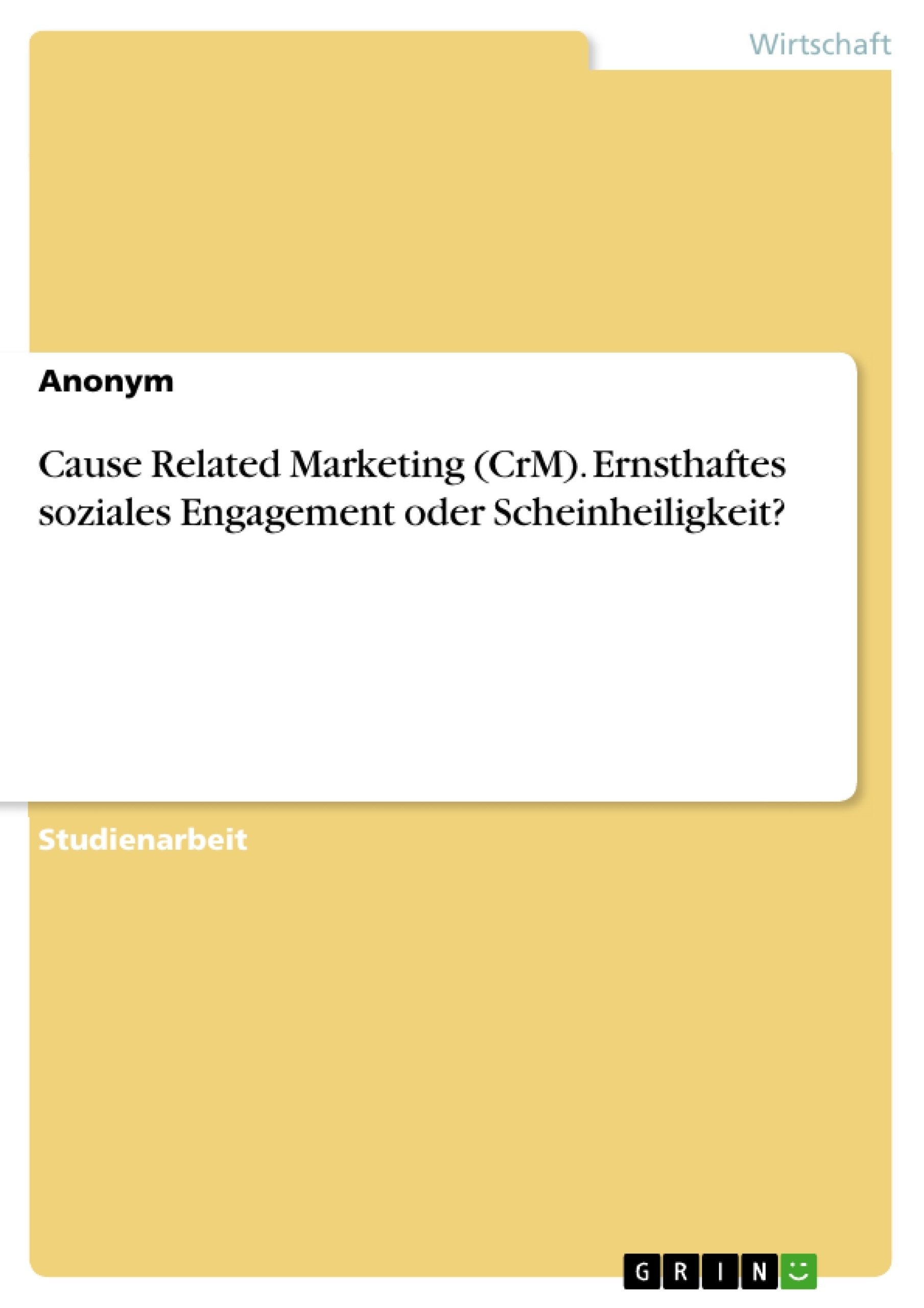Wird Cause Related Marketing tatsächlich aus reinem sozialem Engagement eingesetzt oder handelt es sich nur um eine scheinheilige Fassade, um den Erfolg des Unternehmens voranzutreiben? Nachdem der Begriff „Cause Related Marketing“ näher definiert wurde, wird aufgezeigt, inwiefern sich die Maßnahme für die beteiligten Geschäftspartner als vorteilhaft erwies. Welcher Kritik die Unternehmensstrategie ausgesetzt ist, wird im nächsten Kapitel erläutert.
Im Anschluss wird aufgezeigt, welche Bedingungen zum Erfolg eines CrM-Konzeptes führen und gleichzeitig dessen Glaubwürdigkeit erhöhen. Nachdem zwei Praxisbeispiele genannt werden, werden diese anhand der Erfolgsbedingungen fokussiert analysiert und bewertet. Es soll exemplarisch aufgezeigt werden, inwieweit die drei Ansätze ernsthaft genutzt werden bzw. ob es Anzeichen dafür gibt, dass es sich bei der Spendenaktion um reine Fassade handelt.
„Kaufen Sie unser Produkt und Sie spenden damit automatisch 1€ an die Hilfsorganisation X.“ Nicht selten werden Kundinnen und Kunden bei ihrem Einkauf mit derartigen Werbekampagnen konfrontiert. „Kaufen für den guten Zweck“, lautet die Botschaft, die hinter sogenannten Cause Related Marketing (CrM) Maßnahmen steckt und Käuferinnen und Käufer dazu anregt, aus sozialem Interesse und Hilfsbereitschaft ein bestimmtes Produkt zu erwerben. Doch was bezwecken die Hersteller mit derartigen Kampagnen? Steckt reines soziales Engagement dahinter? Oder trügt der Schein und die Unternehmen nutzen CrM lediglich als Marketingstrategie, um den Unternehmenserfolg voranzutreiben? Wird das Versprechen einer Spende überhaupt eingehalten? Und wie erfolgreich sind derartige Kampagnen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition und Bedeutung von Cause Related Marketing
- Chancen vs. Kritik
- Chancen
- Chancen für Unternehmen
- Chancen für Non-Profit-Organisationen
- Kritik
- Chancen
- Erfolgsbedingungen eines glaubwürdigen Cause Related Marketings
- Cause Related Marketing in der Praxis
- Beispiel 1: Tchibo unterstützt Kinder und Jugendliche aus Kaffeeanbauregionen
- Beispiel 2: Fluggesellschaft LTU unterstützt den Erhalt des Regenwaldes
- Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Cause Related Marketing anhand ausgewählter Praxisbeispiele
- Beurteilung Beispiel 1: Tchibo unterstützt Kinder und Jugendliche aus Kaffeeanbauregionen
- Beurteilung Beispiel 2: Fluggesellschaft LTU unterstützt den Erhalt des Regenwaldes
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Phänomen des Cause Related Marketing (CrM) und hinterfragt dessen Glaubwürdigkeit. Sie analysiert die Chancen und Kritikpunkte dieser Marketingstrategie sowie die Erfolgsbedingungen für ein glaubwürdiges CrM-Konzept.
- Begriffsdefinition und Bedeutung von Cause Related Marketing
- Chancen von CrM für Unternehmen und Non-Profit-Organisationen
- Kritikpunkte an CrM und potenziellen Fallstricken
- Erfolgsbedingungen für ein glaubwürdiges CrM-Konzept
- Analyse und Beurteilung von CrM-Beispielen in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Cause Related Marketing ein und stellt die Forschungsfrage nach der tatsächlichen Motivation hinter CrM-Strategien. Kapitel 2 beleuchtet die Definition von CrM und zeigt dessen Bedeutung im Kontext von Corporate Social Responsibility auf. In Kapitel 3 werden Chancen und Kritikpunkte von CrM diskutiert, wobei sowohl Vorteile für Unternehmen als auch für Non-Profit-Organisationen hervorgehoben werden.
Kapitel 4 analysiert die Erfolgsbedingungen eines glaubwürdigen CrM-Konzeptes. In Kapitel 5 werden zwei Praxisbeispiele von CrM-Kampagnen vorgestellt: die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Kaffeeanbauregionen durch Tchibo und die Initiative der Fluggesellschaft LTU zum Erhalt des Regenwaldes.
In Kapitel 6 werden die beiden Praxisbeispiele anhand der Erfolgsbedingungen aus Kapitel 4 analysiert und bewertet. Die Analyse zielt darauf ab, die tatsächliche Motivation der Unternehmen hinter den CrM-Kampagnen zu ergründen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Cause Related Marketing (CrM), Corporate Social Responsibility (CSR), Non-Profit-Organisation (NPO), Glaubwürdigkeit, Erfolgsbedingungen, Praxisbeispiele, Tchibo, LTU, Regenwald, Kinder- und Jugendschutz, Nachhaltigkeit.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Cause Related Marketing (CrM). Ernsthaftes soziales Engagement oder Scheinheiligkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040274