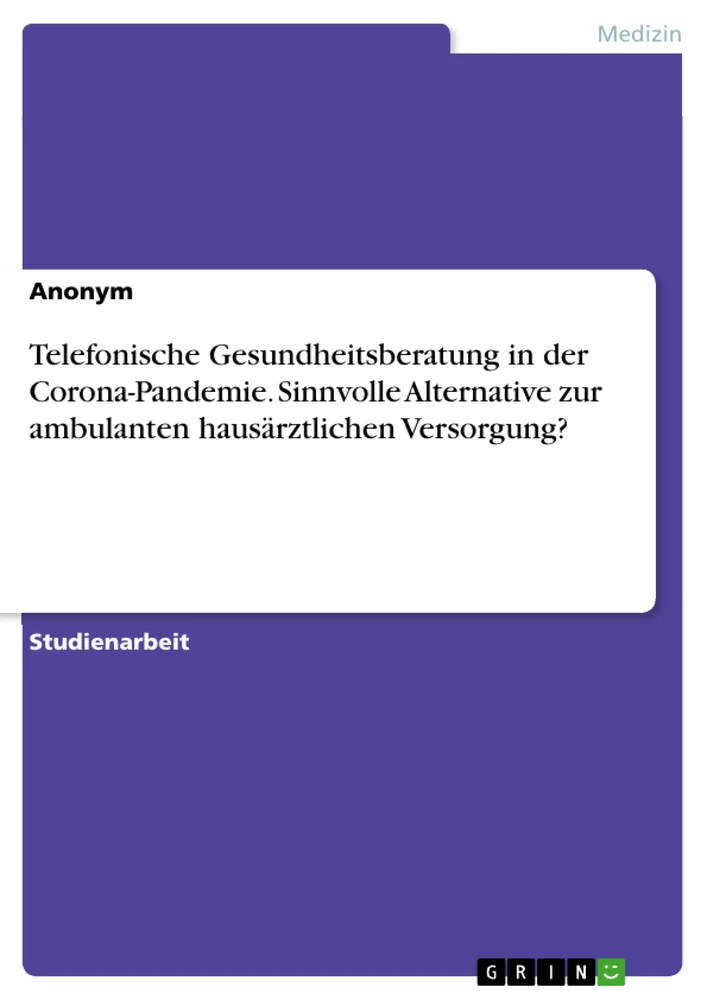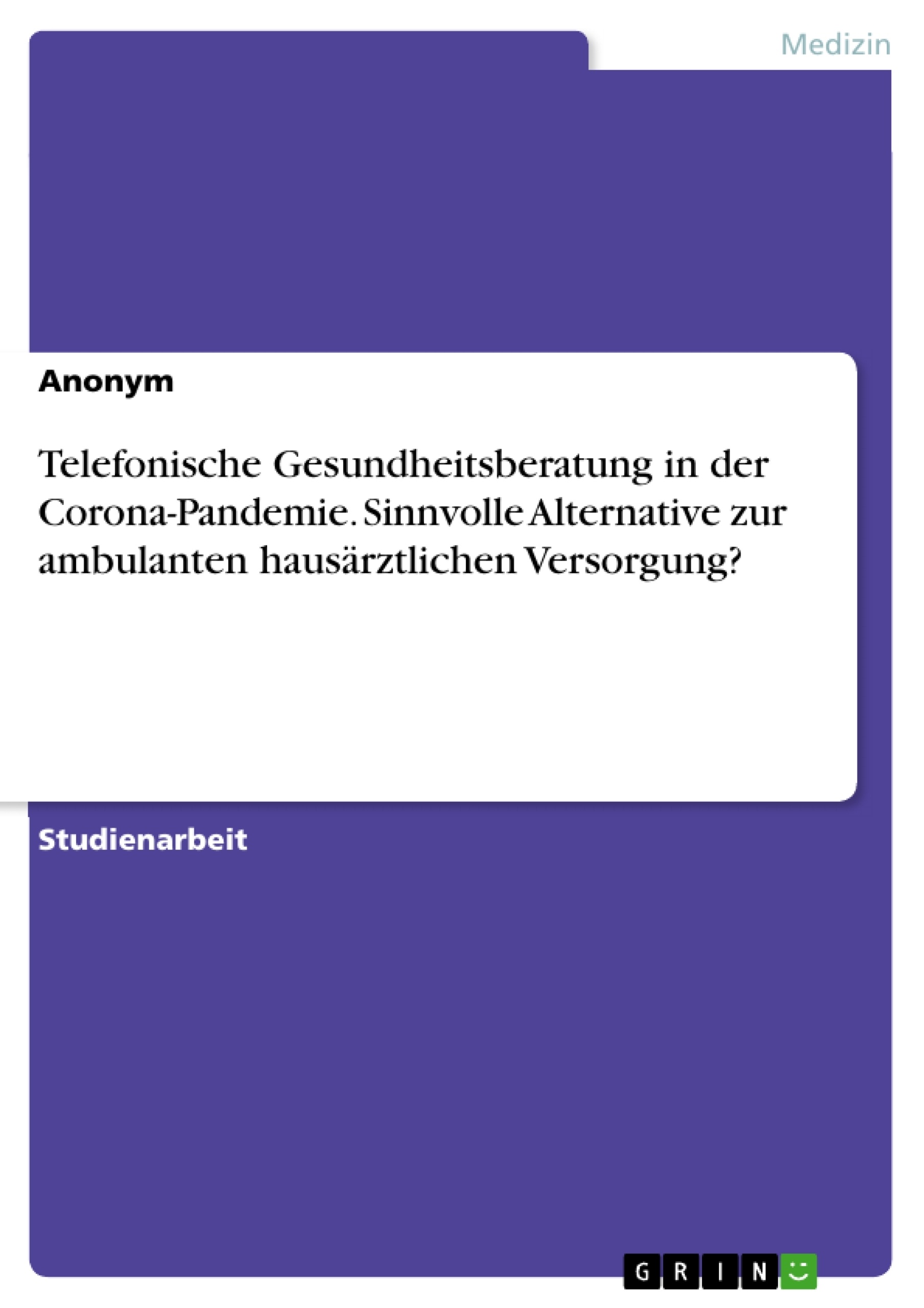Stellt die telefonische Gesundheitsberatung eine sinnvolle Alternative zur ambulanten hausärztlichen Versorgung in Deutschland zu Zeiten der Corona-Pandemie dar? Zu Beginn werden die drei zentralen Begrifflichkeiten dieser Ausarbeitung zum besseren Verständnis der nachfolgenden Argumentationen erläutert. Dabei handelt es sich um die hausärztliche Versorgung an sich, die Corona-Pandemie sowie das Konzept der telefonischen Gesundheitsberatung, wobei das zweite Unterkapitel weiter unterteilt wird in allgemeine Eckdaten der Krise sowie bisherige Beschlüsse zur ambulanten Versorgung.
Anschließend wird die telefonische Gesundheitsberatung detaillierter aufgegriffen und der konkrete Anwendungsprozess erläutert. Im Rahmen dieses Kapitels sollen auch essentielle Vorgehensweisen wie beispielsweise zur Verordnung verschreibungspflichtiger Medikamente oder zur Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aufgegriffen werden. Nachfolgend werden die Vor- und Nachteile dieses modernen Konzeptes gegenüber der herkömmlichen Methode des Praxisbesuchs erörtert.
Die aktuell weltweit verbreitete Corona-Pandemie des 21. Jahrhunderts erweist sich derzeit als größter Diskussionspunkt der Politik und stellt diese vor die anspruchsvolle Herausforderung, für die bestmögliche Gesunderhaltung der Bevölkerung zu sorgen. Die Pandemie beeinflusst nicht nur die Wirtschaft im Allgemeinen, sondern auch das alltägliche Leben eines jeden einzelnen Menschen. Gerade in Hausarztpraxen besteht ein hohes Infektionsrisiko, da täglich viele Menschen ein und aus gehen und die Corona-Erkrankung vielfältige Symptome mit sich bringt, die oftmals nicht direkt erkannt werden bzw. nicht sofort mit dem gefährlichen Virus in Verbindung gebracht werden. Daher stellt sich die Frage, ob nicht auch für den Bereich der hausärztlichen Versorgung ein umfangreicheres Konzept, als die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen, in Erwägung gezogen werden könnte, um das Ansteckungsrisiko im Rahmen des Arztbesuches zu vermindern.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffe und Fakten
- 2.1 Die ambulante hausärztliche Versorgung
- 2.2 Die Corona-Pandemie
- 2.2.1 Die wichtigsten Fakten
- 2.2.2 Bisherige Maßnahmen im ambulanten Bereich
- 2.3 Die telefonische Gesundheitsberatung
- 3 Die telefonische Gesundheitsberatung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung
- 4 Chancen und Grenzen der telefonischen Gesundheitsberatung
- 4.1 Chancen
- 4.2 Grenzen
- 5 Zusammenfassung und Fazit: Telefonische Gesundheitsberatung vs. persönliche ärztliche Begutachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Rolle der telefonischen Gesundheitsberatung als Alternative zur ambulanten hausärztlichen Versorgung im Kontext der Corona-Pandemie. Die Arbeit untersucht, ob und inwiefern die telefonische Beratung eine sinnvolle und effektive Lösung für die Herausforderungen darstellt, die die Pandemie für die Gesundheitsversorgung mit sich bringt.
- Bedeutung der ambulanten hausärztlichen Versorgung in der Primärversorgung
- Herausforderungen der Corona-Pandemie für die ambulante Versorgung
- Potenziale und Grenzen der telefonischen Gesundheitsberatung
- Bewertung der telefonischen Beratung als Alternative zur persönlichen ärztlichen Begutachtung
- Ethische und rechtliche Aspekte der telefonischen Gesundheitsberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage: Stellt die telefonische Gesundheitsberatung eine sinnvolle Alternative zur ambulanten hausärztlichen Versorgung in Deutschland zu Zeiten der Corona-Pandemie dar?
Kapitel 2 beleuchtet die drei zentralen Begriffe der Ausarbeitung: die ambulante hausärztliche Versorgung, die Corona-Pandemie und die telefonische Gesundheitsberatung. Kapitel 2.1 erklärt die Rolle der Hausarztpraxis in der Primärversorgung. Kapitel 2.2 stellt die wichtigsten Fakten und Maßnahmen der Pandemie im ambulanten Bereich dar. Kapitel 2.3 beschreibt die Funktionsweise der telefonischen Gesundheitsberatung.
Kapitel 3 untersucht die praktische Anwendung der telefonischen Gesundheitsberatung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung.
Kapitel 4 bewertet Chancen und Grenzen der telefonischen Gesundheitsberatung als Alternative zur persönlichen ärztlichen Begutachtung.
Schlüsselwörter
Telefonische Gesundheitsberatung, ambulante hausärztliche Versorgung, Corona-Pandemie, Primärversorgung, Chancen und Grenzen, Telemedizin, digitale Gesundheitsversorgung, Ethische und rechtliche Aspekte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Telefonische Gesundheitsberatung in der Corona-Pandemie. Sinnvolle Alternative zur ambulanten hausärztlichen Versorgung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040281