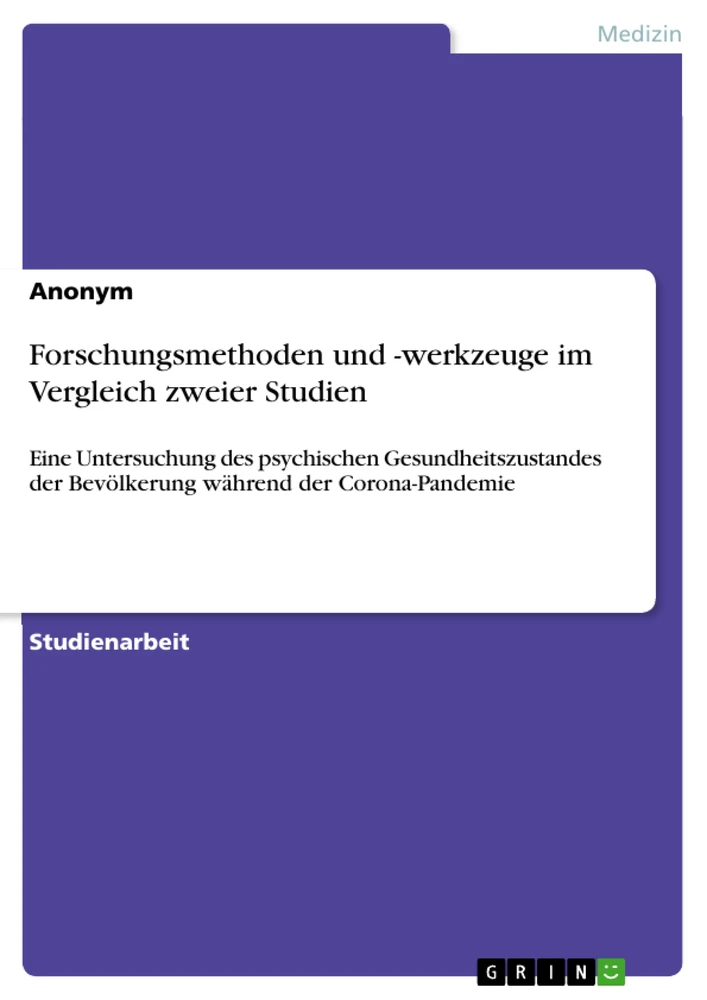Die Frage nach dem psychischen Gesundheitszustand der Bevölkerung ist zu Zeiten der Corona-Pandemie besonders essentiell. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird anhand von zwei Studienbeispielhaft dargestellt, wie die genannte Thematik untersucht werden kann. Die beiden Studien werden anhand ihrer Fragestellung, ihres methodischen Vergehens sowie ihrer Datenanalyse und -interpretation analysiert und anschließend miteinander verglichen.
Die derzeit weltweit verbreitete Corona-Pandemie bringt nicht nur enorme Herausforderungen für Politik und Wirtschaft mit sich, sondern beeinflusst auch das alltägliche Leben eines jeden einzelnen Menschen. Durch die Kontaktbeschränkungen und die begrenzten Freizeitmöglichkeiten ist die Bevölkerung in ihrer Lebensführung stark eingeschränkt. Unzählige Aktivitäten, die den Menschen Freude bereiten und für viele von ihnen einen Ausgleich zum Arbeitsalltag darstellen, sind derzeit untersagt, seien es Gastronomiebesuche, ausgelassene Abende in Diskotheken, Shopping-Trips, das Besuchen von Freizeitparks oder auch das Veranstalten von privaten Feiern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erläuterung der Studienauswahl
- Fragestellungen
- Studie 1
- Studie 2
- Methodisches Vorgehen
- Studie 1
- Studie 2
- Datenanalyse und -interpretation
- Studie 1
- Studie 2
- Vergleich beider Studien
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung analysiert zwei Studien, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den psychischen Gesundheitszustand der Bevölkerung auseinandersetzen. Ziel ist es, die beiden Studien anhand ihrer Fragestellungen, methodischen Vorgehensweisen und Datenanalysen zu vergleichen und so einen Einblick in verschiedene Forschungsansätze zu gewinnen.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung.
- Die Herausforderungen in der psychiatrischen Versorgung während der Pandemie.
- Die Relevanz von Forschung in Bezug auf die psychischen Folgen der Corona-Pandemie.
- Der Vergleich verschiedener Forschungsmethoden und -werkzeuge.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik der psychischen Gesundheit in Zeiten der Corona-Pandemie dar und erläutert die Zielsetzung der Ausarbeitung. Es wird auf die beiden Studien hingewiesen, die im Folgenden analysiert werden.
Erläuterung der Studienauswahl
Dieses Kapitel präsentiert die beiden ausgewählten Studien, „Psychisch krank in Krisenzeiten: Subjektive Belastungen durch COVID-19" von Frank et al. (2020) und „Anstieg der Suchtpatienten in der Notfallversorgung während der Corona-Pandemie" von Sobetzko et al. (2021). Die Relevanz der Studien wird durch die Aktualität der Thematik begründet.
Fragestellungen
Die Fragestellungen der beiden Studien werden detailliert dargestellt. Die Studie 1 untersucht die Auswirkungen der Corona-Krise auf den subjektiven Gesundheitszustand von Personen mit vorbestehenden psychischen Erkrankungen. Die Studie 2 fokussiert sich auf den Anstieg der Suchtpatienten in der psychiatrischen Notfallversorgung während der Pandemie.
Methodisches Vorgehen
Dieses Kapitel beschreibt die Methoden, die in den beiden Studien angewendet wurden, um die jeweiligen Fragestellungen zu beantworten. Es werden die Forschungsdesigns, Datenerhebungsmethoden und Stichproben beschrieben.
Datenanalyse und -interpretation
Die Ergebnisse der Studien werden zusammengefasst und interpretiert. Es wird dargestellt, welche Erkenntnisse die Studien hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung liefern.
Vergleich beider Studien
In diesem Kapitel werden die beiden Studien hinsichtlich ihrer Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse verglichen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt und die Bedeutung der Ergebnisse für die Forschung und Praxis diskutiert.
Schlüsselwörter
Corona-Pandemie, psychische Gesundheit, psychiatrische Versorgung, Suchtpatienten, Notfallversorgung, Forschungsmethoden, Vergleich, Datenanalyse, Interpretation.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Forschungsmethoden und -werkzeuge im Vergleich zweier Studien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040285