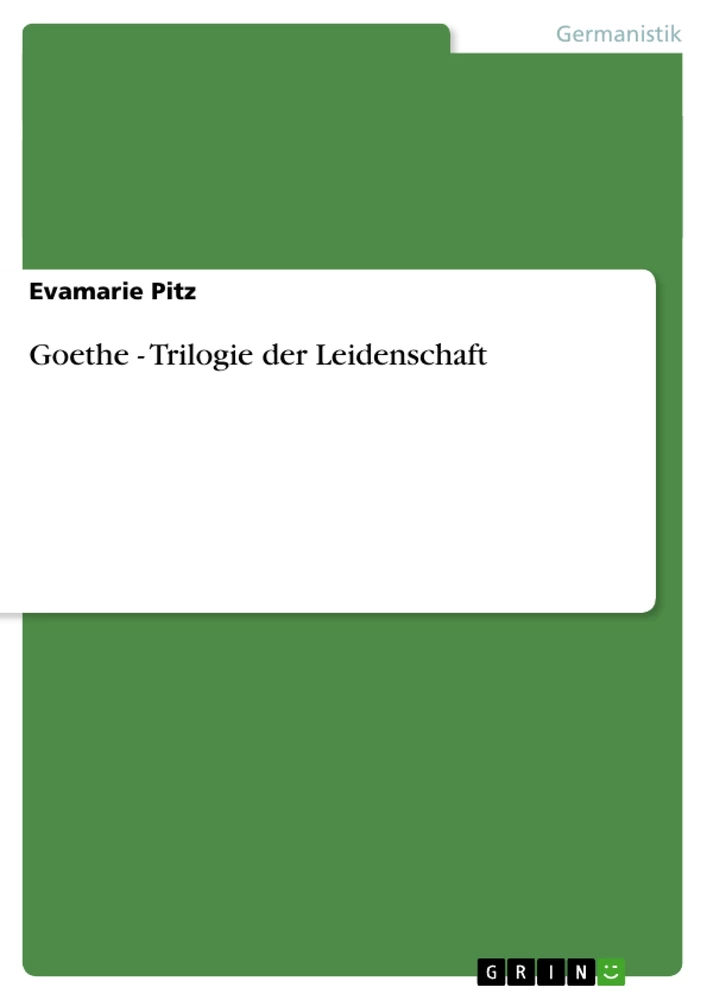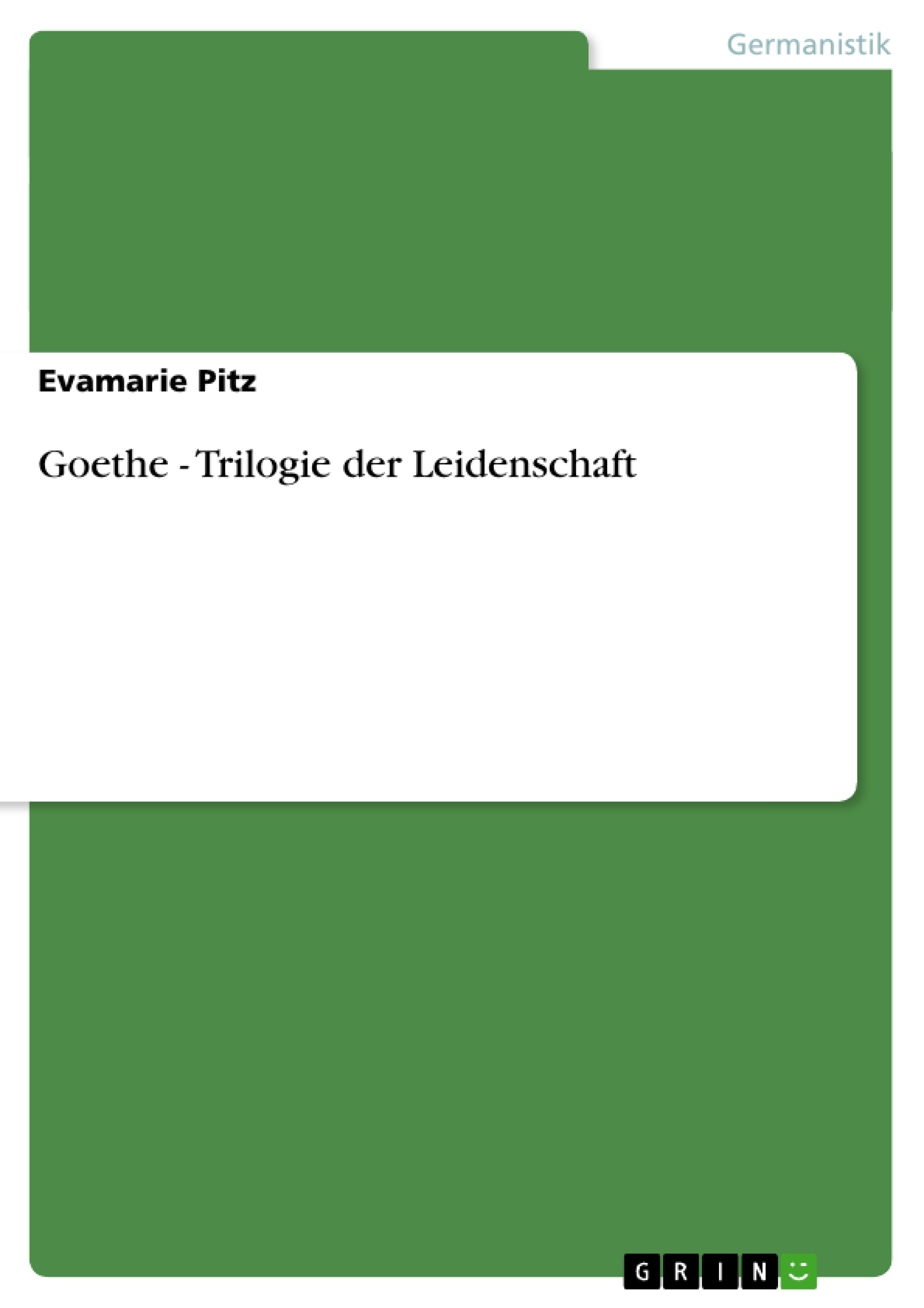J.W. Goethe: Trilogie der Leidenschaft
Referat: Konzentration auf die Elegie als Kernstück der Trilogie
I. Versuch einer poetologischen Deutung der Elegie ausgehend von
Mathias Mayer: Dichten zwischen Paradies und Hölle. Anmerkung zur poetologischen Struktur von Goethes Elegie von Marienbad (in: Zeitschrift für deutsche Philologie 105 [1986])
Grundidee/These: die Elegie als dichterische Klage auf das Dichten, Gedicht gegen die
Dichtung
der Elegie vorangestellt das Motto aus dem Tasso - vgl. Sitzung über 2. Sonette: Selbstzitat als Bewußtmachen von Dichtung
Motto (Torquato Tasso):
Tasso ist leidender Dichter, der mit den Konventionen der höfischen Gesellschaft in Konflikt steht und erkennen muß, daß die Kunst von der Gesellschaft vollkommen getrennt ist. Seine Liebe zur Prinzessin bleibt unerfüllt.
Goethe nannte ihn den „gesteigerten Werther“.
Motto Frage, inwiefern (in der Elegie) die Qual den Dichter zum Sprechen bringt, während der nicht dichterisch begabte im Leid stumm bleibt
damit Differenz zwischen nicht-dichterischem Mensch und Dichter aufgestellt
Mayer argumentiert:
Dichtung (Liebesdichtung im Speziellen) ist nur als Ausdruck des Leides möglich - setzt Trennung vom geliebten Gegenüber voraus Gedicht verdankt sich dem Umstand des Nachher = das Selbstverständliche jeder Dichtung
in der Elegie: die Dichtung wird des Selbstverständlichen beraubt, indem es bewußt gemacht wird
½ das Selbstverständliche wird zur schmerzlichen Bewußtheit als Elegie gestaltet und auch:
Klage über die abwesende Geliebte wird zur Reflexion auf das dadurch erst mögliche Dichten
zentrales Element Paradiesmetapher:
Zusammentreffen mit der Geliebten fällt mit einem paradiesischen Zustand zusammen (Strophe 1, letzte beiden Verse, auch formell herausgestellt: einzige männliche Reime in der Elegie)
dazu 1. Mose 3. (nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben):
7. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, daß sie nackt waren; und flochten Feigenblätter zusammen und flochten sich Schürze.
Das Verhör
8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten.
9. Und Gott der Herr rief Adam, und sprach zu ihm: Wo bist du?
10. Und er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten, und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.
Dann Vertreibung aus dem Paradies
Vertreibung aus dem Paradies als Übergang vom unbewußten zum bewußten Zustand; Verlust des paradiesischen Zustands des Glücks läßt erst ein Bewußtsein dafür entstehen
vgl. dazu Kopie von Werther, 2. Textpassage Paradies- oder Erkenntnismetaphorik auf den Zustand von geistiger Umnachtung und geistiger Gegenwärtigkeit übertragen vom Aufenthalt im Paradies kann nicht im Präsenz die Rede sein (Strophe 2, Vers 7: So warst du denn im Paradies empfangen - „warst“, nicht „wurdest“ oder „bist“)
Paradies ist unbewußter Zustand zur Dichtung ist die Abwesenheit des paradiesischen Zustandes nötig (also die Vertreibung aus dem Paradies und damit die Erkenntnis)
Dichter hat erst dann die Gabe des Sagens, wenn er aus dem Paradies (Liebesgegenwart) ins Bewußtsein von Trennung und Abwesenheit vertrieben ist (auch wenn er vorzugsweise beklagt, was er verloren hat) Dichtung benötigt die Abwesenheit des paradiesischen Zustandes
außerdem: Vertreibung aus dem Paradies löst Sehnsucht nach dem Paradies aus und verursacht Schmerz
ganze Elegie drückt den Versuch aus, den Schmerz der Trennung von der Geliebten zu überwinden erste Strophe (und letzte beiden) ursprünglich abgesetzt mit Zierschnörkeln,
d.h. (2. Strophe)
nach der Vertreibung aus dem Paradies (=Abschied von der Geliebten) in der Elegie findet Einbruch der Zeitlichkeit statt
Vertreibung / Abschied von der Geliebten Strophe 4 nach dem letzten Kuß:
Weg zurück ins Paradies wird bei Moses von den Cherubim mit ihren Schwertern verhindert; hier auch deutlicher Gliederungsabschnitt im Gedicht: Zustand, der das Dichten begründet, ist erreicht
nur Ankündigung oder Erinnerung der Gegenwart, nicht der paradiesische Augenblick selbst kann ins Wort gefaßt werden Strophe 6: Mensch, aus dem Paradies vertrieben, muß sich seiner selbst in der Natur vergewissern
erkennt sich selbst im Gegenüber, in der Natur
Geliebte als Wolke auf mehreren Ebenen deutbar
sicherlich lesbar als Vermittlung zwischen Himmel und Erde
Paradies und Welt
Seraphim = (bei Jesaja 6) sechsflüglige Wesen, die über dem Thron Gottes schweben und Jesaja zum Propheten ernennen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus des Referats über Goethes "Trilogie der Leidenschaft", insbesondere der "Elegie"?
Der Fokus liegt auf der poetologischen Deutung der Elegie als Kernstück der Trilogie, insbesondere im Kontext von Mathias Mayers Analyse "Dichten zwischen Paradies und Hölle". Das Referat konzentriert sich auf die Elegie als dichterische Klage über das Dichten selbst, quasi ein Gedicht gegen die Dichtung.
Welches Motto wird der "Elegie" vorangestellt und woher stammt es?
Das Motto stammt aus Goethes "Torquato Tasso". Es wird als Selbstzitat genutzt, um das Bewusstsein von Dichtung hervorzuheben.
Wer ist Torquato Tasso und in welcher Beziehung steht er zur Thematik der "Elegie"?
Torquato Tasso ist ein leidender Dichter, der in Konflikt mit den Konventionen der höfischen Gesellschaft steht und die Trennung von Kunst und Gesellschaft erkennt. Goethe bezeichnete ihn als den "gesteigerten Werther". Das Motto aus "Tasso" wirft die Frage auf, inwiefern Leid den Dichter zum Sprechen bringt, im Gegensatz zum nicht-dichterisch begabten Menschen, der im Leid stumm bleibt.
Was ist die Grundidee von Mathias Mayers Analyse der "Elegie"?
Mayer argumentiert, dass Dichtung (insbesondere Liebesdichtung) nur als Ausdruck des Leidens möglich ist, was eine Trennung vom geliebten Gegenüber voraussetzt. Das Gedicht verdankt sich dem "Nachher". In der Elegie wird dieses Selbstverständliche der Dichtung bewusst gemacht.
Welche Rolle spielt die Paradiesmetapher in der "Elegie"?
Das Zusammentreffen mit der Geliebten wird mit einem paradiesischen Zustand verglichen. Die Vertreibung aus dem Paradies (analog zu 1. Mose 3) wird als Übergang vom unbewussten zum bewussten Zustand interpretiert; der Verlust des paradiesischen Glücks lässt erst ein Bewusstsein dafür entstehen. Dichtung ist demnach erst durch die Abwesenheit des paradiesischen Zustandes möglich.
Inwiefern beeinflusst die Vertreibung aus dem Paradies die Dichtung?
Die Vertreibung aus dem Paradies löst Sehnsucht und Schmerz aus, was die Grundlage für die Dichtung bildet. Der Dichter kann erst dann sprechen, wenn er aus dem Paradies (Liebesgegenwart) in das Bewusstsein von Trennung und Abwesenheit vertrieben ist.
Welche Bedeutung hat die Zeitlichkeit in der "Elegie"?
Nach der Vertreibung aus dem Paradies (Abschied von der Geliebten) findet ein Einbruch der Zeitlichkeit statt.
Was symbolisiert die Wolke in der "Elegie"?
Die Geliebte als Wolke kann auf verschiedenen Ebenen gedeutet werden, insbesondere als Vermittlung zwischen Himmel und Erde, Paradies und Welt.
Welche Verbindung besteht zwischen der "Elegie" und Goethes "Faust II"?
Der Bezug zu Helena und Gretchen in "Faust II" dient als Hinweis darauf, dass die Thematik kein Einzelfall in Goethes Werk ist, obwohl "Faust II" erst nach der "Elegie" entstand.
- Quote paper
- Evamarie Pitz (Author), 2000, Goethe - Trilogie der Leidenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104030