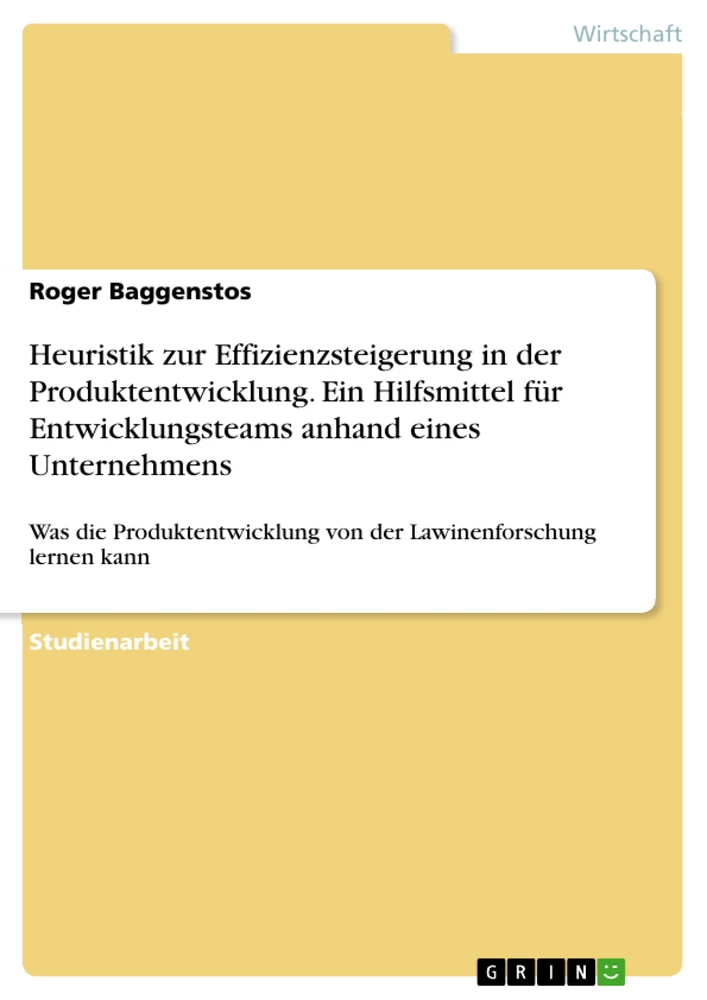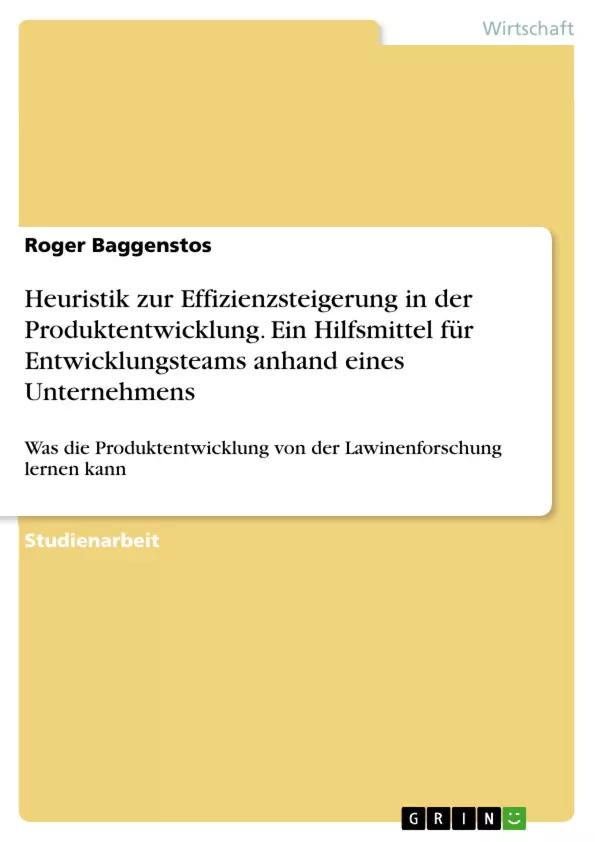Die Geberit, als Pionier in der Sanitärbranche, bringt jährlich neuartige Produkte auf den Markt. Als Vorreiter (First Mover) ist nachteilig, dass keine Wettbewerbsprodukte zur Orientierung für Entscheidungen herangezogen werden können. In der Produktenwicklung werden bereits heute bewusst oder unbewusst heuristische Entscheide getroffen.
Diese Arbeit hat die Zielsetzung, dass durch explizite Anwendung heuristischer Ansätze die Time-To-Market gekürzt werden kann ohne dabei den Wettbewerbsvorsprung zu verringern. Letztlich soll dazu ein Hilfsmittel für Produktenwickler geschaffen werden, das im Alltag eingesetzt werden kann.
Als Grundlage dient die Studie von McCammon (2004) über Lawinenunfälle in den USA, welche von Loebner (2018) für den Anlagen- und Maschinenbau-Konstruktion abgeleitet wurde. Im letzten Schritt ist die Ableitung auf Chancen und Risiken für die Produktentwicklung der Geberit International AG beurteilt worden.
Als Ergebnis ist der "Avalanche-Check" entstanden der neben der Fehlervermeidungsseite (Heuristische Fallen) auch eine Beschleunigungsseite hat. Der Check ist noch mit vielen Unsicherheiten behaftet, weshalb die Antwort auf die Fragestellung der Arbeit nicht abschließend beantwortet werden kann. Als unmittelbare und unkomplizierte Maßnahme, kann die Empfehlung gemacht werden, dass die Lawinenstudie sowie deren Ableitung in die Konstruktion, zur Sensibilisierung der Produktenwicklung, in Form eines Vortrags mit betriebseigenen Beispielen zugänglich gemacht werden sollte. Wenn damit bereits in der Entwicklung ein potenzieller Folgefehler entdeckt werden würde, würde sich der Aufwand um ein Mehrfaches rechnen.
Inhaltsverzeichnis
-
- Anwendung und Bedeutung der Heuristik in der Geberit
- Die heuristische Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
- Die Geberit Gruppe
- Die Herausforderung als Pionier
- Das Aufwand-Ertrags-Dilemma in der Produktentwicklung
- Hohe Kosten oder ein Mehrwert für die Kunden
- Mit dem Avalanche-Check die Time-To-Market kürzen und Folgekosten einsparen
- Was Lawinenunfälle mit der Produktkonstruktion zu tun haben
- Ableitung der \"Lawinen-Heuristiken\" auf die Produktentwicklung
- Anwendung der \"Lawinen-Heuristiken\" in die Geberit-Welt
- Kritische Auseinandersetzung, Zielerreichung und Empfehlung
- Chancen und Risiken des \"Avalanche-Checks\"
- Viele Unsicherheiten sind noch zu klären
- Zielerreichung und Empfehlung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Anwendung von heuristischen Ansätzen in der Produktentwicklung der Geberit International AG. Das Ziel ist es, die Time-To-Market zu verkürzen, ohne den Wettbewerbsvorsprung zu verringern. Die Arbeit zielt darauf ab, ein praktikables Hilfsmittel für Produktentwickler zu schaffen, das im täglichen Arbeitsablauf eingesetzt werden kann.
- Heuristische Ansätze in der Produktentwicklung
- Verkürzung der Time-To-Market
- Erhaltung des Wettbewerbsvorsprungs
- Entwicklung eines praktikablen Hilfsmittels für Produktentwickler
- Analyse von Chancen und Risiken heuristischer Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einführung in das Thema der heuristischen Ansätze in der Produktentwicklung und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Geberit Gruppe als Unternehmen vorgestellt und die Herausforderungen als Pionier im Bereich der Sanitärtechnik beleuchtet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Anwendung des Avalanche-Checks zur Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung. Es werden die „Lawinen-Heuristiken“ erläutert und ihre Anwendung auf die Produktentwicklung der Geberit International AG gezeigt. Das dritte Kapitel widmet sich der kritischen Auseinandersetzung mit dem Avalanche-Check und seinen Chancen und Risiken. Es werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt und eine abschließende Empfehlung ausgesprochen.
Schlüsselwörter
Heuristik, Produktentwicklung, Time-To-Market, Wettbewerbsvorsprung, Avalanche-Check, „Lawinen-Heuristiken“, Geberit International AG, First-Mover-Strategie, Chancen und Risiken.
- Arbeit zitieren
- Roger Baggenstos (Autor:in), 2021, Heuristik zur Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung. Ein Hilfsmittel für Entwicklungsteams anhand eines Unternehmens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040354