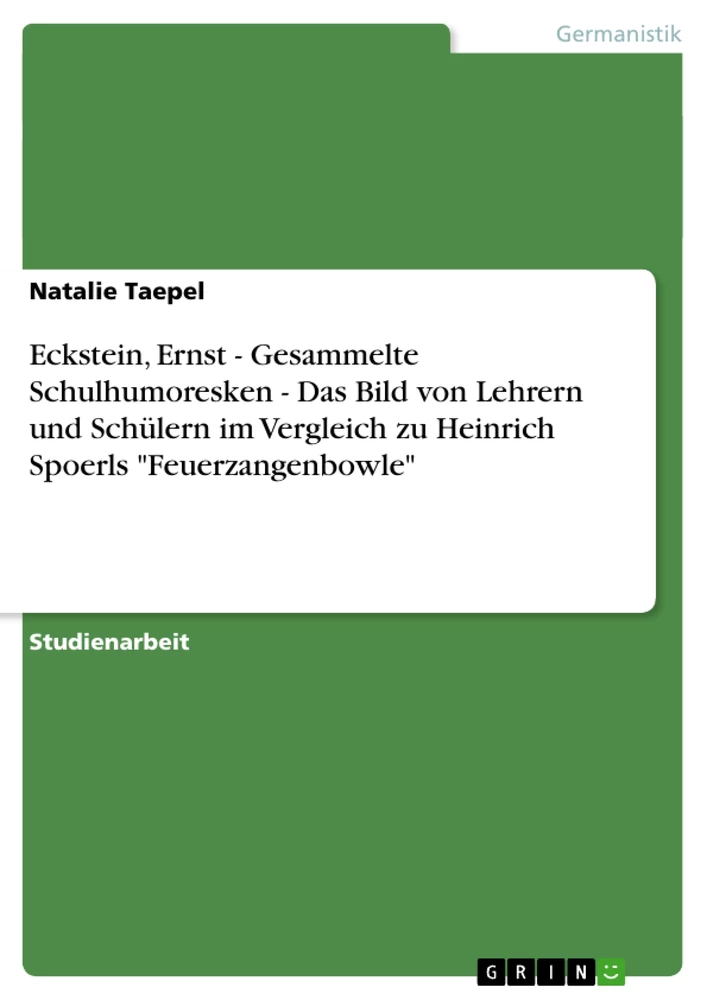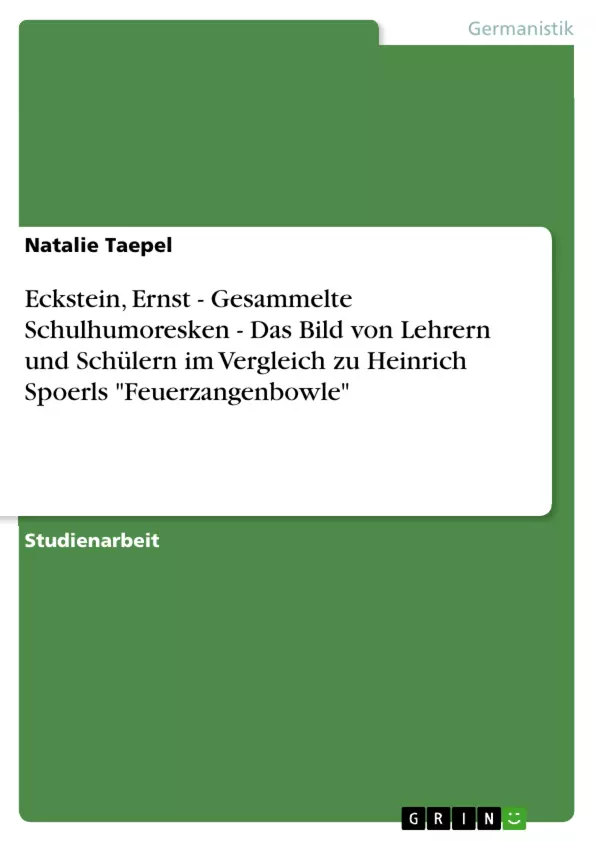Erleben Sie eine unvergessliche Reise zurück in die Welt der Schulstreiche und des unbeschwerten Humors, wo die Klassenzimmer zu Bühnen des Lachens und die Lehrer zu unfreiwilligen Komödianten werden! Diese einzigartige Gegenüberstellung zweier literarischer Meisterwerke – Ernst Ecksteins "Gesammelte Schulhumoresken" und Heinrich Spoerls "Die Feuerzangenbowle" – enthüllt auf intelligente Weise die zeitlosen Parallelen und subtilen Unterschiede in der Darstellung des Schullebens. Tauchen Sie ein in die detailreichen Porträts unvergesslicher Charaktere wie dem dialektsprechenden Professor Heinzerling und seinem geistigen Nachfahren, Professor Crey, deren skurrile Eigenheiten Generationen von Lesern zum Schmunzeln gebracht haben. Entdecken Sie die Dynamik zwischen Lehrern und Schülern, von autoritären Pädagogen bis hin zu wohlwollenden Originalen, und erleben Sie die legendären Streiche des Wilhelm Rumpf und des unvergesslichen Hans Pfeiffer alias Doktor Johannes Pfeiffer, der sich noch einmal auf die Schulbank wagt, um die wahre Bedeutung von Jugend und Rebellion zu erfahren. Diese fesselnde Analyse beleuchtet nicht nur die humorvollen Aspekte des Schulalltags, sondern wirft auch einen kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Konventionen und die Bedeutung von Freundschaft, Zusammenhalt und dem unbändigen Drang nach Freiheit. Ob Sie ein Liebhaber klassischer Literatur, ein nostalgischer Ehemaliger oder einfach nur auf der Suche nach einer unterhaltsamen Lektüre sind – diese vergleichende Studie wird Sie mit intelligentem Witz, feinsinniger Beobachtungsgabe und einer tiefen Wertschätzung für die Freuden und Leiden der Schulzeit begeistern. Eine brillante Analyse für alle, die sich nach der unbeschwerten Zeit der Jugend sehnen und die zeitlose Kraft des Humors zu schätzen wissen. Entdecken Sie die versteckten Botschaften zwischen den Zeilen und lassen Sie sich von der unvergleichlichen Atmosphäre dieser beiden literarischen Juwelen verzaubern. Ein Muss für jeden Bücherfreund, der auf der Suche nach einer geistreichen und erhellenden Lektüre ist, die zum Nachdenken anregt und gleichzeitig aufs Köstlichste unterhält. Wagen Sie einen nostalgischen Trip zurück in die Schulzeit, der Ihnen ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern wird!
INHALT
1. Einleitung
2. Kurze Biographien der Autoren
2.1 Biographie des Autors Ernst Eckstein
2.2 Biographie des Autors Heinrich Spoerl
3. Die Werke
3.1 Auswahl und Konturierung wichtiger Protagonisten
3.1.1 Herausstellung wichtiger Protagonisten aus den„Gesammelten Schulhumoresken“
3.1.1.1 Doktor Samuel Heinzerling
3.1.1.2 Wilhelm Rumpf
3.1.2 Herausstellung wichtiger Protagonisten aus der„Feuerzangenbowle“
3.1.2.1 Professor Crey
3.1.2.2 Doktor Johannes Pfeiffer bzw. Hans Pfeiffer
3.2 Die Beziehungen zwischen den Lehrern und den Schülern
3.2.1 Herausarbeitung der Beziehungen zwischen den Lehrern und den Schülern in den„Gesammelten Schulhumoresken“
3.2.2 Herausarbeitung der Beziehungen zwischen den Lehrern und den Schülern in der„Feuerzangenbowle“
3.3 Die Beziehungen zwischen den Schülern
3.3.1 Herausarbeitung der Beziehungen zwischen den Schülern in den „Gesammelten Schulhumoresken“
3.3.2 Herausarbeitung der Beziehungen zwischen den Schülern in der „Feuerzangenbowle“
3.4 Didaktisch-methodische Darstellung einzelner Schulfächer
3.5 Die Schulkritik als Gesellschaftskritik ?
4. Schlußbetrachtung
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die „Feuerzangenbowle“ ist vor allen Dingen als Film mit Heinz Rühmann populär geworden. In dem Film wird ein reines Jungengymnasium dargestellt, in dem die Jungen viele Streiche aushecken und ein, so scheint es, unbeschwertes Leben führen. Das Schulleben wird in einem neuen, ungewohnten Bild gezeigt. Die „Feuerzangenbowle“ ist ein heiterer Roman, der zum Schmunzeln anregt.
Liest man die „Feuerzangenbowle“, stößt der Leser auf die Figur des Professors Crey. Das besondere an diesem Professor ist seine Aussprache, die in der vorliegenden Arbeit noch genauer dargestellt wird. Als der neue Schüler Hans Pfeiffer das erste Mal auf Professor Crey trifft, wundert er sich sehr über dessen Dialekt. „Darüber kam Hans Pfeiffer nicht hinweg.
Imitie rt der Mann wirklich den Professor Heinzerling aus Ecksteins ‚Besuch im Karzer1 ’?“ (Spoerl 1933, S. 19). Diese Stelle im oben genannten Roman weist darauf hin, daßin einem Werk eines anderen Autors ein Professor vorkommen muß, der dieselbe Aussprache besitzt, wie Professor Crey. Nun mußte das Werk des Autors Eckstein und die erwähnte Figur Professor Heinzerling gefunden werden, um die beiden Professoren miteinander vergleichen zu können.
1875 kam das Werk „Der Besuch im Karzer“ heraus, mit dem der Schriftsteller Ernst Eckstein berühmt wurde. Hier erscheint der mit dem besonderen Dialekt sprechende Professor Heinzerling das erste Mal. So wird deutlich, daßdie zum Schmunzeln anregende Aussprache des Professors Crey in Spoerls „Feuerzangenbowle“ nicht aus den Gedanken dieses Autors entstanden ist, sondern daßdie Idee von Eckstein stammt.
Betrachtet man die beiden Werke, die „Feuerzangenbowle“ von Spoerl und die „Gesammelten Schulhumoresken“ von Eckstein, sind einige Parallelen erkennbar, die in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden.
2. Kurze Biographien der Autoren
2.1 Biographie des Autors Ernst Eckstein
Ernst Eckstein wurde am 6. Februar 1845 als Sohn eines Rechtsanwaltes in Gießen geboren. Er wurde zunächst privat unterrichtet und ging mit neun Jahren auf das Landgraf- LudwigsGymnasium. Mit 17 Jahren bestand er als Primus das Abitur. Er reiste viel durch Europa und bereitete sich auf sein Studium der romanischen Sprachen vor.
Eckstein promovierte 1866 mit einer französisch geschriebenen Arbeit über den „Geizigen“ von Molière. Bald darauf erhielt er die Berechtigung, als Privatdozent an der Universität zu lehren. Sein hauptsächliches Interesse war jedoch auf das Schreiben gerichtet. Eckstein wurde Schriftsteller und gehörte zu den bekanntesten Autoren der Gründerzeit.
Berühmt wurde Eckstein durch die Gymnasialhumoreske „Der Besuch im Karzer“ (1875); in dem er (vermutlich) seine schulischen Erlebnisse verarbeitete. In dem Werk rächt sich Eckstein an den autoritären Lehrerfiguren. Eckstein gilt als Begründer dieser literarischen Gattung.
Von 1868-1870 war Eckstein Zeitungskorrespondent in Paris. Als sich jedoch der Krieg ankündigte, mußte er 1870 nach Deutschland zurück. Bald wurde er Redakteur einer vielgelesenen Zeitschrift und heiratete im selben Zeitraum. Er schrieb unterdessen humoristische Texte und historische, im Mittelmeerraum spielende Romane.
1891 starb Ecksteins erste Frau. Er heiratete ein zweites Mal. Eckstein litt an einer Nierenerkrankung und an mehreren Schlaganfällen. Im Jahre 1900 starb er.
2.2 Biographie des Autors Heinrich Spoerl
Heinrich Spoerl wurde am 8. Februar 1887 in Düsseldorf geboren. Er war deutscher Schriftsteller, hatte aber ursprünglich Jura studiert.
Spoerl schrieb humorvolle, zum Teil zeit- und gesellschaftskritische Romane und Erzählungen. Sein bekanntestes Werk ist „Die Feuerzangenbowle“, die 1933 in der Zeitung „Der Mittag“ zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Erst einige Zeit später wurde bekannt, daßHans Reimann2 an dem Werk mitgeschrieben hat. Die „Feuerzangenbowle“ wurde fälschlicherweise allein Heinrich Spoerl zugeschrieben, dabei war es ein gemeinsames Werk beider Autoren. Für die Drehbuchfassung war ausschließlich Hans Reimann verantwortlich.
Reimann recherchierte für das Werk an einem Gymnasium im schlesischen Neusalz, wo er die Rolle des Schülers Pfeiffer einnahm.
Weitere Werke Spoerls sind unter anderem „Die Hochzeitsreise“, „Man kann ruhig darüber sprechen“, „Der Gasmann“ und „Wenn wir alle Engel wären“.
Spoerls Sohn Alexander wurde 1917 geboren und starb 1978 in Rottach-Egern. Dieser war ebenfalls Schriftsteller und schrieb zusammen mit seinem Vater das Werk „Der eiserne Besen“.
Spoerl starb am 25. August 1955 in Rottach-Egern (MGTL 1995, Bd. 21, S. 33).
3. Die Werke
Die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegenden Werke sind die „Gesammelten Schulhumoresken“ des Schriftstellers Ernst Eckstein von 1907 und „Die Feuerzangenbowle“ des Schriftstellers Heinrich Spoerl von 1933.
3.1 Auswahl und Konturierung wichtiger Protagonisten
3.1.1 Herausstellung wichtiger Protagonisten aus den „Gesammelten Schulhumoresken“
Als wichtige Protagonisten in Ecksteins „Gesammelten Schulhumoresken“ werden der Lehrer Doktor Samuel Heinzerling, sowie der Schüler Wilhelm Rumpf ausgewählt und konturiert.
3.1.1.1 Doktor Samuel Heinzerling
Ein wichtiger Protagonist in Ecksteins „Gesammelten Schulhumoresken“ ist der Direktor Doktor Samuel Heinzerling. Dieser fällt insbesondere durch seine außergewöhliche Aussprache auf, welche im folgenden aufgezeigt wird:
„Sein Sä mer ställ, [...], äch weißzor Genöge, was äch von Ähren bestimmten Versächerongen zo halten habe. Öbersätzen Sä jetzt das Kapätel ins Grächäsche, oder gäben Sä zo, daßSä nächt nach Geböhr präparärt sänd!“ (Eckstein 1907, S. 65)
Doktor Samuel Heinzerling ist Philologe und Direktor des städtischen Gymnasiums. Er unterrichtet Latein. Heinzerling wird als die „originellste Figur“ (ebd., S. 89) der Prima beschrieben. Er gilt als ein wohlwollender, heiterer Mann, der auch dem Humor nicht abgeneigt ist. In der Prima ist er im allgemeinen sehr beliebt. Dennoch hat dieser Pädagoge auch eine schwache Seite, die von den Schülern nicht so gerne gesehen wird: Heinzerling ist der Meinung, „[...] ein gerechter und vollkommender Primaner müsse des Morgens präzis mit dem Glockenschlage auf seinem Platze sein.“ (ebd., S. 89) Mit dem frühen Aufstehen und dem pünktlichen Ankommen in der Schule hat jedoch der ein oder andere Schüler seine Schwierigkeit. Heinzerling setzt fest, daßjeder Schüler einen Tag lang in der Karzer muß, wenn er zweimal innerhalb einer Woche ohne ausreichende Entschuldigung zu spät kommt.
Des weiteren wird Heinzerling als ein würdevoller Mensch beschrieben. Er trägt eine große Brille auf der Nase, hält in der Regel in der linken Hand ein Buch und in der rechten traditionsgemäßeinen Bleistift, mit dem er hin und wieder seine Schüler in das Klassenbuch einträgt oder kleinere Notizen vermerkt.
Heinzerling ist verheiratet und hat vier Töchter, mit denen er nicht so ganz glücklich zu sein scheint. Er vergleicht seine Töchter mit der Tochter des Pedellen3, die er sehr schätzt. Er beneidet den Pedellen um dessen intelligente und höfliche Tochter. Heinzerling bezeichnet sich selbst als einen „feingebäldeten Kenner des Klassischen Altertoms“ und sieht sich nicht in der Lage, „eine meines Bäldogsgrades wördige Nachkommenschaft zo erzielen.“ (Eckstein 1907, S. 171)
3.1.1.2 Wilhelm Rumpf
Ein weiter wichtiger Protagonist, der in Ecksteins „Gesammelten Schulhumoresken“ dargestellt wird, ist der Schüler Wilhelm Rumpf. Er ist der beste Freund von Ernst Eckstein und erst einige Zeit später in die Klasse dazugekommen. Wann genau, läßt sich nicht feststellen. Rumpf wird beschrieben als ein „humoristisch beanlagter Autoritätsfeind.“ (Eckstein 1907, S. 13)
Diese Spezies von Schülern beschreibt Eckstein als impulsive, lebhafte Menschen, die sorglos mit dem Freiheitsentzug durch den Karzer umgehen können. Ebenso seien sie in der Lage, kaum für die Schule zu lernen und trotzdem aufgrund schneller Auffassungsgabe die meisten Fächer bestens zu bestehen. Diese Schüler belächeln die Lehrer, wenn jene ihnen ankündigen, daßsie so in ihrem Leben nicht weit kommen würden. In der Regel haben diese Schüler eine berufliche Karriere vor sich (ebd., S.13).
Rumpf setzt sich gerne über die Verbote der Schule hinweg. Schülern des städtischen Gymnasiums ist unter anderem das Betreten von öffentlichen Lokalen verboten. Dennoch gehen Rumpf und seine Freunde hin und wieder in Wirtshäuser, um ein Bier zu trinken. Rumpf fallen oft neue Streiche ein, die er auch mit Hilfe seiner Klassenkameraden den Lehrern spielt.
3.1.2 Herausstellung wichtiger Protagonisten aus der „Feuerzangenbowle“
Aus Spoerls „Feuerzangenbowle“ werden als wichtige Protagonisten der Lehrer Professor Crey und der Schriftsteller Doktor Johannes Pfeiffer bzw. der Schüler Hans Pfeiffer ausgewählt und konturiert.
3.1.2.1 Professor Crey
In Spoerls „Feuerzangenbowle“ ist Professor Crey ein wichtiger Protagonist. Er unterrichtet Geschichte und Chemie auf dem Gymnasium für Jungen in Babenberg. Professor Crey wird als ein „prächtiger Mensch, voll Güte und Menschenliebe“ beschrieben, der jedoch immer versucht, seinen Schülern gegenüber streng und autoritär aufzutreten. Er gilt als „[...] ein ganz vernünftiger Mensch, mit großem Wissen und klugen Gedanken.“ (Spoerl 1933, S. 155) Vor allem von den Erwachsenen wird der Professor als ein eben solcher Mann gesehen.
Professor Crey hat ein gepflegtes Äußeres, einen „steilen Spitzbart und [...] einen hochgewölbten Zwicker“ (Spoerl 1933, S. 19) im Gesicht. In seiner Westentasche steckt eine goldene Uhr, dessen Uhrenkette hervorschaut. Des weiteren trägt er eine „kunstvoll gebauschte Krawatte mit einer offensichtlich echten Perle“ (ebd., S. 18) und „aus der äußeren Brusttasche des tadellosen mausgrauen Taillenrockes [...] flutet ein mächtiges elfenbeinfarbenes Seidentuch, das häufiger als notwendig zum Betupfen des Gesichts und der Nase verwendet wird.“ (ebd., S. 19)
Unter den Schülern wird Professor Crey „Schnauz“ genannt. Wie dieser Spitzname zustande gekommen ist, läßt sich nicht eindeutig feststellen. Vermutlich haben die Schüler ihren Professor aufgrund seines Spitzbartes so getauft. Ein anderer denkbarer Ursprung des Spitznamens könnte auch die von Professor Crey angedeutete Strenge und Autorität sein.
Auffallend ist Professor Creys Aussprache. Er spricht durch die Nase, ersetzt den Vokal I durch ein E, das IE und das E durch ein Ä, das U wird zum O und das Üwird zum Öumgewandelt. Diese Aussprache ähnelt sehr der Aussprache des Doktor Heinzerling in Ecksteins „Gesammelten Schulhumoresken“. Die ähnliche Aussprache der beiden Professoren ist eine große Parallele in beiden genannten Werken.
Professor Crey hat als verdienstvoller Lehrer das Anrecht, die Sonntagnachmittage mit dem Schuldirektor Knauer und dessen Familie zu verbringen. Frau Knauer legt besonderen Wert auf die Anwesenheit Professor Creys, da sie sich, so scheint es, eine Verbindung zwischen Professor Crey und ihrer Tochter Eva erhofft (Spoerl 1933, S. 77). Professor Crey begleitet nicht ungern die Familie Knauer bei ihren Spaziergängen am Sonntagnachmittag, da ihm ein Näherkommen zu Eva sehr angenehm ist. Sie fühlt sich jedoch viel zu jung für ihn und erwidert seine Gefühle nicht.
3.1.2.2 Doktor Johannes Pfeiffer bzw. Hans Pfeiffer
Die sogenannte Hauptfigur in Spoerls Werk „Die Feuerzangenbowle“ stellt der 24jährige Doktor Johannes Pfeiffer dar. Er ist Schriftsteller humoristischer Bücher und Texte. Pfeiffer lebt in Berlin in einer exklusiven Wohnung und ist mit Marion Eisenschmidt verlobt. Diese arbeitet in den Vereinigten Werkstätten für Vaterländische Heimkunst.
Pfeiffer hat nie eine öffentliche Schule besucht. Er wurde auf dem väterlichen Gut von einem privaten Hauslehrer unterrichtet. Er gilt als Romantiker, der sehr gesellschaftsliebend ist. Seine Arbeit, das heißt das Schreiben, übt er meistens nachts aus. Obwohl Pfeiffer Schriftsteller ist, wird er als schreibfaul beschrieben. Pfeiffer gilt als jemand, der zwar schnell für neue Dinge zu begeistern ist, aber schon bald das Interesse verliert.
Pfeiffer trifft sich regelmäßig mit wesentlich älteren Herren in einer Runde, in der die Feuerzangenbowle ge macht und getrunken wird. Die Herren erzählen aus ihrer Schulzeit und berichten von Streichen, die sie den Lehrern gespielt haben. Pfeifer ist enttäuscht, daßer selbst nie derartige Streiche erleben konnte. Die Herren der Feuerzangenbowlenrunde entscheiden, daßPfeiffer als der Schüler Hans Pfeiffer noch einmal zur Schule gehen soll. So wird der Schriftsteller Doktor Johannes Pfeiffer zum Primaner Hans Pfeiffer.
„Seine Oberlippe ist rasiert; auf dem blassen Gesicht sitzt kalt und fremd die Nickelbrille. Der Jünglingsanzug ist zu eng in Brust und Schultern und kneift unter den Armen. Hinten über dem niedrigen Rockkragen lugt das Kragenknöpfchen hervor. Und aus den gekürzten Ärmeln stehen überlebensgroßdie Handgelenke. Er sieht richtig drausgewachsen aus. Nur die funkelnagelneue Pennälermütze ist etwas zu großund sitzt ungemütlich und steif wie die Dienstmütze eines Stationsvorstehers auf dem bürstenförmig gestutzten Haar.“ (Spoerl 1933, S. 15)
So besucht der neue Schüler Hans Pfeiffer das Gymnasium in Babenberg. Er ist schnell in der Klassengemeinschaft integriert und initiiert alleine oder auch mit seinen Klassenkameraden zusammen einige Streiche.
Pfeiffer wohnt bei Frau Windscheid, die sich um ihn kümmert, wie um ihren eigenen Sohn. Pfeiffer genießt die Zeit in Babenberg. Er verliebt sich in die Tochter des Schuldirektors Knauer. Für seine Verlobte Marion Eisenschmidt ist kein Platz mehr in seinem Leben. Er fühlt sich frei und ungebunden.
3.2 Die Beziehungen zwischen den Lehrern und den Schülern
3.2.1 Herausarbeitung der Beziehungen zwischen den Lehrern und den Schülern in den „Gesammelten Schulhumoresken“
Der Band „Gesammelte Schulhumoresken“ enthält fünf frühere Sammlungen Ecksteins und einige weitere bis dato nicht veröffentlichte Schriften. Enthaltend sind die Werke „Besuch im Karzer“, „Katheder und Schulbank“, „Schulmysterien“, „Stimmungsbilder aus dem Gymnasium“ und „Samuel Heinzerlings Tagebuch“.
Da der vorliegende Band mehrere Werke enthält und dement sprechend viele Personen erwähnt werden, wähle ich einige Protagonisten aus, die ich in meine Untersuchungen einbeziehe.
In den „Gesammelten Schulhumoresken“ werden einige Lehrercharaktere beschrieben. So gibt es zum Beispiel den „ höchst achtbare[n] und wissenschaftlich[en] durchbildete[n] Lehrer, [der] gar nicht mehr existieren könnte, wenn [seine] Schüler nicht ab und zu die gewitterschwüle Luft des Schulsaales durch eine erfrischende Ungezogenheit reinigten“ (Eckstein 1907, S. 76), den „stirnumrunze lten Schultyrannen“, den „Liberalen Denker“, den „Unglücklichen Choleriker“ oder auch einfach den „ungerechten“ Lehrer. Die Schüler haben ihre Lehrer nach deren Charakter den Kategorien zugeordnet.
Die Schüler beschreiben den hier erst erwähnten Lehrercharakter als ebenso angenehm für sich, wie den „stirnumrunzelten Schultyrannen“. Der Letztere sehe in jeder Bewegung eines Schülers eine Gefahr und „verfalle in Krämpfe“, sobald ein Schüler seinen Nachbarn nach der Uhrzeit fragte (Eckstein 1907, S. 77). Zu diesen Lehrern besteht vermutlich kein besonders gutes Verhältnis, da der Lehrer den Schülern nicht voreingenommen begegnen kann.
Der „liberale Denker“ bildet die Lehrerkategorie, die sich daran erinnern, selbst einmal Schüler gewesen zu sein und auch Streiche ausgeheckt oder verbotenerweise unter den Bänken Karten gespielt haben. Allerdings gibt es von den Lehrern, die zu dieser Kategorie zählen, sehr wenige an den Schulen. Zu diesen Lehrern besteht in der Regel ein gutes Verhältnis. Jene durchschauen meist das Verhalten ihrer Schüler und geben keine Gelegenheit in „komische Situationen“ zu gelangen (ebd., S. 77).
Ganz anders verhält sich der „unglückliche Choleriker“, dessen Stimmung zwischen „vulkanischen Wutausbrüchen und ohnmächtiger Schwäche“ schwankt (Eckstein 1907, S. 78). Die Schüler nutzen das schwächliche Verhalten des Lehrers aus und machen in den Stunden besonders viel Lärm. Doktor Hähnle wird als jemand bezeichnet, der dieser Lehrerkategorie zuzuordnen ist. Die Schüler geben dem Lehrer die Schuld an dem Tumult in der Klasse, da der Lehrer sich nicht durchsetzen kann. Das Verhältnis zwischen dem Lehrer und den Schülern kann als schlecht bezeichnet werden, da die Schüler Doktor Hähnle nicht achten und viele Streiche mit ihm vorhaben.
Professor Doktor Schmelzle gilt bei seinen Schülern als ungerecht. Er „hat nämlich die befremdliche Angewohnheit, eine mangelhafte Leistung durch Degradation zu bestrafen.“ (Eckstein 1907, S. 18) Sein Ausspruch in jenen Momenten lautet: „ Setz’ Dich zu unterst!“ (ebd., S. 18). Die Schüler haben wenig Gelegenheit, eigene Fehler zu korrigieren, da der Lehrer die Schüler sehr schnell degradiert. Das Verhalten des Lehrers wird damit erklärt, daßer zu hohe Anforderungen an seine Schüler stellt und „ihm für die Beurteilung der Kenntnisse [der Schüler] jeglicher Maßstab fehlt.“ (ebd., S. 18) Zwischen Professor Doktor Schmelzle und seinen Schüler besteht kein besonders gutes Verhältnis, da sich die Schüler überfordert und von ihrem Lehrer ungerecht behandelt fühlen.
Doktor Brömmel wird als ein etwas zerstreut wirkender Lehrer beschrieben. Er ist verheiratet, hat bereits „zahlreiche“ Töchter und erwartet erneut die Geburt eines weiteren Kindes. Die Schüler nehmen die familiäre Situation des Doktor Brömmel zum Anlaß, über die vielen Kinder Gedichte zu schreiben. Dieses geschieht in der Regel in den Stunden, in denen Doktor Brömmel unterrichtet. Die Schüler nehmen ihren Lehrer nicht ernst. Auch dieser kann sich seinen Schülern gegenüber nicht durchsetzen und läßt sich zuviel gefallen. Die Schüler spielen ihrem Lehrer gerne Streiche, da jener die Streiche nicht durchschaut und die Schüler immer sehr viel Spaßhaben. Das Verhältnis zwischen Doktor Brömmel und seinen Schülern wirkt sehr angespannt, da der Lehrer nicht sicher vor den Scherzen seiner Schüler sein kann und ihnen dementsprechend nicht vertraut. Die Schüler nutzen die Unsicherheit ihres Lehrers aus.
Als origineller Mathelehrer gilt Doktor Veit. Obwohl gerade das Fach nicht zu den beliebtesten der Schüler zählt, haben sie durch Doktor Veit Freude daran bekommen.
„[...] Doktor Veit war vielmehr ein erquickliches Original, in derber Holzschnittmanier ausgearbeitet, aber nirgends geometrisch korrekt. In seinen Lehrstunden herrschte durchaus nicht der Ton der reinen Mathematik. Sein Vortrag war reich an subjektiven Streiflichtern, an reizvollen Impromptus, an ergötzlichen Zwischenfällen...“ (Eckstein 1907, S. 54)
Dieser Lehrer hat eine sehr positive Ausstrahlung auf seine Schüler. Zu Stundenbeginn dürfen sich die Schüler einige Minuten unterhalten, dann wird mit dem Unterricht begonnen. Seine Einstellung den Schülern gegenüber läßt ihn zu einem sehr geschätzten Lehrer werden, zu dem ein gutes Verhältnis besteht. Das Besondere an Doktor Veit ist seine „dialektische Eigentümlichkeit“, die auftritt, wenn er in „erregter Stimmung“ ist. Er sagt unter anderem: „Ich bitt’ mer jetzt aus, daßIhr Ruh’ halt’t!“ oder auch „Halt mer emal die Gäul’ an!“ (ebd., S. 55). Zwar wird auch dieser Lehrer von seinen Schülern manchmal einem Streich ausgesetzt, jedoch kann dieser sich gut durchsetzen, so daßdie Situationen eher harmonisch verlaufen.
3.2.2 Herausarbeitung der Beziehungen zwischen den Lehrern und den Schülern in der „Feuerzangenbowle“
In Spoerls „Feuerzangenbowle“ sind sieben Lehrer vertreten: der Schuldirektor Knauer, der Geschichtslehrer Crey, der Physiklehrer Bömmel, der Geschichts- und Englischlehrer Müller, der Mathelehrer Doktor Brett, sowie Turnlehrer Schmidt und Fridolin, der Gesangslehrer.
Herr Schmidt und Fridolin sind zwei am Rande stehende Figuren. Sie werden nur kurz erwähnt.
Über das Verhältnis von Fridolin zu den Schülern ist nicht viel erkennbar. Es scheint eher neutral zu sein. Die Schüler haben kaum Lust zum Singen und strengen sich dementsprechend wenig an. Für Fridolin ist „Singen der Ausdruck seelischen Empfindens“ (Spoerl 1933, S. 46), welches er den Schülern jedoch nicht nahe bringen kann.
„[...] Das Singen war entsprechend. Die Schuld lag nicht an Fridolin. Das spärliche Männlein mit dem Zwirndünnen Schnurrbärtchen und dem ebenso dünnen Stimmchen gab sich die größte Mühe, aus der trägen Masse seiner schläfrigen Schüler so etwas wie >Sangeslust schwellt die Brust< herauszuholen. Aber je wilder er mit übersteigertem Temperament und gigantischen Armbewegungen dirigierte, desto matter und mürrischer schleppte sich der Gesang. Das Traurigste war -wenigstens in der Meinung der vereinigten Oberklassen-, daßdie Sangeskunst grundsätzlich im Stehen ausgeübt wird. Man konnte die Zeit weder zum Anfertigen von Schularbeiten noch zum Schlafen benutzen.“ (ebd, S. 46)
Dem Leser erscheint das Verhältnis zwischen dem Gesangslehrer Fridolin und den Schülern unproblematisch, da die Schüler nicht beabsichtigen Streiche zu spielen und so keine Konflikte entstehen. Allerdings testet der Schüler Pfeiffer den Lehrer, indem er vorgibt im Stimmbruch zu sein. Fridolin entläßt Pfeiffer ohne Umschweife aus dem Gesangsunterricht.
Der Turnlehrer Herr Schmidt hat ebenfalls ein eher neutrales Verhä ltnis zu den Schülern. Die Schüler strengen sich in den Sportstunden ebenso wenig an, wie im Singen bei Fridolin.
„[...] Turnlehrer Schmidt bevorzugte Übungen, die er nicht selbst vorzumachen brauchte. Tauziehen zum Beispiel konnte er nicht vormachen. Infolgedessen gab es Tauziehen. Die Jungen strengten sich keineswegs an.“ (Spoerl 1933, S. 59)
In diesem aufgezeigten Abschnitt ist deutlich zu sehen, daßder Lehrer selbst nicht motiviert erscheint. Er wählt den einfachsten Weg, um seine Schüler zu beschäftigen. Jene sehen den Sinn dieser Art des Sportunterrichts nicht ein, so daßsie sich wie oben beschrieben kaum anstrengen.
Wie bei Fridolin gibt es auch bei dem Turnlehrer Schmidt keinen Hinweis auf Konflikte zwischen ihm und den Schülern.
Doktor Brett ist der jüngste unter den Kollegen. Er symbolisiert den Beginn einer neuen Schule, in der Disziplin und Respekt zwar sehr wichtig sind, der Spaßaber nicht fehlen darf. Doktor Brett und die Schüler haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Der Lehrer spielt bis zu einer gewissen Grenze kleine Streiche der Schüler mit, läßsie jedoch auch wissen, wann der Spaßaufzuhören hat. Die Schüler akzeptieren dieses Vorgehen.
„[...] Brett gehörte zu den Lehrern, die es nicht nötig haben, den trockenen Lehrstoff durch gequälte Witze schmackhaft zu machen. Er bezog das Interesse aus der Materie selbst und zeigte seinen Jungen nicht nur die atemberaubende Zwangsläufigkeit einer mathematischen Beweisführung, sondern auch die ästhetische Schönheit eines solchen logischen Gebäudes. Seine Entwicklungen und Lösungen erschienen wie gotische Kathedralen von unerhörter Architektur. Wenn er sprach und mit verhaltener Stimme auf die entscheidende Wendung hinsteuerte, hätte man das Fallen einer Stecknadel hören können. Die Spannung war so stark, daßman meinte, in den Köpfen das Knistern der Gedanken zu vernehmen.“ (ebd., S. 41)
Dieser Lehrer fesselt die Schüler mit seinem Unterricht. Aufgrund seiner freundlichen Art entsteht der Eindruck eines fast freundschaftlichen Verhältnisses zwischen dem Mathelehrer Doktor Brett und den Schülern.
Herr Müller unterrichtet Geschichte und Englisch. Er wird nur kurz erwähnt. Dieser Lehrer wird als unauffällig beschrieben und als jemand, dessen „hervorstechende Besonderheit [es war], keine Besonderheit zu haben.“ (Spoerl 1933, S. 37) Herr Müller hießbei allen Schülern Müller 2, da bis vor einigen Jahren ein weiterer Lehrer Müller, der Müller 1 genannt wurde, an diesem Gymnasium unterrichtete. Dennoch gilt bei den Schülern das „Müller 2“ nicht als Spitzname, dieser Name besteht noch aus der Gewohnheit. Über das Verhältnis dieses Lehrers zu den Schülern wird nichts weiter geschildert. Die Schüler haben zwar das Gefühl in den Stunden etwas gelernt zu haben, „nicht aber, einen Lehrer gehabt zu haben.“ (Spoerl 1933, S. 38) Diese Formulierung deutet auf ein Desinteresse zum Lehrer seitens der Schüler hin.
Im Gegensatz zu den eben genannten Lehrern Fridolin, Herrn Schmidt, Doktor Brett und Herrn Müller, haben die folgenden Lehrer Spitznamen von den Schülern erhalten. Fridolin hat keinen Spitznamen, da er „wirklich so [hieß] und brauchte daher keinen Spitznamen.“ (ebd., S. 46) Warum Turnlehrer Schmidt und Doktor Brett keinen Spitznamen erhalten haben, läßt sich nicht feststellen. Vermutlich ist der Turnlehrer Schmidt nicht interessant genug für einen Kosenamen. Da Doktor Brett einen guten, freundschaftlichen Kontakt zu den Schülern hat, läßt sich vermuten, daßdie Schüler ihn aus diesem Grunde bei seinem richtigen Namen nennen.
Bömmel, wie er von allen Schülern genannt wird, ist einer der älteren Lehrer auf dem Babenberger Gymnasium. Von dem Erzähler wird dieser Lehrer folgendermaßen beschrieben:
„[...] Wie er richtig hieß, wußte kein Mensch; man hätte schon im Jahresbericht nachlesen müssen. Es war schon lange her, daßBömmel von seiner niederrheinischen Heimat nach Babenberg verschlagen wurde. Inzwischen war er alt geworden, trug immer noch denselben schwarzen Rock, und sein Bart, der schwarz und krollig war wie Matratzenfüllung, begann sich leise zu versilbern. Seinen niederrheinischen Dialekt hatte er beibehalten, gewissermaßen als einziges Andenken an seine Heimat.“ (ebd., S. 38)
Wie in dem eben genannten Abschnitt deutlich wird, ist der richtige Name Bömmels gar nicht bekannt. Er wird demnach von allen Personen nur bei seinem Spitznamen benannt. Für die Schüler bedeutet die Vergabe von Spitznamen an ihre Lehrer eine besondere Ehre, das heißt, nur bestimmte Lehrer werden „dieser Ehre [...] teilhaftig“ (Spoerl 1933, S. 38).
Bömmel spricht in der Regel immer in seinem Dialekt. Weiterhin duzt er seine Schüler bis in die Oberprima. Ist er jedoch auf jene ärgerlich, siezt er sie und spricht hochdeutsch. Aus dieser Beobachtung läßt sich vermuten, daßdas Verhältnis des Lehrers zu seinen Schülern überwiegend gut sein muß. Bömmel erwartet von seinen Schülern, daßsie im Unterricht zuhören und nicht mitschreiben. Wer dieses dennoch macht, bekommt eine Strafarbeit, die in der Regel von Bömmel gar nicht nachgesehen wird. So versucht sich dieser Lehrer seine Schüler zu erziehen.
Die Schüler spielen auch dem Lehrer Bömmel manchmal Streiche. Dann wird er böse und beginnt wieder hochdeutsch zu sprechen. Er drückt aus, was er von dem Verhalten der Jungen hält: ‚Bah, wat habt ihr für ne fiese Charakter.’ (Spoerl 1933, S. 40). Obwohl Bömmel den Streichen der Jungen hin und wieder ausgeliefert ist, scheint das Verhältnis zwischen ihm und den Schülern gut zu sein. Der Lehrer Bömmel vermittelt das Gefühl, als ob er über den Dinge n steht und die Schüler im Grunde seines Herzen gerne mag.
Professor Crey gehört ebenfalls zu den älteren Lehrern des Babenberger Lehrerkollegiums. Wie auch sein Kollege Bömmel, hat Professor Crey einen Spitznamen von den Schülern erhalten. Diese Tatsache läßt schon vermuten, daßProfessor Crey ein ausgewählter Lehrer ist, dem diese Ehre des Kosenamens zuteil geworden ist. Der Spitzname des Professors lautet Schnauz. Wie bereits in Kapitel 3.1.2.1 beschrieben, läßt sich der Ursprung dieses zusätzliche n Namens nicht eindeutig feststellen. Vermutlich besteht eine Verbindung zwischen dem Namen Schnauz und dem Verhalten des Lehrers seinen Schülern gegenüber. Professor Crey strahlt eine gewisse Strenge und Autorität aus. Diese hindert die Schüler jedoch nic ht daran, dem Professor immer wieder Streiche zu spielen. Da Professor Crey sich nicht durchsetzen kann, haben die Schüler in der Regel nichts auszustehen und kommen meistens gut davon.
Das Verhältnis zwischen Professor Crey und den Schülern wirkt eher neutral. Trotzdem ist eine gewisse Sympathie seitens der Schüler vorhanden, da die Gutmütigkeit des Professors doch erkennbar ist und sie ihn ansonsten sicher nicht mit einem Spitznamen versehen hätten. Es wäre auch denkbar, daßdie Sympathie mit der interessanten Aussprache des Professors zusammenhängt (siehe Kapitel 3.1.2.1).
Der Direktor des Babenberger Gymnasiums ist Herr Knauer, der von den Schülern aufgrund seines Wissens über alte Sprachen, so auch über das Griechische, im allgemeinen der Zeus genannt wird. Er wird als ein freundlicher Mann beschrieben, der stets bestrebt ist, „alle überflüssigen Konflikte - und nach seiner Ansicht waren Konflikte immer überflüssig - zu vermeiden“ (Spoerl 1933, S. 27). So entsteht auch der Eindruck eines guten Verhältnisses zwischen Direktor Knauer und den Schülern. Da Herr Knauer aber eben der Direktor ist, haben die Schüler doch mehr Respekt vor ihm. Direktor Knauer bestraft seine Schüler in angemessener Weise und ist immer bereit, die Meinung des Schülers anzuhören
3.3 Die Beziehungen zwischen den Schülern
3.3.1 Herausarbeitung der Beziehungen zwischen den Schülern in den „Gesammelten Schulhumoresken“
In Ecksteins „Gesammelten Schulhumoresken“ kommen vierzehn Schüler vor, die namentlich genannt werden. Drei von ihnen sind mit ihrem Vor- und Nachnamen erwähnt: Emanuel Boxer, Wilhelm Rumpf und Leopold Hutzler. Die folgenden Schüler nennen sich ausschließlich bei ihren Nachnamen: Heppenheimer, Schwarz, Hanau, Gildemeister, Knebel, Möricke, Kleemüller, Heinemann, Knipcke, Scholz und der Erzähler Eckstein als Mitglied der Klassengemeinschaft, werden genannt.
In dem Werk wird deutlich, daßalle eben genannten Schüler sehr kameradschaftlich miteinander umgehen. Es ist keine Ausgrenzung eines Jungen aus dieser Gemeinschaft zu erkennen. Spielt einer der Jungen einem Lehrer einen Streich, stehen alle anderen hinter jenem und helfen ihm, wenn es die Situation verlangt. Als Boxer eine Auseinandersetzung mit dem Lehrer Brömmel hat und dieser nach der Unterrichtsstunde die Klasse verläßt, „ sanken sich die Sekundaner gegenseitig in die Arme und jauchzten vor Wonne und Seligkeit“ (Eckstein 1907, S. 33). Hier wird deutlich, wie die Schüler zusammenhalten, wenn einer von ihnen in irgendeiner Weise ein Disput mit einem Lehrer hat und in gewisser Weise als „Gewinner“ aus der Diskussion hervorgegangen ist.
Obwohl die Schüler in jeder Situation zusammenhalten und sich immer füreinander einsetzen, haben sich besonders feste Freundschaften herausgearbeitet. Heppenheimer ist der beste Freund von Boxer und Rumpf hat mit Eckstein eine feste Freundschaft geschlossen. Außerhalb der Schule sind nicht immer alle der genannten Jungen zusammen. Dort treten insbesondere Scholz, Knebel, Rumpf, Schwarz und Eckstein auf.
Da es häufiger vorkommt, daßein Schüler verspätet die Klasse betritt, müssen sich die Schüler neue Entschuldigungen einfallen lassen. Zweifelt der Lehrer an der Entschuldigung eines Schülers, bestätigen die Mitschüler jedoch die Aussage ihres Kameraden.
An dem Gymnasium bestehen Gesetze, die besagen, daßdie Schüler weder rauchen noch alkoholische Getränke zu sich nehmen dürfen. Gerade aus diesem Grunde rauchen und trinken die Schüler trotzdem. „[...] Mit wahrer Todesverachtung qualmten wir in Tertia unsere Zigarren - nur weil es verboten war! [...] Man gebe die Sünde frei, - und sie hört auf, zu verlocken.“ (Eckstein 1907, S. 104) Aus den Verboten heraus entstand das „Tabakkollegium“, dem Knebel, Schwarz, Eckstein und ein vierter, der nicht namentlich erwähnt wird, angehörten. Diese vier halten zusammen, falls einem von ihnen aufgrund des verbotenen Rauchens etwas passieren sollte. Sie haben Ausreden abgesprochen, von denen sie sicher sein können, daßsich jeder daran halten wird.
3.3.2 Herausarbeitung der Beziehungen zwischen den Schülern in der „Feuerzangenbowle“
Der Schriftsteller Johannes Pfeiffer kommt in der Gestalt des Schülers Hans Pfeiffer auf das Babenberger Gymnasium. Er wird von seinen neuen Mitschülern genau beobachtet, insbesondere von dem langen Rosen und Rudi Knebel. Nach kurzem Wortwechsel kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen Rudi Knebel und Hans Pfeiffer. Rudi geht durch einen Jiu- Jitsu-Griff von Hans auf den Boden. Dieser Vorfall ist der Beginn ihrer Freundschaft.
Der lange Rosen genießt eine lange Zeit Hochachtung innerhalb der Klasse, weil er eine hübsche Schwester hat und seine Klassenkameraden aus diesem Grund gerne mit ihm enger befreundet sein möchten. Nachdem Hans mit Hilfe eines selbstgebastelten Spiegels seinen Klassenkameraden Mathematikaufgaben vorsagen kann, steht er in der Rangliste ganz oben.
Innerhalb der Klasse gibt es sogenannte Interessengemeinschaften. Von einer Interessengemeinschaft ist Hans der Vorstand. Neben ihm gehören Rudi Knebel, Ernst Husemann und der kleine Luck dazu. Die Jungen treffen sich jeden Nachmittag, um gemeinsam ihre Hausaufgaben zu machen. Mit der Zeit entwickelt sich zwischen den vieren eine sehr enge Freundschaft. Plant Hans größere Streiche mit den Lehrern, steht die ganze Klasse hinter ihm und spielt mit.
Auffallend ist jedoch, daßinsbesondere der lange Rosen gerne vor den Lehrern den kleinen Luck für Dinge verantwortlich macht, die jener nicht getan hat. Hans Pfeiffer hilft Luck, so gut er kann.
3.4 Didaktisch-methodische Darstellung einzelner Schulfächer
In beiden Werken finden sich keine genauen Darstellungen über einzelne Schulfächer oder Lehrmethoden. Es werden zwar einzelne Fächer erwähnt, sei es Latein, Griechisch, Mathematik, Chemie, Sport oder Singen, dennoch sind jene eher nebensächlich. Es kommt hauptsächlich auf die Darstellung verschiedener Lehrertypen und auf die Verhältnisse zwischen den Lehren und den Schülern an. Der Schwerpunkt liegt hierbei eindeutig auf den von Schülern ausgeführten Streichen.
Das Fach Mathematik ist erkennbar als ein sehr unbeliebtes Fach. In diesem Fach haben die meisten Schüler große Schwierigkeiten und bekommen oft schlechte Noten. Ebenfalls unbeliebt sind die sprachlichen Fächer, aus denen übersetzt werden muß. Große Probleme haben die Schüler im Griechischen, wenn sie Texte aus dem Lateinischen in das Griechische übersetzen sollen.
In der Regel sind die Schüler nicht oder unzureichend vorbereitet, welches meistens Strafen für die Schüler zur Folge hat. Trotzdem nehmen die Schüler lieber eine Strafe in Kauf, als für die kommenden Hausaufgaben vorbereitet zu sein.
3.5 Die Schulkritik als Gesellschaftskritik ?
In beiden Werken tritt die Schulkritik als Gesellschaftskritik sicher nicht zu Tage. Das dargestellte Schulbild ist nicht authentisch. Die Schule wird als heiterer Lebensabschnitt aufgezeigt, in dem es kaum Probleme gibt. Treten dennoch Probleme auf, können sie schnell überwunden werden.
Es werden unterschiedlichste Lehrer- und Schülercharakteristika aufgeze igt. Diese sind in der Regel sehr übertrieben beschrieben, so daßder Leser eher schmunzeln kann. Möglich ist, daßder Leser zu dem einen oder anderen Lehrer oder Schüler eine Ähnlichkeit zu Personen aus seiner eigenen Vergangenheit findet.
Die beiden Werke gelten als Humoresken, das heißt als „witzige Geschichten“, die von mehreren Generationen gelesen werden können und hauptsächlich der Unterhaltung dienen.
4. Schlußbetrachtung
Nach der Darstellung der Lehrer und Schüler aus den Humoresken Ecksteins und der „Feuerzangenbowle“ von Spoerl, sind einige Gemeinsamkeiten in beiden Werken zu erkennen.
In beiden Werken handelt es sich um reine Jungengymnasien, welches jedoch zu der Zeit, in der die Werke entstanden sind, keine Besonderheit war und demnach Zufall sein könnte. An diesen Gymnasien unterrichten ausschließlich männliche Lehrkräfte, die einerseits aus sehr freundlichen, den Schülern zugewandten, und zum andererseits aus eher unfreundlichen und unbeliebten Lehrern bestehen. Vordergründig erscheint in beiden Werken das Aushecken und Durchführen von Streichen, an denen sich in der Regel viele Schüler einer Klasse beteiligen.
Halten sich Schüler von dem Durchführen solcher Streiche fern, gelten sie als Außenseiter der Klasse und finden kaum Beachtung. Die meisten Schüler haben ein sehr gutes Verhältnis untereinander und zeigen, auch in schwierigen Situationen, Kameradschaft. Der Spaßin der Schule ist für die Schüler in beiden Werken das wichtigste. In beiden Werken erscheint jeweils ein dominanter Schüler, der vor allen Dingen bei der Planung von Streichen im Mittelpunkt steht. Diese sind namentlich Wilhelm Rumpf und Hans Pfeiffer. Einige wenige Lehrer haben kein gutes Verhältnis zu ihren Schülern. Von ihnen wird im Vergleich zu den anderen Lehrern wenig berichtet.
Die größte Parallele in beiden Werken ist die Ähnlichkeit der Aussprachen der Professoren Heinzerling und Crey. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist es möglich, daßSpoerl die Idee dieses Dialektes von Eckstein übernommen hat, zumal Spoerls „Feuerzangenbowle“ erst 26 Jahre später veröffentlicht wurde. Sowohl in dem Buch als auch in dem Film der „Feuerzangenbowle“ wird der Professor, der diesen Dialekt spricht, von einem Schüler -und zwar der Hauptfigur Hans Pfeiffer- imitiert. Die Imitation ist so gelungen, daßdie Lehrerkollegen des Professors die Verwechslung nicht bemerken. Um vor dem Schulrat nicht schlecht dazustehen, bittet Direktor Knauer den Schüler Pfeiffer, die Rolle „Crey“ weiterzuspielen und gibt dem Schüler das Ehrenwort, ihn nicht zu bestrafen.
Auch in den „Gesammelten Schulhumoresken“ von Eckstein wird der Professor mit seinem witzigen Dialekt nachgemacht. Der imitierende Schüler Wilhelm Rumpf, ebenfalls eine wichtige Figur in dem Werk, bringt seine Klassenkameraden zum Lachen, als er eines Morgens in der Klasse Professor Heinzerling darstellt. Leider wird der richtige Professor Zeuge dieses Auftritts. Rumpf erhält daraufhin zwei Tage Karzerstrafe. Als Heinzerling noch einmal mit Rumpf sprechen möchte, gelangt der Professor durch eine List Rumpfs in den Karzer und Rumpf spielt erneut den Professor. Rumpf imitiert Heinzerling so gut, daßselbst der Pedell die Verwechslung nicht bemerkt. Heinzerling bittet Rumpf, ihn aus seinem Gefängnis zu lassen und nichts über die Geschichte zu erzählen. Dafür wird er dem Schüler auch die Karzerstrafe erlassen.
In beiden Darstellungen der Werke sind Gemeinsamkeiten festzustellen. Die Schüler erhalten für ihre Imitationen keine Bestrafungen. Man kann vermuten, daßsich Spoerl in den aufgezeigten Ausschnitten und im Grobschema für sein Buch Anregungen aus Ecksteins „Gesammelten Schulhumoresken“ geholt hat.
5. Literaturverzeichnis
Eckstein, Ernst (1907): Gesammelte Schulhumoresken. Neudamm: Verlag von I. Neumann.
MGTL (1995): Meyers großes Taschenlexikon. Bd. 18. Mannheim: BI-Taschenbuchverlag.
MGTL (1995): Meyers großes Taschenlexikon. Bd. 21. Mannheim: BI-Taschenbuchverlag.
Spoerl, Heinrich (1933): Die Feuerzangenbowle. München: Wilhelm Heyne Verlag.
Textor, A.M. (1995): Auf deutsch. Das Fremdwörterlexikon. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
[...]
1 Worterklärung: Karzer bedeutet ein sogenanntes Arrestlokal in Schulen und Universitäten (Textor 1995, S. 153).
2 Hans Reimann lebte von 1889 bis 1969. Er wirkte in Leipzig auf vielfältige Art und Weise. Reimann war Illustrator bei dem legendären Kurt-Wolff-Verlag. Er schrieb Gedichte, humoristisch-satirische Texte, sowie Reiseführer. Das weiteren war er Initiator und Beförderer des Leipziger Kabaretts „Die Retorte“ und Begründer der Leipziger Wochenschrift „Der Drache“. (MGTL 1995, Bd. 18, S. 166).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter umfasst. Die Texte stammen von einem Verlag und enthalten OCR-Daten, die ausschließlich für akademische Zwecke zur Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise bestimmt sind.
Welche Werke werden in dieser Analyse verglichen?
Die Analyse vergleicht "Die Feuerzangenbowle" von Heinrich Spoerl mit "Gesammelte Schulhumoresken" von Ernst Eckstein.
Wer sind die wichtigsten Protagonisten in den "Gesammelten Schulhumoresken" von Ernst Eckstein?
Zu den wichtigsten Protagonisten gehören Doktor Samuel Heinzerling (ein Lehrer) und Wilhelm Rumpf (ein Schüler).
Wer sind die wichtigsten Protagonisten in der "Feuerzangenbowle" von Heinrich Spoerl?
Zu den wichtigsten Protagonisten gehören Professor Crey (ein Lehrer) und Doktor Johannes Pfeiffer/Hans Pfeiffer (ein Schriftsteller, der sich als Schüler ausgibt).
Welche Gemeinsamkeiten werden zwischen den Werken von Eckstein und Spoerl festgestellt?
Zu den Gemeinsamkeiten gehören die Darstellung von reinen Jungengymnasien, das Vorhandensein von Streichen, die von Schülern gespielt werden, und die ähnliche Aussprache der Professoren Heinzerling und Crey.
Was wird über die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern in den "Gesammelten Schulhumoresken" gesagt?
Es werden verschiedene Lehrertypen beschrieben (z.B. "Schultyrannen", "liberale Denker", "unglückliche Choleriker"), und die Beziehungen variieren je nach Charakter des Lehrers. Einige Lehrer werden von den Schülern respektiert, während andere verspottet werden.
Was wird über die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern in der "Feuerzangenbowle" gesagt?
Es werden ebenfalls verschiedene Lehrertypen vorgestellt, von denen einige Spitznamen von den Schülern erhalten. Einige Lehrer haben ein gutes Verhältnis zu den Schülern, während andere eher neutral oder angespannt sind.
Wie werden die Beziehungen zwischen den Schülern in den beiden Werken dargestellt?
In beiden Werken wird betont, dass die Schüler kameradschaftlich miteinander umgehen und zusammenhalten, insbesondere wenn es darum geht, Streiche zu spielen. Es gibt aber auch engere Freundschaften innerhalb der Klassengemeinschaft.
Welche Kritik an der Schule als Gesellschaftskritik wird in den Werken deutlich?
Es wird hervorgehoben, dass die Schulkritik nicht als Gesellschaftskritik zu Tage tritt. Die Werke stellen die Schule als heiteren Lebensabschnitt dar, in dem Probleme schnell überwunden werden können und der Unterhaltung dient.
Was ist das Fazit der Analyse?
Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass es einige Gemeinsamkeiten zwischen den Werken von Eckstein und Spoerl gibt, insbesondere in Bezug auf die Charaktere und die Art und Weise, wie Streiche dargestellt werden. Es wird auch vermutet, dass sich Spoerl von Eckstein für seine "Feuerzangenbowle" inspirieren liess.
- Arbeit zitieren
- Natalie Taepel (Autor:in), 1999, Eckstein, Ernst - Gesammelte Schulhumoresken - Das Bild von Lehrern und Schülern im Vergleich zu Heinrich Spoerls "Feuerzangenbowle", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104135