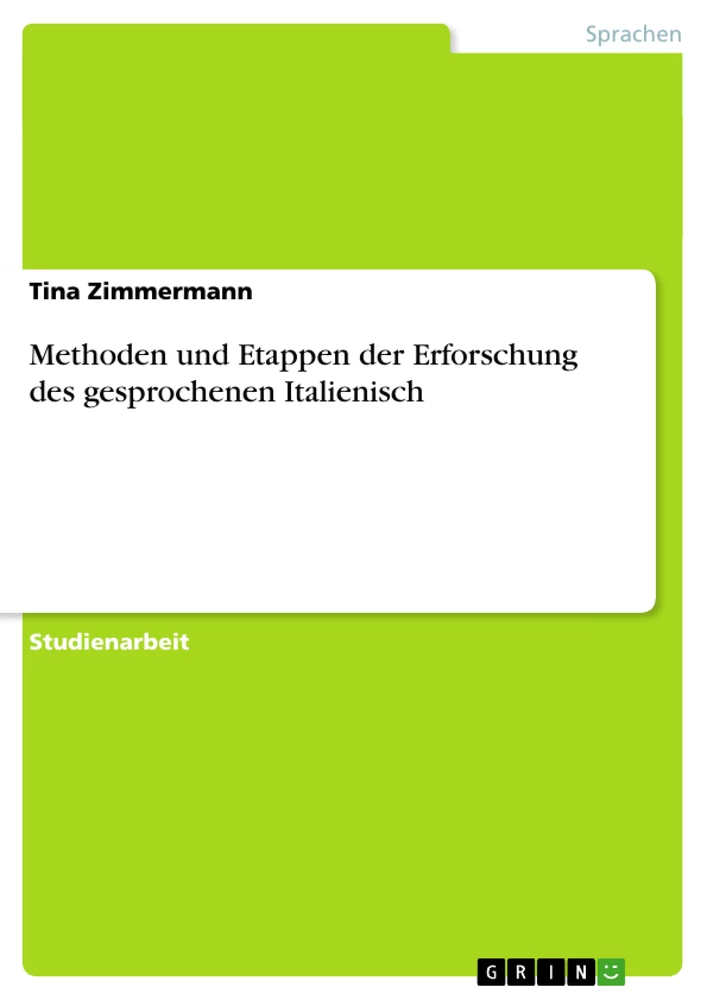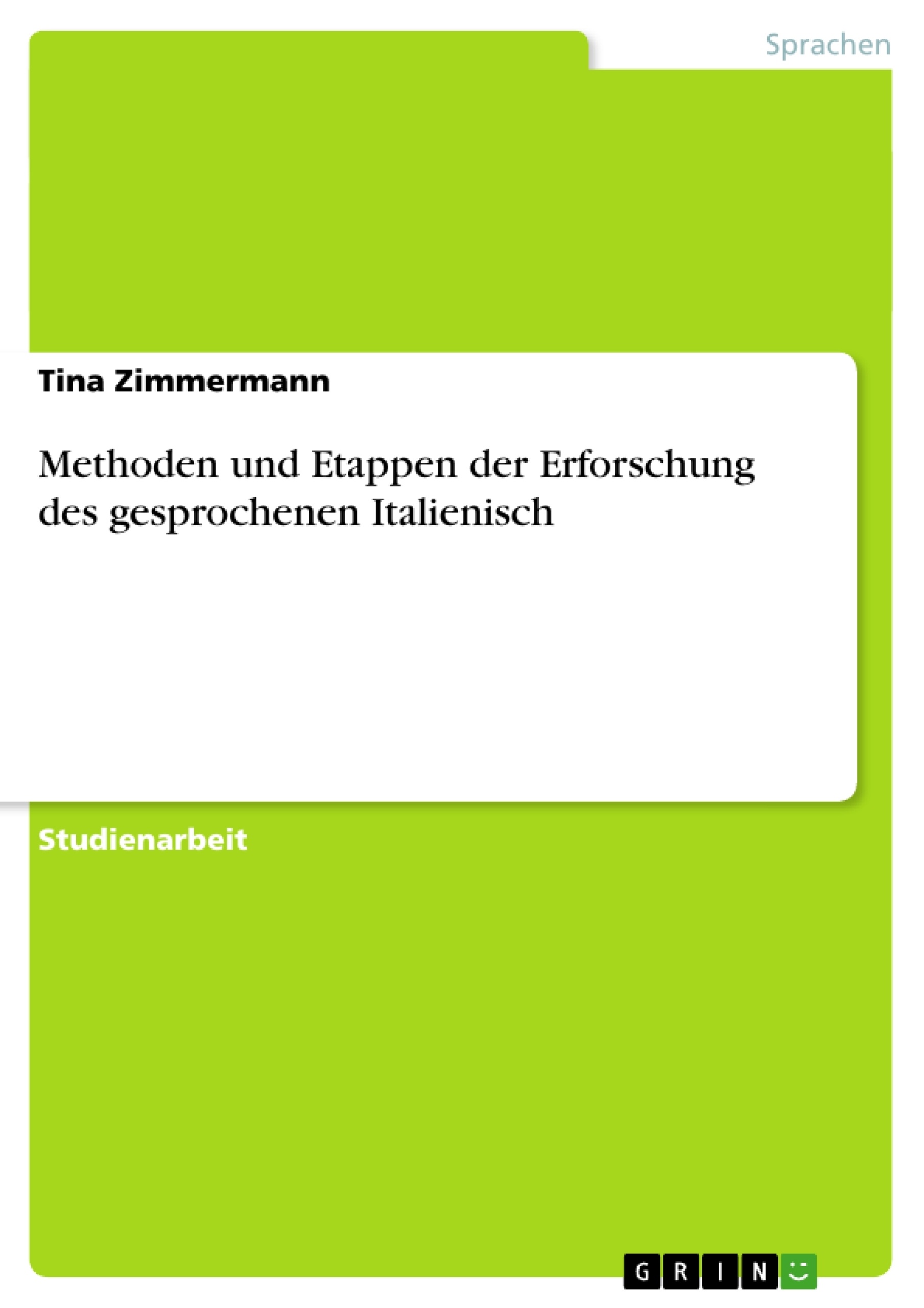1) Die italienische Sprache
Die italienische Sprache ist eine romanische Sprache aus der Familie der indogermanischen Sprachen und sie wird heute von ca. 66 Millionen Menschen hauptsächlich auf der italienischen Halbinsel gesprochen. Aber auch Korsika, der Süden der Schweiz, Sardinien und Sizilien sind Gegenden in denen das Italienische weit verbreitet ist. Italienisch ist die Sprache, die dem Lateinischen am ähnlichsten ist. Das liegt daran, dass Latein in Italien bis in die Neuzeit die Sprache der Kirche, der Verwaltung und er Wissenschaft war. Das lateinische Vokabular wurde jedoch nach und nach den sich ändernden Lebensbedingungen angepasst und als 1583 die Accademia della Crusca gegründet wurde, wurde diese mit ihren veröffentlichten Büchern maßgebend für Fragen der italienischen Sprache. Das erste bedeutende Wörterbuch, „Vocabolario degli Accademici della Crusca“, beinhaltet einen ersten einheitlichen nationalen Wortschatz. Trotzdem ist Italienisch erst seit der politischen Einigung in Italien 1860/61 die Amtssprache des Landes. Bis dahin sprach noch nicht die gesamte Sprachgemeinschaft ein und die selbe Sprache. Seit 1961 gibt es auch das erste Standardlexikon der italienischen Sprache: „Grande Dizionario della lingua italiana“.
Obwohl Italienisch eine Sprache mit vielen Dialekten ist spricht heute wohl kaum noch ein Italiener ausschließlich nur seinen Dialekt, ohne die Hochsprache zu verstehen. Die vielen Dialekte sind ein wichtiger Grund dafür, dass die italienische Sprache ein sehr interessantes Phänomen für Sprachwissenschaftler war und es bis in die Gegenwart geblieben ist.
2) Die Erforschung von Sprache
2.1.) Grundlagen
Die Linguistik ist eine sehr junge Wissenschaft. Sie beschäftigt sich mit der Erforschung und Beschreibung der Sprache und teilt sich dabei in mehrere Teilgebiete, wie zum Beispiel die Dialektologie, die sich damit beschäftigt, wie Sprache im geographischen Raum variiert oder die Etymologie1, die Psycholinguistik2 und die Sprachphilosophie3, um nur einige wenige zu nennen und sie alle verfolgen ein bestimmtes Ziel. Nämlich, hinter das Geheimnis von Sprache zu kommen.
2.2.) Ältere Ansätze der Sprachforschung
Die ersten Grammatiken gab es schon im 6. Jahrhundert v. Chr. und sie stammten aus Indien. Der indische Grammatiker Panini untersuchte und beschrieb darin Laute und Wörter des Sanskrit4.
Die Beschäftigung mit Sprache im heutigen Sinne entstand im 19.Jahrhundert und wurde durch die Erfindung des Buchdruckes, die Bibelübersetzungen in viele Sprachen und die allgemeine Entwicklung der literarischen Produktion überhaupt möglich gemacht. Doch schon 1860 wurde an der Universität Leipzig der Vorwurf laut, dass die Sprachwissenschaft bei ihrer Untersuchung der Schriftsprache den psychologischen Aspekt des Sprechers völlig vergessen würde. Dieser Vorwurf kam von den Junggrammatikern. Sie wollten den Sprecher als Individuum berücksichtigen und gesprochene Sprache beschreiben. Sie nahmen Sprache von verschienen Sprechern auf, welche sie sofort in Lautschrift zu Papier brachten. Diese Lautschrift wurde von den Junggrammatikern entwickelt und auch heute noch wird gesprochene Sprache damit transkribiert. Von ihnen stammt außerdem der Ausspruch: „Sprache lebt!“ und mit ihren Forschungen haben sie die Grundlagen für die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts gelegt. Die Fachkenntnis der Wissenschaftler ist heute nicht entschieden anders, sie ist nur methodischer geworden. Doch die Gesprochene - Sprache - Forscher wurden mehr und mehr mit dem Problem konfrontiert, dass es immer weniger Sprecher gab, die reinen Dialekt sprechen. Dieses Phänomen erschwerte enorm die diachrone uns synchrone Erforschung der gesprochenen Sprach und man war ständig auf der Suche nach „älteren Sprechern aus sozial niederen Schichten mit großer Ortsloyalität.“ (Edgar Radtke)
2.3.)Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert
An erster Stelle muss zu diesem Thema Leo Spitzer genannt werden. Er hat sich in den 20er Jahren des 20.Jahrhunderts mit gesprochener Sprache intensiv beschäftigt. Seine Umgangssprachenforschung „Aspekte der ungezwungenen mündlichen Rede des rednerisch veranlagten Italieners“ wird heute als Pionierleistung in der gesprochenen Spracheforschung angesehen. „Dass aber der Gebrauch z.B. von italienischen gi à , basta, per esempio, insomma, pazienza, cos ì , sai, poi genug des Eigenartigen bietet, wird jeder Leser zugeben müssen.“5 (GIGG, S.XV) Er und Karl Fossler6 waren der Meinung, dass der psychologische Aspekt des Sprechers untersucht und berücksichtigt werden muss. Der Mensch wäre ein Sprachschöpfer und Sprachbenutzer, der eine individuelle Sprache schafft. Laut Spitzer, der einen Teil seiner Forschungen auf Basis von Kriegsgefangenbrie fen betrieb, sind das Sprechen und die Literatur einer Sprache Ausdruck der Individualität der selbigen. Er benutzte außerdem Theaterstücke als Quellen für seine Forschungen, welche aber „parlato nello scritto”7 (GIGG, S.XIV) und nicht gesprochene Sprache waren. Spitzer bringt neue Theorien in der Darstellung der gespochenen Sprache, indem er zum Beispiel die Eröffnung des Gesprächs, Grußformeln und den Sprecher in bestimmten Situationen untersucht. Doch sein Werk bleibt ohne Erfolg und wird erst 1970 wieder aufgegriffen.
Die Prager Schule beschäftigte sich 1930 hauptsächlich mit der Erforschung der geschriebenen Sprache und hatte dabei den Mensch als Sprecher nicht im Blick. Mit der Erforschung der gesprochenen Sprache wurde aktiv erst 1960 begonnen. Heute ist die gesprochene Sprache Forschung ein wichtiger Teil der Sprachwissenschaft!
3) Die Erforschung der gesprochenen Sprache
3.1.) Neue Ansätze
Seit 1960 erlebte die Erforschung der gesprochenen Sprache einen rasanten Anstieg. Die aufkommende Textlinguistik war damals eine neue Forschungsrichtung und förderte die Vorstellung, dass die geschriebene Grammatik anders ist als die gesprochene. Die Textlinguistik legte diese Unterschiede in grammatischen Anordnungen mehr oder weniger ungewollt dar und daraus entwickelten sich neue Kategorien in der Untersuchung von satzübergreifenden Zusammenhängen. Dies geschah hauptsächlich in der gesprochenen Sprache. Die Forschung gewinnt dem Gesprochenen mehr Sensibilität ab und die Pragmalinguistik wird neuer Ausgangspunkt für die Gesprächsanalyse, welche die intendierte oder tatsächliche Wirkung einer sprachlichen Äußerung auf den Adressaten beschreibt. Es wird dabei untersucht, welche sprachlichen Mittel ein Sprecher in bestimmten Situationen anwenden muss, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.
3.2.) Fehler der neueren Generation
Die Generative Transformationsgrammatik, die von Noam Chomsky Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde, wurde von den Sprachwissenschaftlern des 20. Jahrhunderts als nicht korrekt angesehe n. Diese Grammatik ging nämlich davon aus, dass der ideale Sprecher spricht wie er schreibt. Doch die Syntaktiker der neuen Generation erkannten eine große Kluft in der Satzorganisation des gesprochenen und geschriebenen Italienisch. Deren Syntaxforschungen führen einmal mehr dazu, dass die Zweigseitigkeit (Dichotomie) der Sprache verfestigt wird. Ferdinand de Saussure8 erkannte diese Dichotomie schon Ende des 19. Jahrhunderts doch seinem Gebot vom Primat der gesprochenen Sprache wird erst jetzt, Mitte des 20. Jahrhunderts, gebührend Rechnung getragen und der Deskriptivismus verliert langsam aber sicher an Anreiz.
3.3.) Die Gesprochene - Sprache - Forschung
Die gesprochene Spracheforschung bezieht sich hauptsächlich auf die Gegenwart. Doch das Bewusstsein dringt auch in die Darstellung des Gesprochenen in der Sprachgeschichte vor. Bei der diachronen Linguistik tut sich jedoch das Problem auf, dass diese Forschungen sehr vage und umstritten sind, da sie wieder nur auf Textgrundlagen beruhen.
Heute weitet sich die Gesprochene - Sprache - Forschung immer mehr aus und hat einen festen Platz in der Sprachwissenschaft erlangt. Man sucht nicht mehr nur nach einem einzigen Sprachrepräsentanten sondern nach mindestens 4 bis 6 Sprechern, die nach sozialen, alters- und geschlechtsspezifischen Merkmalen gruppiert werden. Auf diese Art und Weise gelangt man immer wieder zu beeindruckenden Ergebnissen, wie zum Beispiel Radtkes Entdeckung 1990, dass die Kenntnis der heimatlichen Mundart gerade bei der jüngeren Generatio n wieder „in Mode“ gerät.
4.) Erforschung des gesprochenen Italienisch
4.1.) Erste Ansätze
Die Volkssprachliche Beschreibung des Italienischen fehlt bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts völlig und erst seit 1950/60 wird das Kriterium der Alltagssprachlichkeit präziser gefasst. Nach Spitzers Forschungen blieb die Italianistik offensichtlich für mehrere Jahrzehnte von den Untersuchungen der gesprochenen Sprache ausgeschlossen wenn man einmal von der Erstellung des AIS absieht. Der AIS9 (Atlante Italo Svizzero) ist ein Produkt der Geolinguistik und erfasst den Dialektzustand einzelner Aufnahmeorte. Erst 1950 beginnt man mit der Beschreibung des Gegenwartsitalienischen. Dabei rückt das Regionalitätskriterium durch das Erfassen des mündlichen Sprachgebrauchs stark in den Vordergrund. 1956 schreibt Rüegg seine Dissertation über die Regionalsprachenforschung, welche zu einer neuen Etappe auf diesem Gebiet wird, denn durch ihn und sein Werk verliert das Italienische das Ansehen ein rein präskriptives Untersuc hungsobjekt zu sein. 1963 beschäftigt sich auch DeMauro mit einem neuen Standard der Darstellung indem er das Italienische in „italiano parlato“ und „ialaliano popolare“ gliedert. Doch auch diese Gliederung verkörpert nur einen Teil des Ganzen. Denn auch zu diesem Zeitpunkt ist das gesprochene Italienisch immer noch nicht als eigene Größe thematisiert und solche Wortmeldungen werden demzufolge kaum von der Wissenschaft wahrgenommen.
4.2.) Professionelle Untersuchungen
Im November 1967 fand in Palermo ein Kongress mit wichtigen Sprachwissenschaftlern statt. Seit diesem Kongress ist das Gesprochene erstmals eine eigenständige Größe! Lemsky (Wissenschaftsgeschichte), Varvaro (sprachgeschichtliche Kompetenz), Durante (morphosyntaktische Unterschiede des gesprochenen und geschriebenen Italienisch) und DeMauro (Modelle für gesprochenes und geschriebenes Italienisch) beschäftigten sich intensiv mit der italienischen Sprache. Dieser Kongress brachte der Sprachwissenschaft viele Neuorientierungen die jedoch nie weitergeführt wurden.
Von 1973-1980 gab es drei Sprachwissenschaftler, die den Versuch der gesprächsanalytischen Untersuchung der italienischen Sprache unternahmen. Orletti, Parisi und Castelfranchi stellten dabei eine enge Beziehung zur pragmatischen Begebenheit auf. Ihre Untersuchungen beruhten auf textlinguistischen Methoden, doch da die Organisation der Textlinguistik noch nicht ausgereift war, wurde auch ihre Arbeit nur wenig rezipiert.
1981 setzte dann Sornicola einen neuen Meilenstein indem er eine Monographie zur gesprochenen Sprache herausbrachte. Diese erweist sich für weitere Forschungen als ertragreiche Fundierung, da sie auf textsyntaktischer Grundlage eine erste Organisation des gesprochenen Italienisch darstellt. Ohne diese Grundlagen ist die Erforschung der gesprochener Sprache nahezu unmöglich oder bringt keine tragenden Ergebnisse, wie dies auf dem Kongress in Palermo oder in den Forschungen von Orletti, Parisi und Castelfranchi der Fall war.
Weiterhin fördernd für das grundlegende analytische Verständnis in Italien sind gesprächsanalytische Forschungen von Berutto, Orletti und Stati, die ihre Ergebnisse in Grundsatzreferaten festhielten.
1983 erscheint dann der Zingarelli, welcher zwar eine wertvolle, schnellvollzogene Neologismenausweitung war, aber nicht auf den sprechsprachlichen Bereich einging!
4.3.) Forschungsperspektiven
Die Sprachwissenschaftler verfolgen heute das Ziel das „italiano parlato“ nicht mehr nur auf nationaler Ebene darzustellen. Nicht nur italienische Linguisten ze igen Interesse an der Erforschung des gesprochenen Italienisch und die Sprache bekommt endlich die Aufmerksamkeit, die anderen Sprachen auch zugebracht wird. Die Erkenntnis, das Italienisch nicht mehr Latein ist sondern eine eigenständige Sprache wurde nic ht nur von nationalen Wissenschaftlern wahrgenommen. Es besteht ein tiefgreifendes kontinuierliches Interesse an dieser Sprache und auch oder gerade weil die Erforschung jener noch sehr lückenhaft ist, steht der eigentlich Forschungsertrag noch aus.
5) Forschungsschwerpunkte
5.1.) Fragen der Korpusstellung
Zur Untersuchung einer Sprache sind Korpora10 ein unabkömmliches Hilfsmittel. Eigentlich sind sie die Grundlage der Gesprochenen - Sprache - Forschung und deshalb von unschätzbarem Wert für Linguisten. Leider liegen im Italienischen nur sehr wenige Korpora vor. So wenige, dass sie hier im Ganzen aufgezählt werden können.
Der erste stammt von Stammerjohann und wurde 1970 erstellt. Es handelt sich hierbei um einen der umfangreichsten Korpora der italienischen Sprache. Bestehend aus 11 Erzählungen und Geschichten wurde jener zur Analyse der Vergangenheitstempora erstellt. Er verfügt über eine elaborierte Transkribtion.
Erst 1976 wurde von Arnuzzo ein zweiter Korpus erstellt. Er lies vier 60-65jährige Männer aus ihrem Leben erzählen und auch Arnuzzo hat seine Aufzeichnungen phonetisch transkribiert und benutzte sie zur Untersuchung des „italiano popolare“. Heute wird jedoch davon gesprochen, dass das sprachliche Niveau dieses Korpus` weit über dem „italiano popolare“ liegt und als Grundlage für die Gesprochene - Sprache - Forschung herangezogen werden kann.
Rovere präsentierte 1977 einen Korpus bestehend aus zwölf Interviews mit italienischen „emigranti“ aus unterschiedlichen Regionen Italiens. Auch er wollte damit das „italiano popolare“ manifestieren und Charakteristika des gesprochenen Italienisch aufzeichnen. Warum Rovere auf die Transkribtion seines Korpus verzichtete ist nicht ganz klar, aber seine Arbeit ist heute trotz allem eine sehr gute Präsentation der Varietäten des Italienischen; aus dem genannten Grund der unterschiedlichen Herkunftsregionen der interviewten Personen.
Ein Nebenprodukt einer größeren Studie ist der Korpus von Poggi. Poggi erforschte die in Mailand gesprochene Sprache und führte dabei sehr detailliert die Schwierigkeiten einer solchen Datenerhebung auf.
Der für heutige Forschungen verwendete Korpus aus dieser Studie ist die Aufzeichnung einer Erzählung eines älteren Lombarden.
Sprachliches Interaktionsverhalten untersuchten Collovà und Petrini 1981/82 indem sie sich für ihre Forschungen in eine Metzgerei in der Nähe von Lugano begaben und dort 13 Verkaufsgespräche aufzeichneten. Dabei achteten sie genau auf den Wechsel von Hochsprachengebrauch und Dialekt.
Radtke nahm 1983 ein 13minütiges Radiointerview auf, welches heute für die Beschreibung des gesprochenen Italienisch gut geeignet ist, da diatopisch und diastratisch unmarkiert. Außerdem ist die gegebene Dialogsituation sehr von Vorteil.
1990 trugen Edgar Radtke und seine Mitarbeiter die Dialekte Kampaniens in einem Sprachatlas zusammen, in dem sie mit Mikrophon und Bleistift Interviews mit „ganz normalen Menschen“ dieser Region durchführten.
Diese sieben Korpora sind sehr wenige im Vergleich zu anderen Sprachen und ohne ausreichende Datenbanken haben Aussagen zum gesprochenen Italienisch auch nur provisorischen Wert. Deshalb steht die Italienische Sprachforschung, wie gesagt, erst am Beginn ihres eigentlichen Durchbruchs!
5.2.) Die andere Grammatik
Wie am Anfang bereits erwähnt sind Linguisten heute der festen Meinung, dass es schwerwiegende Unterschiede zwischen der Grammatik der geschriebenen und der gesprochenen Sprache gibt. Deshalb ist man auf der Suche nach einer vollständigen Grammatik. Weder historische noch Schulgrammatiken beziehen das präskriptive Italienisch mit ein.
Ein Werk, welches dem Versuch des Einbeziehens des gesprochenen Italienisch am nächsten kommt, ist die Grammatik von Battaglia und Pernicone (1951/1978). Doch bei diesem Werk besteht das Problem, das die Besonderheiten der Normdiskrepanz zwischen Geschriebem und Gesprochenem nicht gesehen werden.
Seit einiger Zeit gehen aber insbesondere Schulgrammatiken auf die syntaktischen Muster des gesprochenen Italienisch ein. Dabei sind Linguisten wie Dardano und Trifone (1983) und Sabatini und Simone (1984) zu nennen. Es wird also deutlich, das der präskriptive Bereich der italienischen Sprache mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.
Für die Wichtigkeit des gesprochenen Italienisch setzt sich vor allem Ochs ein, indem er von einem „planned“ und „unplanned dicourse“ (GIGG,S.XX) spricht und sich damit in seinen Sprachuntersuchungen rein auf das Gesprochene konzentriert. Auch Dardano und Trifone stellen 1983 heraus, dass „in ogni caso il parlare (come il scrivere) comporta un progetto…” (GIGG,S.XX) und die “pianificazione del discorso parlato”(GIGG,S.XX) ist bei Simone 1984 ein entscheidender Grundsatz für seine Forschungen und Beschreibungen der Sprache. 1984 beschäftigt sich auch Sabatini damit die Eigenschaften des Gesprochenen gegenüber dem Geschriebenen herauszuarbeiten, aber keiner der Wissenschaftler bezieht direkt Stellung zu einer eigenständigen Grammatik des „italiano parlato“. Nur Simone ist 1984 der Meinung, dass „I discorsi parlati (esclusi quelli in pubblico) hanno una grammatica solitamente più povera e più semplice di quella dei discorsi scritti!” (GIGG,S.XX) Doch auch seine Grammatik, die sich ausschließlich auf das gesprochene Italienisch bezieht, umfasste letztendlich nur vier Seiten, sodass auch dies nic ht als endgültige Lösung für die Differenzierung der beider Grammatiken angesehen werden kann. Aber die Untersuchungen dieser Wissenschaftler zeigen, das es bestimmte grammatikalische Regeln für das gesprochene Italienisch gibt, die sich vom Geschriebenen unterscheiden!
Ganz anderer Meinung ist hingegen Holtus 1984. Für ihn sind die Eigenheiten des gesprochenen Italienisch übereinzelsprachlich und regional bedingt. „Non esiste in italiono […] una grammatica della lingua parlata indipendente […]”(GIGG,S.XXII) Für ihn sind die Varietäten durch die Dialekte hervorgerufen und deshalb verdienen sie auch keine eigene Grammatik. Wenn man genauere Betrachtungen aufstellt, kann man sehen, dass Holtus recht hat und das es lediglich einige grammatikalische Formen gibt, die im gesprochenen Italienisch kaum verwendet werden, wie zum Beispiel das futuro anteriore.
Deshalb greift man heute bei Untersuchungen auf pragmatische Konstanten in der Syntaxanalyse zurück. Diese messen die Text- und Satzstrukturen nicht mehr allein an grammatikalischen Kategorien. Geschriebenes und Gesprochenes wird dabei zwar immer noch voneinander abgegrenzt, aber man geht nicht mehr von einer strikten Eigenständigkeit der beiden Größen aus. Damit steht nicht mehr die Frage nach der anderen Form im Vordergrund sondern die Suche nach der Beschaffenheit der gesprochenen Sprache; man trennt jetzt in grammatischen Formenaufbau und kommunikationsbedingte Zuschreibung. Sornicola unterstütze Holtus in dieser Meinung und spricht davon, dass „ i fenomeni di parlato determinati da tali fattori siano riconducibili all` esecuzione e non alla competenza.” (GIGG,S.XXIV) Deswegen spricht man nicht mehr von einer anderen Grammatik, sondern von einer “grammatica liberalizzata“. (GIGG.SXXIV), wobei Berruto aber immer noch nahe legt dass eine Ergänzungsgrammatik in Hinsicht auf Methodologie und Sprachmaterial des gesprochenen Italienisch nicht falsch sein kann und darauf beruhend erfährt die italienische Grammatikschreibung durch die Gesprochene - Sprache - Forschung eine inhaltliche Ausweitung.
5.3.) Neue Perspektiven in der Syntaxforschung des gesprochenen Italienisch
Die Grundlagen für diese Untersuchungsweise legt Spitzer schon 1922. Er hat damals die Kriegsgefangenenbriefe auf regionale Unterschiede untersucht indem er sie als expressive Grundlage gesehen hat. Heute ist die Expressivität für die Gesprochene - Sprache - Forschung kein Einzelkriterium mehr. Man sieht heute jede Kommunikation im gesprochenen Sinn als situationsgebunden an, obwohl ein gemeinsamer Parameter zum Vergleich von Sprache und Schrift immer noch fehlt. Aus diesem Grund wird die Expressivität mehr und mehr zu einer banalen Größe und man bezieht sich in den Forschungen nur noch auf die Analyse von dialoggrammatischem Hintergrund der auf Fragen nach der schriftlichen Normadäquatheit verzichtet. Man wertet heute nur noch den „Normalfall“ als relevantes Untersuchungsobjekt und distanziert sich von der reinen, nur auf den Sprechakt bezogenen, Markierung. Dies eröffnet der Syntaxforschung neue Perspektiven, die sich auf die Thema - Rhema - Gliederung11 und die Pronominalisierung erstrecken.
Doch nicht nur in der Expressivität, sondern auch in der Syntax hat die Performanz in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die generativistische Beschreibungsebene wurde hinten angestellt und es wurde darauf verzichtet neue homogene, in sich geschlossene Theorien aufzustellen. Damit hat die Syntaxforschung ein neues Maßan Originalität geschaffen und die Thema - Rhema - Forschungen in der Prager Schule Italiens einen großen Stellenwert eingenommen. Trotz allem liegt noch keine geschlossen Beschreibung des „italiano parlato“ vor, und es gibt auch keinen Wissenschaftler der dies in nächster Zeit anstrebt. Das einzige, was die Prager Schule in ihrer „communicative importance“ anstrebt, ist die Manifestation des Sprechers im Sprechakt.
6.) Lexika als Ergebnisse der Forschungen
Da in der Sprachwissenschaft das gesprochene und geschriebene Italienisch immer noch als weitgehend identisch empfunden wird werden in Lexika Differenzierungen nur auf diatopische (DeFelice) und diastatische (Cotelazzo) Kriterien bezogen. Was demnach bedeutet, das man nur auf Unterschiede zwischen Standard und Substandard genauer eingeht. Auch auf die Beschreibung der lexikalischen Beschaffenheit des gesprochenen Italienisch wurde bisher nicht eingegangen.
Das Lexikon des „italiano parlato“ hat das Ziel Sachverhalte verallgemeinert darzustellen und nicht auf die Variationsbeschränkungen, die es im Italienischen durch die zahlreichen Dialekte im Überfluss gibt, einzugehen. Dies zu tun wird dem AIS überlassen. Auf den Sprechwortschatz, der, mit seinen vielen Metaphern und Metonymien, eine viel höhere Expressivität aufweist als die Schriftsprache wird auch in keinem Lexika eingegangen. Um dies zu berücksichtigen müsste man eine minutiöse Darstellung anstreben, die weder im Italienischen noch in anderen Sprachen möglich ist. Aus demselben Grund gibt es auch noch kein Lexikon, welches die Italienische Umgangssprache beinhaltet. Einige Lexika beinhalten jene zwar, aber wenn, dann auch nur sporadisch. Auch Neologismen werden in der italienischen Sprache sehr benachteiligt. Die letzte Aufführung dieser ist im Zingarelli von 1983 vorgenommen wurden, was zeigt, dass es an dieser Stelle einer dringenden Aktualisierung bedarf. Doch nicht nur auf diesem Gebiet sondern auch auf dem Gebiet der Gesprächswörter fehlen aktuelle Untersuchungen und deren Auflistung.
Wenn man es genauer betrachtet, stellt das Aufnehmen von Gesprächswörtern in das Le xikon gar kein all zu großes Problem dar. Man müsste einfach diese Wörter mit dem Zusatz „parlato“ versehen. Diese Meinung vertreten Holtus und Radtke in ihrer Zusammenfassung des Deutschen Romanistentages von 1983 „Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart“.
7) Zusammenfassung
Die Gesprochene - Sprache -Forschung der italienischen Sprache ist noch lange nicht an dem Punkt angekommen an dem sie gern wäre und die Forschungen werden auch auf lange Sicht nicht abgeschlossen werden. Italienisch ist mit seiner Dialektvielfalt sicher weiterhin ein aktuelles Thema in der Linguistik. Doch trotzdem werden an einigen Stellen der Sprachwissenschaft Bedenken laut, dass das Sprachverhalten als sozialwissenschaftliche Komponente verschwinden könnte. Das dies aber kein ernst zu nehmendes Problem ist, zeigt die Bedeutsamkeit der pragmatischen Untersuchungen der Sprache. Die Forschung hat zwar die Anwendungsproblematik der 12 situationsgebundenen Untersuchungen von Sprache noch nicht zufriedenstellend gelöst aber dass man Sprache heute nicht mehr erforschen bzw. untersuchen kann ohne dabei auf die Situation anzugehen, in der sie angewandt wird, ist wohl eindeutig erkennbar. „Die menschliche Rede hat eine individuelle und eine soziale Seite und die eine kann ohne die andere nicht verstanden werden.“ Man spricht heute sogar davon, dass man das Interaktionsverhalten mit der Pragmatik gleichsetzt.
Durch den rasanten Aufbau der italienischen Universitäten im geisteswissenschaftlichen Bereich darf man auch auf baldige neue Forschungsergebnisse hoffen. Selbst Sprachhistoriker zeigen sich offen gegenüber den neuen Forschungsansätzen und sind bereit diese in ihre Rekonstruktionen aufzunehmen. Die Studien, die im Moment in der Italienischen - Sprache - Forschung laufen, sind zwar kaum auf einen Nenner zu bringen, aber es sind doch drei wesentliche Neuerungen zu erkennen.
An erster Stelle steht die Bemühung der italienischen Sprachwissenschaft um neue Korpora. Ohne diese sind Forschungen in der gesprochenen Sprache einfach nicht machbar oder können nur auf Theorien beruhen.
Durch neue Methodologien und Methoden öffnet sich die Sprachwissenschaft dem „italiano parlato“. Dadurch entsteht eine größere Kluft zwischen theoretischer Grundlegung und Textinterpretation, was für die Gesprochene - Sprache - Forschung nur von Vorteil sein kann um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Denn nur das Forschen nach neuen Methoden kann auch den Forschungsertrag erheblich vergrößern und erneuern.
Man sieht in der italienischen Sprechsprache heute einen „uso medio“, der sich immer mehr auf die Neutralisation der diatopischen und diastratischen Faktoren hinbewegt. Demnach können diese nicht mehr vorrangig als Forschungsgrundlage herausgestellt werden was wiederum beweist, dass neue Methoden von unumgänglicher Wichtigkeit sind und das dieses Thema der Gesprochene - Sprache - Forschung eventuell auch immer noch in ihren Anfängen steht.
Bibliographie
Holtus, Günther/ Radtke, Edgar (Hrsg.): Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart.Tübingen:Gunter Narr Verlag,1985.
DesSaussure, Ferdinand: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft
Radtke, Edgar: „Süditalien - Dialekte im Wandel“, aus: Romanisches Seminar, Heidelberg.1990
Microsoft Encarta 99, Enzyklopädie
[...]
1 Suche nach Verwandtschaft von Wörtern und Formen innerhalb verschiedener Sprachen
2 befasst sich mit den Vorgängen des Spracherwerbs sowie den Prozessen, die bei der Sprachproduktion und beim Sprachverstehen eine Rolle spielen
3 untersucht die Sprache als Darstellungsmittel wissenschaftlicher Erkenntnisse
4 alte indische Sprache, wird heute in der Literatur verwendet 3
5 Leo Spitzer, 1922
6 Vertreter der idealistischen Sprachwissenschaft
7 Nenciolini (1976)
8 1857-1913, Professor an der Uni Genf
9 von: Karl Jaberg und Jakob Jud, 1928-40, Zofingen
10 Sammlung sprachlichen Materials, unter bestimmten Gesichtspunkten zusammengestellt 9
11 Thema: bekannt fi was wird dazu gesagt: Rhema -interessant Ansätze zu diesem Thema bot das Frankfurter Kolloquium im April 1985, dessen Akten von Stammerjohann herausgegeben wurden
Domande frequenti
Was ist das Thema des Textes "Die italienische Sprache"?
Der Text behandelt die Erforschung der italienischen Sprache, insbesondere der gesprochenen Sprache (italiano parlato). Er untersucht die Geschichte der Sprachforschung, die Entwicklung der Methoden zur Untersuchung der gesprochenen Sprache und die Herausforderungen bei der Erstellung von Korpora und Grammatiken für das gesprochene Italienisch.
Welche Teilgebiete der Linguistik werden im Text erwähnt?
Im Text werden Dialektologie, Etymologie, Psycholinguistik und Sprachphilosophie als Teilgebiete der Linguistik genannt.
Wer waren die Junggrammatiker und welchen Beitrag leisteten sie zur Sprachforschung?
Die Junggrammatiker waren eine Richtung in der Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Sie betonten die Bedeutung des Sprechers als Individuum und der gesprochenen Sprache. Sie entwickelten eine Lautschrift zur Transkription gesprochener Sprache und legten damit die Grundlagen für die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts.
Wer war Leo Spitzer und warum ist seine Forschung wichtig?
Leo Spitzer war ein Sprachwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, der sich intensiv mit gesprochener Sprache beschäftigte. Seine Umgangssprachenforschung "Aspekte der ungezwungenen mündlichen Rede des rednerisch veranlagten Italieners" wird als Pionierleistung in der gesprochenen Spracheforschung angesehen.
Was ist die Textlinguistik und welche Rolle spielt sie bei der Erforschung der gesprochenen Sprache?
Die Textlinguistik ist eine Forschungsrichtung, die sich mit satzübergreifenden Zusammenhängen in Texten befasst. Sie trug dazu bei, die Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Grammatik hervorzuheben und neue Kategorien in der Untersuchung der gesprochenen Sprache zu entwickeln.
Was ist die Generative Transformationsgrammatik und warum wurde sie kritisiert?
Die Generative Transformationsgrammatik wurde von Noam Chomsky entwickelt und ging davon aus, dass der ideale Sprecher spricht wie er schreibt. Sie wurde kritisiert, weil sie die Kluft in der Satzorganisation des gesprochenen und geschriebenen Italienisch ignorierte.
Was ist der AIS (Atlante Italo Svizzero) und welchen Zweck erfüllt er?
Der AIS ist ein Produkt der Geolinguistik und erfasst den Dialektzustand einzelner Aufnahmeorte in Italien und der Schweiz.
Was sind Korpora und warum sind sie für die Gesprochene-Sprache-Forschung wichtig?
Korpora sind Sammlungen sprachlichen Materials, die unter bestimmten Gesichtspunkten zusammengestellt werden. Sie sind die Grundlage der Gesprochene-Sprache-Forschung und dienen als Datenbasis für linguistische Analysen.
Welche Probleme gibt es bei der Erstellung von Lexika für das gesprochene Italienisch?
Es gibt Probleme bei der Erstellung von Lexika für das gesprochene Italienisch, da Differenzierungen oft nur auf diatopische und diastratische Kriterien bezogen werden. Es fehlt an Beschreibungen der lexikalischen Beschaffenheit des gesprochenen Italienisch, insbesondere des Sprechwortschatzes mit seinen Metaphern und Metonymien.
Was sind die gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte in der Erforschung des gesprochenen Italienisch?
Die gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte umfassen die Erstellung neuer Korpora, die Entwicklung neuer Methodologien und Methoden zur Erforschung des "italiano parlato" und die Untersuchung des "uso medio", der sich immer mehr auf die Neutralisation der diatopischen und diastratischen Faktoren hinbewegt.
- Arbeit zitieren
- Tina Zimmermann (Autor:in), 2001, Methoden und Etappen der Erforschung des gesprochenen Italienisch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104164