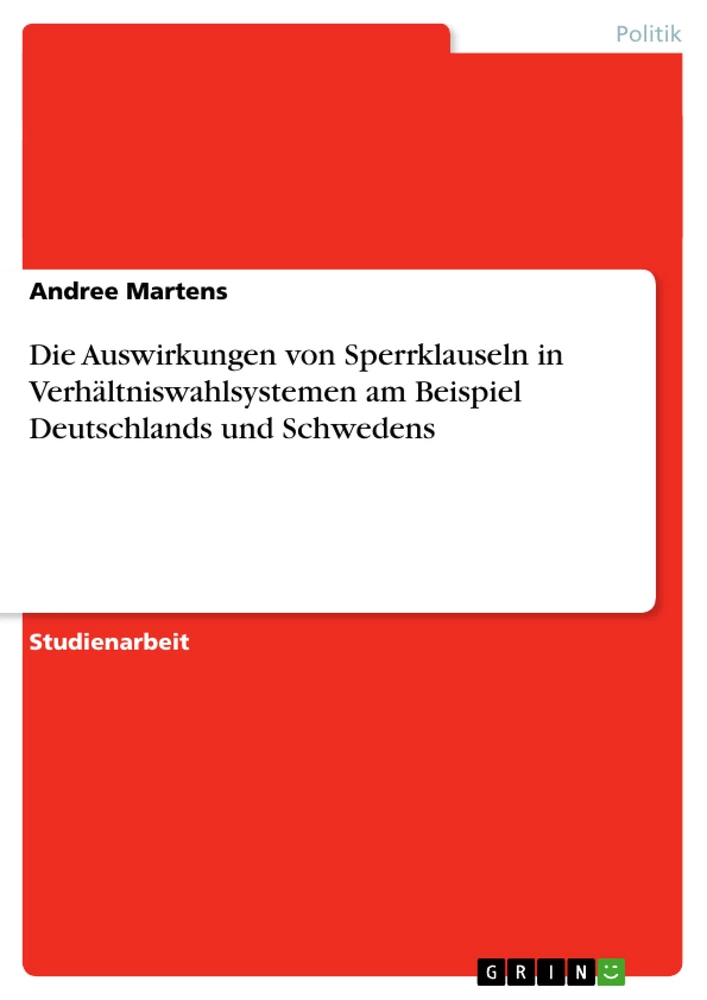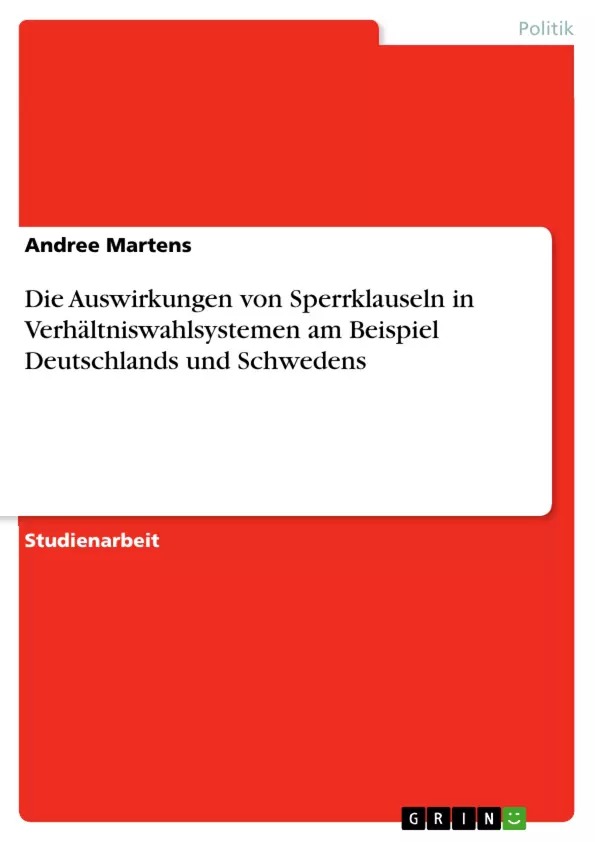Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den Auswirkungen der Sperrklausel als technisches Instrument des Wahlsystems auf das Parteiensystem. Betrachtet werden zwei Verhältniswahlsysteme, zum einen die Bundesrepublik Deutschland mit einer festgesetzten Hürde von 5% und zum anderen das Königreich Schweden, wo eine 4%-Hürde gilt.
Bei führenden Autoren der Parteienforschung wird Wahlsystemen eine bedeutende Rolle bei der Bildung der Parteiensysteme zugesprochen. Arend Lijphart, Giovanni Sartori und andere sehen im Wahlsystem die Grundlage zur Schaffung eines stabilen Parteiensystems. Lijphart formuliert: „Among the most important - and, arguably, the most important - of all constitutional choices that have to be made in democracies is the choice of the electoral system.“1 Sartori schreibt vom Wahlsystem als dem „most essential part of the workings of a political system.“2
Das Element der Sperrklausel ist insofern interessant, da es innerhalb der beiden betrachteten Verhältniswahlsysteme ihrem Repräsentationsprinzip entgegenwirkt. Dem Repräsentationsprinzip des Verhältniswahlsystems ist zum Ziel gesetzt, eine möglichst genau dem Wählerwillen entsprechende Sitzverteilung in der Volksvertretung zu generieren.3 Aufgrund der Sperrklauseln wird eine bestimmte Anzahl von Stimmen bei der Mandatsvergabe nicht berücksichtigt und damit die Proportionalität von abgegeben Stimmen und erhaltenen Mandaten eingeschränkt. Aus diesem Grund bezeichnet Giovanni Sartori Sperrklauseln sogar als „strongly non-propotional“ und sieht sie als sehr bedenklich in Verhältniswahlsystemen an, nicht nur weil ein bestimmter Stimmenanteil bei der Mandatsvergabe nicht berücksichtigt wird, sondern auch weil durch die Umverteilung der Mandate auf die Parteien, die die Sperrhürde übersprungen haben, weitere Disproportionalitäten entstehen nach Meinung Sartoris. 4 Inwieweit die Sperrhürden tatsächlich die Proportionalität von Stimmen und Mandaten in den beiden zu betrachtenden Verhältniswahlsystemen einschränken ist Gegenstand der folgenden Analyse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I.) Mehrheitswahl und Verhältniswahl
- II.) Die Wirkung von Wahlsystemen
- III.) Zum Begriff der Sperrklausel
- IV.) Die Wirkung der Wahlkreisgröße
- VI.) Zur Diskussion um die Sperrklausel
- VII.) Die Bundesrepublik Deutschland
- VII.1) Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland
- VII.2) Zur Disproportionalität von Stimmen und Mandaten
- VII.3) Die Frage der Parteienoligarchie
- VIII.) Das Königreich Schweden
- VIII.1) Das Wahlsystem Schwedens
- VIII.2) Zur Disproportionalität von Stimmen und Mandaten
- VIII.3) Die Frage der Parteienoligarchie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Sperrklausel als technisches Element des Wahlsystems auf die Entwicklung von Parteiensystemen. Dabei werden die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Schweden als Beispiele für Verhältniswahlsysteme mit unterschiedlichen Sperrklauseln betrachtet.
- Die Rolle des Wahlsystems bei der Gestaltung von Parteiensystemen
- Der Einfluss der Sperrklausel auf die Proportionalität von Stimmen und Mandaten
- Die Auswirkungen der Sperrklausel auf die Chancen kleiner Parteien
- Die Debatte um die Sperrklausel im Kontext von Verhältniswahlsystemen
- Die Frage der Parteienoligarchie in Deutschland und Schweden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Gegenstand der Arbeit und die Relevanz des Themas im Kontext der Parteienforschung dar. Im ersten Kapitel werden die Grundtypen von Wahlsystemen, Mehrheits- und Verhältniswahl, definiert und ihre unterschiedlichen Repräsentationsprinzipien erläutert.
Kapitel II beleuchtet die Wirkung von Wahlsystemen auf die Entwicklung von Parteiensystemen. Es werden die typischen Folgen von Mehrheits- und Verhältniswahlsystemen im Hinblick auf Parteienkonzentration und -zersplitterung diskutiert.
Im dritten Kapitel wird der Begriff der Sperrklausel definiert und ihre Funktion in Verhältniswahlsystemen erläutert. Kapitel IV beschäftigt sich mit der Wirkung der Wahlkreisgröße auf das Parteiensystem und hebt die Bedeutung dieses Faktors für die Analyse des konzentrierenden Effekts von Sperrklauseln hervor.
Kapitel VI geht auf die Diskussion um die Sperrklausel ein und beleuchtet die Kritikpunkte, die gegen dieses Element des Wahlsystems vorgebracht werden. Die Kapitel VII und VIII widmen sich der Analyse des deutschen und schwedischen Wahlsystems, wobei die Auswirkungen der Sperrklausel auf die Proportionalität von Stimmen und Mandaten sowie die Frage der Parteienoligarchie untersucht werden.
Schlüsselwörter
Wahlsystem, Verhältniswahl, Sperrklausel, Parteienkonzentration, Parteienoligarchie, Proportionalität, Disproportionalität, Bundesrepublik Deutschland, Königreich Schweden, Parteienforschung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat eine Sperrklausel im Wahlsystem?
Sie dient der Parteienkonzentration und soll eine zu starke Zersplitterung des Parlaments verhindern, um die Regierungsbildung stabil zu halten.
Wie hoch sind die Sperrhürden in Deutschland und Schweden?
In der Bundesrepublik Deutschland gilt eine 5 %-Hürde, während im Königreich Schweden eine 4 %-Hürde für den Einzug in das Parlament besteht.
Warum kritisieren Forscher wie Giovanni Sartori Sperrklauseln?
Sartori sieht sie als „stark nicht-proportional“ an, da sie den Wählerwillen verzerren und Stimmen für kleine Parteien bei der Mandatsvergabe ignorieren.
Was ist das Repräsentationsprinzip der Verhältniswahl?
Ziel ist eine möglichst genaue Übereinstimmung zwischen dem Anteil der abgegebenen Stimmen und der Verteilung der Sitze in der Volksvertretung.
Was versteht man unter „Parteienoligarchie“?
Der Begriff beschreibt die Machtkonzentration bei wenigen etablierten Parteien, die durch Instrumente wie Sperrklauseln vor neuer Konkurrenz geschützt werden.
- Arbeit zitieren
- Andree Martens (Autor:in), 2002, Die Auswirkungen von Sperrklauseln in Verhältniswahlsystemen am Beispiel Deutschlands und Schwedens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10416