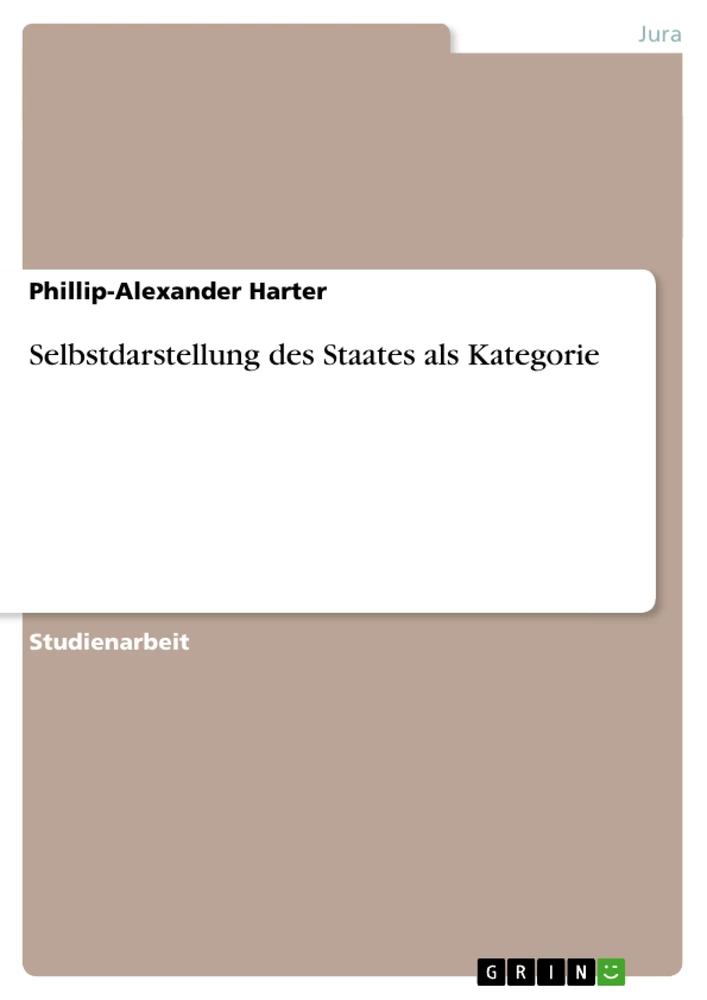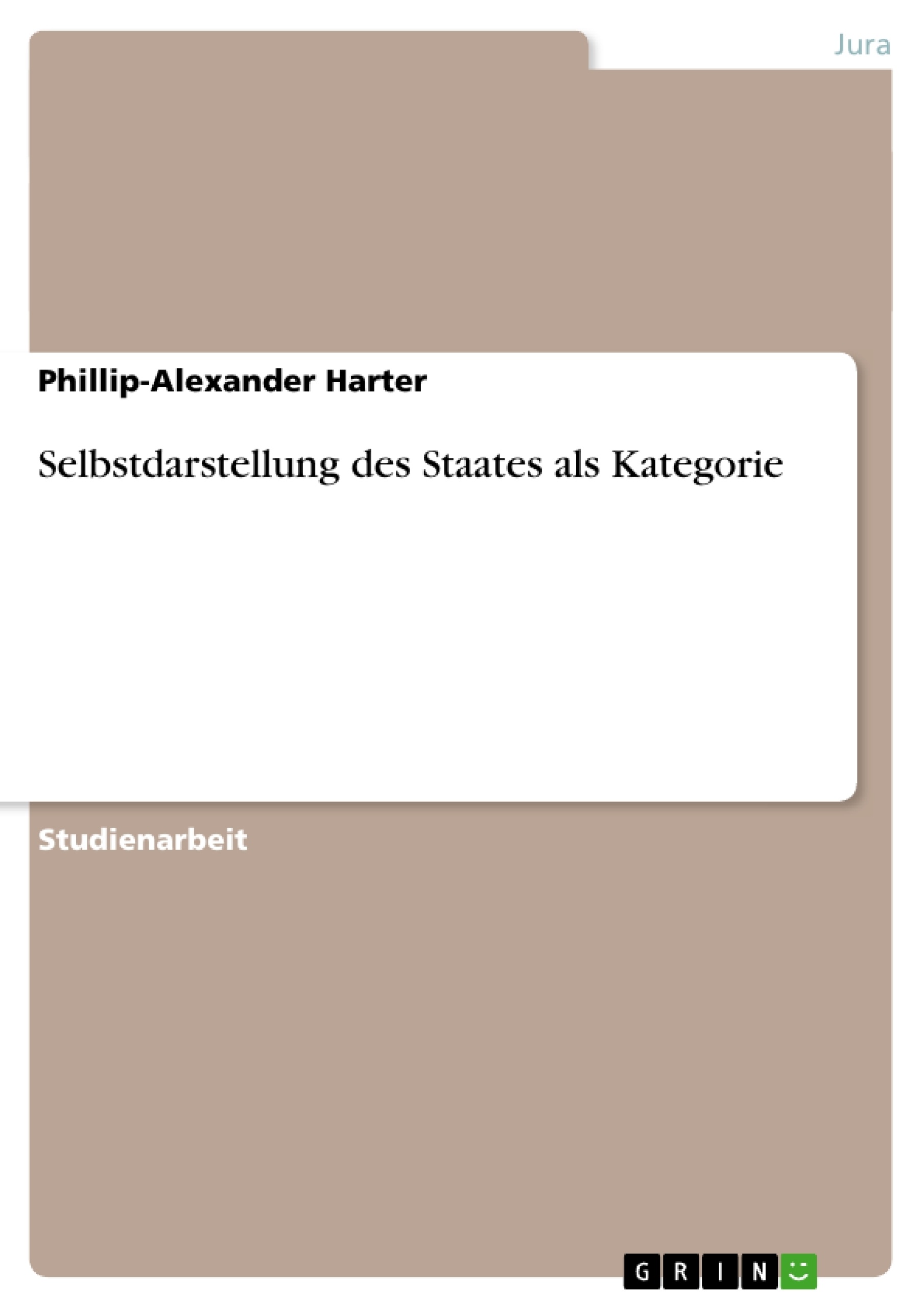Gliederung
I. Einleitung
1. Gegenstand der Arbeit
2. Vorgehensweise
3. Forschungsstand
II. Selbstdarstellung in Psychologie und Wirtschaftswissenschaften
1. Sind wir , was wir darstellen? Selbstdarstellung in der Psychologie
a. Person vs. Situation
b. ”Give” and ”Give off”
c. Privates und Öffentliches Ich
d. Individuum und Gesellschaft
2. Die Werbung. Selbstdarstellung in den Wirtschaftswissenschaften
III. Selbstdarstellung sozialer Systeme
1. Die ”Ensembledarstellung”
a. Das Geheimnis als soziales Mittel
b. Die Darstellung des Ensembles gegenüber Außenstehenden
2. Die Anpassung von Organisationen an ihre Umwelt
a. Die Anpassung durch einen Organisationszweck
IV. Selbstdarstellung des Staates
1. Die Verwaltung
a. Die Organisationsstruktur
b. Die Idealisierung
c. Unbürokratisches Verhalten
2. Die Selbstdarstellung nach Innen
3. Public Relations für Nationen. Die Selbstdarstellung im System der internationalen Kommunikation
V. Der Unterschied zwischen Schein und Sein Zusammenfassung und Fazit
VI. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
I.1. Untersuchungsgegenstand
”All the world’s a stage, and all the men and woman are merely players; They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts”1.
Das Menschen, wenn sie untereinander agieren, sich selbst darstellen, erkannte schon William Shakespeare.
Dies aber gilt nicht nur für Einzelpersonen, die miteinander in Verbindung treten, sondern auch für soziale Systeme.
Jede Gruppe, Firma oder Organisation muss sich nach außen darstellen, um von ihrer Umwelt als eigenständiges System erkannt zu werden.
Diese Selbstdarstellung eines sozialen Systems ist eine unabdingbare Vorraussetzung, um eine Interaktion zwischen Umwelt und System zu ermöglichen2.
Insbesondere gilt dies für die staatliche Verwaltung, da deren Aufgabe darin liegt ”Entscheidungen zu kommunizieren”3, oder anders formuliert, die Entscheidungen des Systems Staat an seine Umwelt weiterzugeben.
Zu klären, inwieweit Selbstdarstellung zur Kategorie wird und das Handeln, insbesondere des Staates, bestimmt, ist Ziel dieser Arbeit.
I.2. Vorgehensweise
Selbstdarstellung wird wissenschaftsübergreifend erforscht. Aus diesem Grund gibt diese Arbeit zunächst kurze Einblicke in einige ausgewählte Forschungsfelder (Kap. II).
Beginnend bei Psychologie und Wirtschaftswissenschaften wird zunächst die Selbstdarstellung des Einzelnen untersucht. Im folgenden rückt die Soziologie und damit die Selbstdarstellung sozialer Systeme in den Mittelpunkt der Betrachtung ( Kap. III), um im abschließenden Kapitel des Hauptteils (Kap. IV) den Versuch zu unternehmen die gewonnene Erkenntnisse auf den Staat anzuwenden.
I.3. Forschungsstand
Die Erforschung der Selbstdarstellung wurde maßgeblich durch ein Werk angestoßen.
Erving Goffmann löste mit seinem Arbeit ”The Presentation of Self in Everday life”4 am Ende der fünfziger Jahre einen Boom in der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie aus. Den Grundstein für die soziologische Analyse der Selbstdarstellung sozialer Systeme legte in den sechziger Jahren der deutsche Soziologe Niclas Luhmann5.
Die Probleme der Selbstdarstellung des Staates aus staatswissenschaftlicher Sicht legte als erster Helmut Quaritsch Mitte der 1970er Jahre dar6.
An den oben genannten Werken und einigen neueren Übersichtsdarstellungen7 orientiert sich die vorliegende Arbeit.
Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass die Literatur und vor allem die Quellenlage zum Thema der Selbstdarstellung sehr dürftig ist. Vor allem neuere Untersuchungen sucht man vergebens.
II. Selbstdarstellung in Psychologie und Wirtschaftswissenschaften.
II.1. Wie stelle ich mich dar? Selbstdarstellung in der Psychologie.
Einen Einblick in die Psychologie zu erlangen, ist ein recht schwieriges Unterfangen. Vor allem, unter der Vorraussetzung, dass man sich zuvor noch nie ernsthaft mit psychologischer Literatur von wissenschaftlichem Wert auseinandergesetzt hat. Erschwert wird diese Tatsache noch dadurch, dass in der Psychologie keine anerkannte und umfassende Theorie zur Selbstdarstellung existiert8.
Die Schwerpunkte der Erforschung des Phänomens Selbstdarstellung aus psychologischer Sicht lassen sich jedoch wie folgt aufzeigen.
II.1.a. Person vs. Situation
Es ist nicht in jeder Situation möglich sich auf gleiche Weise nach außen darzustellen. Das Verhalten ”ist sowohl durch Person als auch durch Situation determiniert”9.
Dabei wird zwischen starken Situationen und schwachen Situationen unterschieden10. Eine starke Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass die meisten Menschen in der gleichen Situation gleich oder sehr ähnlich handeln.
Das Bremsen an einer roten Ampel ist beispielsweise eine starke Situation, da eine von der Norm abweichende Handlung als falsch angesehen und sanktioniert wird. Diese Situationen erlauben nur sehr wenig Selbstdarstellung des Individuums, da der Feiraum von der Gesellschaft eingeschränkt wird.
Wenn eine Person in einer Situation kaum durch gesellschaftliche Normen gebunden ist (z.B. auf einer Party) ist der Spielraum für Selbstdarstellung sehr viel größer.
Für die Betrachtung der individuellen Selbstdarstellung spielen schwache Situationen aus diesem Grund eine weitaus wichtigere Rolle.
”Wenn ein Einzelner mit anderen zusammentrifft, versuchen diese gewöhnlich, Informationen über ihn zu erhalten”11 und wie oben dargelegt ist dies nur in einer schwachen Situation möglich, denn Informationen sind nur dort zu erhalten wo auch eine frei Kommunikation möglich ist. Wann immer sich eine Person also bewusst ihrer Umwelt darzustellen versucht, muss sie die Situation in der dies geschieht als eine schwache Situation darstellen.12
Des weiteren versuchen Personen, unter normalen Umständen, wenn sie einander begegnen eine so positiven Eindruck wie möglich zu hinterlassen.
Wenn also eine Person auf eine andere oder auf eine Gruppe von anderen Personen trifft, so versucht sie erstens einen möglichst positiven Eindruck zu hinterlassen und zweitens, die Situation so erscheinen zu lassen, dass die eigene Selbstdarstellung nicht als durch äußere Zwänge geprägt empfunden wird13.
II.1.b. „gives“ and „gives of“
Die Art und Weise in der wir Versuchen Informationen über uns an andere zu vermitteln, beziehungsweise in der andere Versuchen Informationen über uns zu erhalten soll hier kurz beschrieben werden.
Der Eindruck, den andere von einer Person gewinnen, lässt sich nach Goffman unterteilen in ”gives” und ”gives off”14. ”Gives” meint, was ich anderen direkt über mich mitteile und ”gives off” meint was andere aus meinen Verhalten über mich schließen.
”Gives off” sind für Beobachter, das wichtigere Kriterium, da sie, auch wenn sie es nicht immer sind, ehrlicher erscheinen.
Für die Analyse der Selbstdarstellung ist aber, dem Wortsinn entsprechend, nicht entscheidend, welche Schlüsse die Kommunikationspartner aus dem unbewussten Verhalten ziehen. Entscheiden ist vielmehr, was bewusst und mit einer festen Absicht an die Umwelt vermittelt wird.
Hierbei unterscheidet Goffman zwischen einer ehrlichen Show, bei der die Person an das glaubt, was sie nach außen darstellt und einer unehrlichen Show, bei der die Person einen bewusst falschen Eindruck hinterlässt.
Diese beiden Möglichkeiten stellen aber nur die Extreme auf einem breiten Spektrum von Alternativen dar15.
Oft ist es jedoch der Fall, dass eine unehrliche Show, wenn sie lange genug und mit ausreichendem Erfolg gegeben wird, nicht nur die Zuschauer sondern auch die Darsteller von dem überzeugt was dargestellt wird. Der Lügner glaubt der eigenen Lüge, ob sie damit auch zur Wahrheit wird führt über die Betrachtungen dieser Arbeit hinaus.
II.1.c. Privates und öffentliches Ich
Der Wechsel zwischen Privatem und Öffentlichem Ich wird oft in dem Vergleich zum Theater beschrieben.
Goffman unterscheidet zwischen einem ”backstage Bereich”, dem Privaten Ich, und einem ”offstage Bereich”, dem Öffentlichen Ich.
Dabei ist es für unsere Betrachtung nicht weiter wichtig, wie weit der ”backstage Bereich” reicht. Nicht nur die einzelne Person kann sich in ihrem ”backstage Bereich” aufhalten, auch Familie und Freunde könne durchaus zu diesem Bereich gehören, in dem keine bewusste Selbstdarstellung erfolgt.16
Außerdem ist bei dem Vergleich mit dem Theater zu bedenken, dass jede Person, die mit anderen in Kontakt tritt, nicht nur Darsteller, sondern auch Zuschauer für die Darstellung der anderen Personen ist.
Warum aber stellen Menschen sich dar, wenn sie aufeinander treffen?
Jean-Paul Sartre beschrieb in ”Das Sein und das Nichts” wie er einen Kaffeehauskellner beobachtete.
Dieser entsprach seiner Rolle als Kaffeehauskellner so genau, dass Sartre feststellte. ”Dieser Kellner spielt, er spielt Kaffeehauskellner zu sein”.17 Der Kaffeehauskellner weiß welches Verhalten die Besucher des Kaffees von ihm erwarten, weiß wie sie sich einen Kaffeehauskellner vorstellen und er entspricht diesen Erwartungen, entspricht ihnen ganz genau. Sein Handeln folgt einem ungeschriebenen Drehbuch, geschrieben von den Erwartungen derer die ihn beobachten.
Diese kleine Szene beschreibt sehr anschaulich, wie sich das Verhalten im ”offstage Bereich” abspielt.
Jeder, der in sozialen Kontakt mit anderen tritt, füllt eine Rolle aus, ähnlich der, die ein Schauspieler auszufüllen beginnt, sobald er die Bühne betritt.
Denn ”eine richtig inszenierte und gespielte Szene veranlasst das Publikum, der dargestellten Rolle ein Selbst zuzuschreiben”18.
Wenn aber jemand eine Rolle unglaubwürdig ausfüllt, ist seine Umwelt nicht geneigt, ihm ein Selbst zuzugestehen. Die Selbstdarstellung wird somit für jedes Individuum zur Notwendigkeit, sobald es mit anderen in Kontakt tritt.19
II.1.d. Der Einzelne und die Gesellschaft
Jeder Mensch muss sich in unserer Gesellschaft an verschiedene soziale Systeme anpassen.
Dabei muss er deren unterschiedliche Anforderungen in „einer persönlichen Verhaltenssynthese vereinen.”20
Dies ist jedem Einzelnen möglich, indem er seinem Verhalten in jedem sozialen System eine persönliche Linie gibt, die von den anderen Mitgliedern der sozialen Systemen akzeptiert wird.
Diese persönliche Linie charakterisiert sein Verhalten in jeder Situation und in jedem sozialen Umfeld.
Für die meisten Situationen genügt dabei eine Standartpersönlichkeit, Luhmann spricht von einer “Persönlichkeit von der Stange”.21 Doch gibt es Situationen in denen sich außergewöhnliche Persönlichkeiten auszeichnen. Viele Entscheidungen werden eben aufgrund einer außergewöhnlichen Persönlichkeit getroffen und akzeptiert, wohl auch, weil man oft die Entscheidung nicht ablehnen kann, ohne gleichzeitig die Person abzulehnen.
Wenn der Einzelne seinen Entscheidungen in verschiedenen sozialen Systemen Gewicht verleihen will, so darf er in den Augen der anderen nicht über eine „Persönlichkeit von der Stange“ verfügen, er muss, sofern er nicht ohnehin über eine solche verfügt, seine Persönlichkeit als außergewöhnlich darstellen.
Gerade unsere, in höchstem Masse komplexe Gesellschaft, ermöglicht dabei der einzelnen Persönlichkeit die größten Chancen. Da sie aufgrund ihrer schieren Größe nicht mehr zentral zu koordinieren ist muss sie sich auf Persönlichkeiten als Knotenpunkt verlassen.
Nie hatte der Einzelne soviel Spielraum zur Persönlichkeitsentfaltung wie heute, nie wurden seinen Bedürfnissen soviel Bedeutung beigemessen. Und nie hatte jede einzelne Persönlichkeit so viele Möglichkeiten sich in der Gesellschaft selbst darzustellen.22
II.2. Werbung. Selbstdarstellung in den Wirtschaftswissenschaften
Die Selbstdarstellung spielt auch aus ökonomischen Gesichtspunkten eine nicht unerhebliche Rolle.
Es für Firmen von entscheidender Bedeutung, wie sie sich nach außen darstellen, mit welchem Image ihre Produkte behaftet sind und welches Image am förderlichsten für den Verkauf wäre. Dass dieser Aspekt eine immer bedeutendere Rolle spielt, spiegeln unter anderem in den Wachstumszahlen und der zunehmenden Professionalisierung der Werbebranche wieder23.
Die Selbstdarstellung einer Firma entscheidet über ihren Erfolg oder Misserfolg. Aus diesem Grund ist es für Firmen von enormer Bedeutung zu erforschen, wie ihre Darstellung von den Konsumenten aufgenommen wird.
Dabei ist eine interessante Wechselwirkung zu beobachten, denn nicht nur die Firmen richten ihre Kampagnen an den Erwartungen ihrer potentielle Kunden aus. Gleichzeitig beeinflusst die Werbung auch die Selbstdarstellung des Einzelnen. In vielen Fällen nutzt die Werbung dabei die Idealvorstellung einer Konsumentengruppe, macht sich das menschliche Bedürfnis zur Selbstdarstellung zu Nutze und erweckt den Eindruck, dass ihr Produkt ein notwendiges Accessoire zur perfekten Inszenierung darstellt24.
Welcher Manager in einer deutschen Großstadt braucht schon aus praktischen Beweggründen einen Geländewagen. Dieser logischen Überlegung zum Trotz werden in deutschen Großstädten jedes Jahr Tausende dieser Modell verkauft.
In diesem Fall nutzen die Firmen das männliche Bedürfnis sich Selbst als hart und naturverbunden darzustellen und bieten den Geländewagen als perfektes Accessoire an.
Interessant ist die Wechselwirkung zwischen Konsument und Produzent im Sinne dieser Arbeit, weil die Produzenten dabei vor einem ähnlichen Problem stehen wie der Staat.
Zwischen Konsument und Produzent fehlt ein direktes ”feedback”. Da aber das “feedback .. Voraussetzung für optimale Anpassung”25 ist, muss der Produzent versuchen das Risiko von Missverständnissen so gering wie möglich zu halten.26 Das „feedback“ erfolgt verzögert in Form von Erfolg oder Misserfolg beim Verkauf.
Wenn ein Produzent im Laufe einer Werbekampagne bemerkt, dass er die potentiellen Kunden nicht anzusprechen vermag, so ist es für ihn nahezu unmöglich, die Kampagne noch umzustellen. Dabei kann man eine Kampagne mit einem Gespräch vergleichen, in dem der eine Gesprächspartner seine Text schon vorgeschrieben hat und auf keinen Fall von diesem Text abweichen kann.
Er muss also vorher wissen, was sein Gesprächspartner wohl sagen wird. Wenn er sich bei dieser Vorhersage täuscht, ist ein Gespräch nur noch schwerlich möglich.
Der Staat steht bei der Darstellung seiner Leistungen vor einem ähnlichen Problem. Auch der Staat ist darauf angewiesen, dass die Darstellung seiner Leistungen mit einem möglichst geringen Risiko der Ablehnung verbunden sind, da auch dem Staat die unmittelbare Reaktion des Kommunikationspartners, in diesem Fall des Bürgers, fehlt. Um eine Kommunikation zu ermöglichen, bedürfen sowohl der Staat als auch eine Firma eines Mittlers.
In beiden Fällen wird diese Rolle von den Medien übernommen, die damit eine Schlüsselfunktion in der Kommunikation, und damit in der Selbstdarstellung, des Staates zugewiesen bekommen.27
Auch bieten die Wirtschaftswissenschaften gegenüber jedem anderen Wissenschaftsbereich, in dem die Selbstdarstellung in irgendeiner Form angesprochen wird, einen entscheidenden Vorteil. In Form von Konsumenten- und Produzentenbefragungen ist eine Unmenge an Quellen gesammelt und ausgewertet worden.28 Eine ähnliche Materialfülle steht in keiner anderen Wissenschaft zur Verfügung.
III. Selbstdarstellung sozialer Systeme
Zunächst muss festgehalten werden, dass eine auch nur im Ansatz vollständige Analyse der Selbstdarstellung sozialer Systeme unmöglich ist.
Ein Grundproblem der Soziologie ist nämlich, dass komplexe Systeme unfähig sind, ihre eigene Komplexität zu erfassen.
”Würde ihnen das gelingen, so wären sie damit wieder komplexer als zuvor, da das System dann zusätzlich auch eine Beschreibung der eigenen Komplexität enthält.”29
Demzufolge kann diese Komplexität nur von einem dem System nicht zugehörigen Betrachter erfasst werden.
Erving Goffman beispielsweise zog seine Schlüsse zu einem großen Teil aus der Betrachtung der Bewohner der Shetland Inseln. Diese gehören zwar zum angloamerikanischen Kulturkreis, aus dem auch Goffman selber stammte, haben aber im Laufe der Jahrhunderte eine sehr eigene Sozialstruktur entwickelt. Da Goffman bei der Betrachtung der Gesellschaft der Shetland Inseln also auf einer Meta-Ebene stand, die für eine objektive Betrachtung Grundvoraussetzung ist, konnte er sie zur Grundlage seiner Studien machen.30
III.1. Die ”Ensembledarstellung”
Goffman zieht auch in der Betrachtung sozialer Gruppen den Vergleich zum Theater, den er schon bei der Analyse der Selbstdarstellung einzelner Personen nutzt.
Wenn soziale Gruppen sich gegenüber ihrer Umwelt als geschlossenes System darstellen, spricht er von einer Ensemble-Verschwörung.31
III.1.a. Das ”Geheimnis” als soziales Instrument
Grundsätzlich liegt es im Interesse jedes Ensembles, dass gewisse Informationen nur den Mitgliedern offenbart werden. Es ist sogar wesentliches Merkmal eines sozialen Systems, über Informationen zu verfügen, die nur für Mitglieder zugänglich sind. Der Umkehrschluss ist in diesem Fall aber nicht zulässig, nicht alle Personen, die Geheimnisse teilen, bilden eine eigene soziale Gruppe.
Wie bei jeder einzelnen Person gibt es Geheimnisse, die nicht öffentlich bekannt werden dürfen, weil sie das Image und somit das unabhängige Selbst in der Öffentlichkeit gefährden würden. Goffman spricht in diesem Fall von ”dunklen Geheimnissen”.32 Es liegt im Interesse sozialer Systeme, dass diese Geheimnisse so lange wie möglich, im Idealfall für immer, vor Außenstehenden bewahrt bleiben.
Des weiteren gibt es Geheimnisse, die der Gruppe bzw. dem Ensemble einen strategischen Vorteil verschaffen. In der Industrie beispielsweise wäre die Marketingstrategie, für ein neu auf dem Markt zu platzierendes Produkt ein solches Geheimnis.33
Wichtig aber ist bei beiden Geheimnissen, dass sie wesentlich dazu beitragen, eine soziale Gruppe abzugrenzen. Wer die Geheimnisse kennt gehört dazu, wer sie nicht kennt, ist ein Außenseiter. Um die Geheimnisse zu bewahren und damit gleichzeitig die Grenze zwischen Mitgliedern und Außenseitern aufrecht zu erhalten, ist eine Darstellung nach außen unabdingbar, die den Schein gegenüber Außenstehende wahrt.
III.1.b Die Darstellung des Ensembles gegenüber Außenstehenden
Es gibt eine Vielzahl von Situationen in denen eine soziale Gruppe sich gegenüber Außenstehenden darstellt, einige Beispiele für die unterschiedliche Bedeutung dieser Situationen werden nun angeführt.
Dabei kennt jedes Mitglied eines Ensembles sehr genau die Rolle, die es vor Außenstehenden zu spielen hat.
Beispielsweise kann die Darstellung der Aufrechterhaltung eines Images dienen, selbst dann, wenn den Außenstehenden völlig bekannt ist, dass es sich nur um eine Darstellung handelt.
Da es in der höheren englischen Gesellschaft des 19ten Jahrhunderts für Damen als unschicklich galt, nach dem Mittag einer Beschäftigung jenseits der Muße nachzugehen, wurde auch in weniger begüterten Familien beim Eintreffen eines Besuchers jede praktische Tätigkeit von den Damen eingestellt.
Diese Darstellung wurde auch beibehalten, obwohl jedem Besucher bekannt war, dass die Töchter des Hauses aus finanziellen Gründen der Familie zur Hand gehen mussten. Eine schöne Beschreibung einer solchen Szene findet sich in beispielsweise in Jane Austins Roman Sense and Sensibility.34
Die Darstellung kann, wie in dem beschriebenen Beispiel, zum Selbstzweck werden. Die Selbstdarstellung dient nicht mehr dazu ein Geheimnis zu bewahren, sondern ein Image, ein gruppeninternes Selbstverständnis aufrecht zu erhalten, um sich selbst weiter als zu einer Gruppe zugehörig empfinden zu können35.
Eine weitere typische Situation für eine „Ensembleinszenierung“, ist die Wahrung eines Geheimnisses zwischen der Gruppe und einer bestimmten Person oder Personengruppe.
Wer seinen Wehrdienst geleistet oder je in einem Betrieb gearbeitet hat, kennt aller Wahrscheinlichkeit nach die Situation, in der immer nur dann gearbeitet wird, wenn ein Vorgesetzter sich in unmittelbarer Nähe aufhält.
Der Rest der Zeit wird mit angenehmeren Dingen, wie der Zeitungslektüre oder einem Skatspiel zugebracht.36
Die Ensembledarstellung gegenüber Außenstehenden übernimmt also verschiedene Aufgaben. Zum einen dient sie dem Ensemble als Mittel der Identifikation gegenüber Dritten, zum anderen kann sie aber auch den Zweck verfolgen, einen Dritten bewusst über Tatsachen im unklaren zu lassen.
Eine andere Form der Selbstdarstellung ist, bei genauerer Betrachtung, auch das Verhalten gesellschaftlicher Schichten. Mitunter wird so auf sehr subtile Weise deutlich vermittelt, wer einer Gruppe zugehörig ist und wer nicht. In diesem Fall dient die Selbstdarstellung des Ensembles nicht dem bewahren eines Geheimnisses, sondern der Abgrenzung gegenüber Außenstehenden.
Spezielle Tischmanieren oder Anreden sind eine Art Inszenierung auf einer Bühne, die allen Eingeweihten bekannt ist und in der jeder seinen Text kennt, gleichzeitig muss ein Außenstehender vor diesem Hintergrund sofort auffallen. So erkennt die Gruppe, wer keinen Zugang zu gruppeninternen Informationen hat und der Außenstehende erfährt die Gruppe als Einheit, gegen die er alleine machtlos ist.
Bei einem fest eingespielten Verhältnis zweier Ensembles, ist ”meistens ein inoffizieller Kommunikationskanal von einem zum anderen Ensemble”37 zu entdecken.
Diese inoffizielle Kommunikation dient der Regelung von Problemen, die bei einer Aufrechterhaltung der Inszenierung nur schwer lösbar wären. Durch inoffizielle Kanäle ist es folglich möglich Probleme zwischen sozialen Gruppen zu löse, ohne gegenüber Dritten die Fassade aufgeben zu müssen.
III.2. Die Anpassung von Organisationen an ihre Umwelt
Anpassung ist der Begriff, den Niclas Luhmann der Integration entgegen stellt. Während Integration die Ordnung der Handlungen meint, die dem System immanent sind, meint Anpassung die Ordnung des Systems gegenüber seiner Umwelt. Diese steht im Mittelpunkt des folgenden Kapitels.38
III.2.a. Die Anpassung durch einen Organisationszweck
Der wesentlichste Faktor für die Anpassung eines Systems an Außenstehende ist der Zweck des Systems. Welche Leistungen bringen dem System etwas ein, für welche Leitungen erfährt es Anerkennung von seiner Umwelt?39
Damit der Organisationszweck seine Anpassungsfunktion wahrnehmen kann, ist eine Kommunikation mit der Umwelt nötig. Das System muss sich und seine Funktion darstellen, da aber die Erfüllung des Zweckes und seine Darstellung oft nicht parallel verlaufen, müssen Organisationen Kräfte, die eigentlich der Zweckerfüllung dienen, zur Zweckdarstellung abstellen.
Der amerikanische Soziologe Amitai Etzioni spricht von einem deklarierten und einem wirklichen Zweck der Organisation.40 Der Organisationszweck kann die Umwelt veranlassen das volle System zu unterstützen und diese Beziehung auch bei einer Änderung des Systems selbst beizubehalten. Eben so ist es dem System möglich sich auf diese Weise geänderten Umweltbedingungen anzupassen.41
Eine dementsprechend entscheidenden Stellenwert hat es für eine Organisation ihren Organisationszweck an die Umwelt zu vermitteln.
IV. Die Selbstdarstellung des Staates
IV.1. Die Verwaltung
Für die weitere Betrachtung soll die Verwaltung in den Mittelpunkt gerückt werden. ”Verwaltungen sind Organisationen, deren Zweck es ist, Entscheidungen zu kommunizieren”42. Da der Organisationszweck der Verwaltung die Kommunikation zwischen Politischem System und Gesellschaft darstellt, sind sie der ideale Ausgangspunkt, um die Selbstdarstellung des Staates zu betrachten.
IV.1a. Die Organisationsstruktur
Verwaltungen werden von ihrer Umwelt nie nur im Bezug auf einzelne Entscheidungen beurteilt. Personen die mit der Verwaltung in Berührung kommen, orientieren sich an einer Mischung aus privaten Erfahrungen, Erzählungen von Bekannten und einem Erwartungshorizont. Nur innerhalb dieses Rahmens werden Einzelentscheidungen akzeptiert.43
Aus diesem Grund müssen Verwaltungen ihre Entscheidungen kalkulierbar machen. Es muss für die Bürger möglich sein, ihre Entscheidungen mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad vorhersagen zu können.
Diesem Eindruck dient die formale Organisationsstruktur. Die Organisationsstruktur ist ein wesentliches Mittel der Selbstdarstellung.44
Luhmann führt als Argument zur Stärkung seiner These, von der Bedeutung der Organisationsstruktur für die Selbstdarstellung auf, dass formale Strukturen an Bedeutung verlieren, sobald der Kontakt mit der Umwelt abnimmt.
Bei der Bundeswehr spricht man in diesem Fall davon, dass die informelle Hierarchie Oberhand über die formale Befehlskette gewinnt.
Da die Organisationsstruktur der Selbstdarstellung dient, ist es für das System entscheidend, dass sie für Außenstehende unbedingt gewahrt bleibt.
Dazu dürfen Situationen in denen dies nicht so ist, nicht in der Öffentlichkeit stattfinden.
Auch und insbesondere in der Verwaltung gilt also, dass der ”Backstage Bereich” für Außenstehende tabu bleiben muss.
IV.1.b Die Idealisierung
Für den externen Verkehr der Verwaltung ist eine Idealisierung notwendig, da die Wirklichkeit von sich aus nicht akzeptabel ist.45
So wie jedes Individuum versucht in der Kommunikation mit anderen sich selbst positiv erscheinen zu lassen, so versucht dies auch die Verwaltung. Der Prozess ist jedoch, durch die Beteiligung einer Vielzahl von Personen, ungleich komplexer ist als beim Individuum.
Fehler und Unzulänglichkeiten verschwinden hinter einer Fassade aus Korrektheit und sachlicher Kompetenz.
Pannen werden nicht dem System, sondern dem Einzelnen angelastet.
Damit dies funktioniert ist eine strenge Trennung von “offstage” und “backstage” Bereich notwendig, das Publikum darf keinen Einblick in den Arbeitsvorgang erhalten, es soll nur das Ergebnis in seiner polierten und geschliffenen Form zu Gesicht bekommen.46 In § 54 des Beamtengesetzes heißt es über den Beamte : „ Sein Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Beruf erfordert.“47
Damit wird der Beamte nicht nur darauf verpflichtet korrekt zu sein, sondern auch darauf korrekt zu erscheinen.
Hier erfährt die Selbstdarstellung der Verwaltung eine konkrete rechtliche Form, in dem Beamte dazu verpflichtete werden gegenüber ihrer Umwelt korrekt zu erscheinen.
Nach der oben aufgeführten Regeln, die eine Idealisierung in der Selbstdarstellung der Verwaltung vorschreibt, müsste das Gesetz den Beamten eigentlich dazu verpflichten besser zu erscheinen als er ist.
Da diese Regelung jedoch die Selbstdarstellung dadurch zerstören würde, dass sie offiziell offenbart würde, ist eine solche Vorschrift unmöglich.
So bleibt dem Staat nur, seine Beamten dazu zu verpflichten, sich nicht schlechter darzustellen als sie sind.
IV.1.c Unbürokratisches Verhalten
Vor allem in letzter Zeit steht die Verwaltung noch vor einem zweiten Problem.
Von ihr wird einerseits erwartet, dass sie neutral ist und ihre Entscheidungen gemäß ihrer Richtlinien fällt, andererseits erwartet man aber auch ein flexibles und unbürokratisches Handeln.
Die Verwaltung muss sich selbst also einerseits als verlässlich darstellen, um den Erwartungen des politischen Systems zu entsprechen, welches eine zuverlässige Durchsetzung der Rechtsnormen erwartet. Andererseits muss sie flexibel erscheinen, wenn sie nicht in den Augen der Bürger an Ansehen verlieren will.
Auf diese Anforderung reagiert die Verwaltung mit einer Strategie, die ihrer Umwelt “auf zwei verschiedenen Ebenen der Generalisierung gegenüber”48 tritt.
Es entscheidet generell über Entscheidungsprogramme und speziell über Einzelfälle. So ist es der Verwaltung möglich gleichzeitig als verlässliches System aufzutreten, dessen Entscheidungen prognostizierbar sind und sich trotzdem an die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Bürgers anzupassen. Um diese Möglichkeit beizubehalten, muss der Außenstehende klar zwischen dem System Verwaltung einerseits und dem einzelnen Beamten oder Verwaltungsangestellten andererseits unterscheiden.
So stellt sich das Verwaltungssystem als geschlossen dar und erlaubt im Bezug auf das System feste Erwartungen zu bilden49, gleichzeitig wird die Person hinter dem Verwaltungsmitglied zur Einbruchstelle, auf deren Hilfe man hoffen kann.
Für das einzelne Mitglied der Verwaltung bedeutet dies ein ständiges Umschalten von einer formalen und wieder zurück in eine informale Situationsauffassung.50
IV.2 Die Selbstdarstellung nach Innen.
Die Funktionsfähigkeit eines Staates hängt von der Loyalität ab, die seine Bürger ihm gegenüber empfinden, diese Loyalität wiederum beruht auf den Leistungen, die der Staat als „Wirkungs- und Entscheidungsstätte“ erbringt. Loyalität führt somit zu Leistungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit zu Loyalität.51 Der Staat muss sich also gegenüber seinen Bürgern als „sinnvoll, vertrauenswürdig und erfolgreich“ darstellen, um die Loyalität zu erhalten, die er benötigt, um leistungsfähig sein zu können.52
Auf welche Art und Weise der Staat seine konkreten Entscheidungen kommuniziert ist bereits dargelegt worden. Wie aber erfolgt das Erzeugen einer Staatsloyalität ?
Einer der Wege des Staates eine Identifikation zu ermöglichen sind Staatssymbole. Diese dienen heute, ihrer klassischen Bedeutung oft enthoben, als eine Art Markenzeichen des Staates. Der Bundesadler hat heute nicht mehr die kriegerische Symbolik, wie seine Vorgänger bei den römischen oder napoleonischen Legionen, jeder jedoch erkennt in ihm ein Symbol des Staates.
Ein weiteres Mittel der staatlichen Selbstdarstellung findet sich in der Staatsarchitektur.
Die Beispiele hierfür reichen von der römischen Staatsarchitektur bis zu der Diskussion über das neue Berliner Kanzleramt.
Ein drittes Mittel sind die Besonderen Veranstaltungen des Staates. Da Truppenparaden und Staatsfeste, zumal nach 1945 nicht gerade eine deutsche Spezialität sind ist wohl ein Grossteil ihrer integrativen Wirkung auf sportliche Großveranstaltungen übergegangen.
Einen so überwältigende Wirkung auf die Kollektivpsyche der Deutschen, wie Helmut Rahns Siegtor bei der Fußballweltmeisterschaft 1954, hat wohl kein Staatsfest, keine Truppenparade und kein nationaler Feiertag je erlangt.
Neben diesen konkreten Mitteln dienen dem Staat Kultur, Sport und die Lage der Wirtschaft, um sich darzustellen.
Weil jedem bewusst ist, dass diese Bereiche auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.53
Zudem nutzt der Staat verschiedene Methoden, um darauf hinzuweisen, dass eine bestimmte Leistung von ihm erbracht wird. Beamte beispielsweise tragen Uniformen. Durch diese wird die Handlung des Uniformträgers als Staatshandlung erkennbar. So wird dem Bürger ins Gedächtnis gerufen, dass der Staat existiert und auch handelt.
Allerdings nehmen mit der zunehmenden Privatisierung ehemals staatlicher Betriebe auch die Möglichkeiten des Staates ab, sich mit Hilfe seiner Beamten selbst darzustellen. Die Post ist an der Börse und die Bahn ist privatisiert und bald wird niemand mehr den Postboten oder den Schaffner mit dem Staat identifizieren.
Dabei steht der demokratische Staat bei seiner Selbstdarstellung vor einem systemimmanenten Problem. Wie in den Kapiteln II.-III. aufgeführt ist eine effektive Selbstdarstellung nur da möglich, wo zwischen einem „offstage“ und einem „backstage“ Bereich getrennt wird.
Da aber die Transparenz der politischen Vorgänge zu einem Ideal unseres Staates gehört, steht der Selbstdarstellung des demokratischen Staates eines seiner eigenen Ideale im Weg.54
Bisher hat dieses Dilemma den Demokratien jedoch wenig geschadet, gibt die Transparenz doch immerhin die Möglichkeit auf ein „feedback“ der Bürger zu reagieren.
Was nämlich geschieht wenn der Staat sich gegenüber seinen Bürgern darstellt, ohne jedoch auf ihre Reaktion zu hören zeigen die Ereignisse des Herbstes 1989 und der Zusammenbruch der DDR.
Der Umfang dieser Arbeit ermöglicht es nicht die verschiedenen Aspekte der Selbstdarstellung des Staates nach innen noch zu vertiefen. Vielmehr sollte hier auch eine kurze Vorschau auf die noch folgenden Arbeiten gegeben werden.
IV.3 Public Relations für Nationen. Die Selbstdarstellung im System der internationalen Kommunikation.
Dieses Kapitel zeigt eine andere Art der staatlichen Selbstdarstellung. Staaten müssen sich nicht nur gegenüber ihren eigenen Bürgern darstellen, sie agieren auch in einem internationalen Kommunikationssystem.
In diesem müssen die Staaten sich selber gegenüber anderen Staaten darstellen.
Wir alle haben eine gewisse vorgefertigte Meinung über andere Staaten, genau wie die meisten Bürger anderer Staaten ein mehr oder weniger vorgefertigtest Bild von Deutschland haben. Je weniger direkten Kontakt man mit einem Land hat, je eher haben diese vorgefertigte Images bestand.
Ob sich diese Vorurteile kurzfristig verändern lassen ist in der Kommunikationswissenschaft strittig. Eine Lehrmeinung vertritt, dass sich das Image eines Staates wie das eines Konzerns mittels PR-Maßnahmen verändern lässt. Das diese Meinung hauptsächlich von PR-Managern vertreten wird verwundert an dieser Stelle nicht weiter.
Die Sozialpsychologie hingegen geht davon aus, dass Stereotypen über Völker sehr unbeweglich und schwer veränderbar sind.55
Von der Richtigkeit der zweiten These ausgehend ist es für Staaten enorm schwer sich selbst im Ausland darzustellen, wenn schon ein Image existiert.
Eine Chance ihr Image selbst wesentlich zu gestalten haben jedoch Länder, über die noch keine vorgefertigte Meinung besteht, also meist Länder die sich dem alltäglichen Blick der westlichen Presse entziehen. Dies trifft vor allem auf Nationen in Afrika und Lateinamerika zu, die weder zu den Elitestaaten zählen, noch in unmittelbarer Nachbarschaft der Industrienationen liegen.56
Welches Interesse aber haben diese Länder sich selbst im Ausland darzustellen? Meist spielen wirtschaftliche Faktoren eine wesentliche Rolle, es ist leichter Investoren und Touristen für ein Land mit einem positiven Image zu begeistern.
Aus diesem Grund betreiben manche Saaten regelrechte Werbefeldzüge. Dabei läuft die hauptsächlich an Touristen gerichtete Werbung nach dem gleichen Muster, wie die Werbung für ein Konsumprodukt57. Auch hier wird den Massenmedien eine entscheidende Rolle zugewiesen58.
Belgien versuchte beispielsweise 1957 mit Hilfe einer Werbekampagne in den U.S.A zu Kenntnis genommen zu werden. Das Ziel “to put Belgium on the map”59 scheiterte allerdings kläglich. Bis heute wissen nur wenige U.S. Amerikaner von der Existenz Belgiens.
Die Public Relation eines Staates kann sich aber auch gezielt an das politische System eines anderen Staates wenden und sie kann sehr erfolgreich sein. Der nationalchinesische Präsident Chiang Kai-shek investierte jedes Jahr Millionen, um sich der U.S. amerikanische Freundschaft zu versichern, und die Millionen waren gut angelegt.
Dem Diktator gelang es auf diese Art und Weise einen beträchtlichen Einfluss auf den amerikanischen Kongress zu gewinnen. Bis zur Mitte der 1970er Jahre war die sogenannte “China Lobby” um Henry Lua60 ein bedeutender politischer Faktor in den U.S.A. Die gekonnte Selbstdarstellung machte aus einem Diktator, der sich selbst um Milliarden bereicherte, den idealisierten Gutmenschen und den Gegenpol zum kommunistischen Teufel Mao Tse-Dong.
Wenn es auch bei den meisten staatlichen PR-Kampagnen nur um den Gewinn von Touristen oder Investoren geht, so sehen wir hier ein Beispiel, wie staatliche PR die Weltpolitik verändert hat.
V. Der Unterschied zwischen Schein und Sein. Zusammenfassung und Fazit.
„Das Ich-Selbst-Sein war nicht bestimmbar, weil tatsächlich nicht vorhanden“61 lässt Thomas Mann seinen Hochstapler Felix Krull sagen. Selbstdarstellung ist ein ständiger Teil unseres Lebens.
Nicht nur wir als Individuen stellen uns einander gegenüber dar. Auch als Mitglieder sozialer Systeme wirken wir an deren Selbstdarstellung mit, oder sind gleichsam Zuschauer, wenn sie sich uns gegenüber darstellen. Dabei lassen sich die Erkenntnisse, die man aus der Selbstdarstellung des Einzelnen zieht nicht einfach auf die Selbstdarstellung von Organisationen übertragen und diese wiederum nicht ohne Vorbehalt auf die Selbstdarstellung des Staates.
Ein kurzer Einblick in verschiedene Theorien und Modelle aus Psychologie, Soziologie und Staatswissenschaft ist das einzige, was diese Arbeit bieten kann. Dabei erheben die Ergebnisse keinen Anspruch auf eine allgemeine Gültigkeit, sie sollen vielmehr als Einstieg in das Themas Selbstdarstellung des Staates dienen. Als eine Arte theoretisches Gerüst für die konkreten Einzelaspekte der staatlichen Selbstdarstellung.
Es bleibt jedoch zu beantworten, wie viele Kräfte ein System in die Zweckdarstellung und nicht in die Zweckerfüllung investiert..
Literaturverzeichnis:
- Austin, Jane. Verstand und Gefühl, Zürich 1996.
- Bergler Reinhold. Dimensionen der Werbemittelanalyse, in: Bergler, Reinhold (Hrsg.). Marktpsychologie. Bern 1972.
- Easton, David. ”A Framework of Political Analysis”, in: Narr, Wolf Dieter. Einführung in die moderne politische Theorie. Theoriebegriffe und Systemtheorie. Stuttgart 1971.
- Goffman, Erving. Wir alle Spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München 1969.
- Etzioni, Amitai. Two Approaches to Organisational Analysis: A Critique and a Suggestion, in: Administrative Science Quarterly 5 (1960). · Goffman, Erving. Communication in an Island Community. ( Dissertation, University of Chicago 1953).
- Luhmann, Niklas. Staat und Politik. Zur Semantik der Selbstbeschreibung politischer Systeme, in: PVS Politische Theoriegeschichte. Probleme einer Teildisziplin der Politischen Wissenschaft, Sonderheft 15/1984. S. 99.
- Kunczik, Michael. Public Relations für Staaten. Die Imagepflege von Nationen als Aspekt der Internationalen Kommunikation. Zum Forschungsstand, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderband 30, 1989. S. 165.
- Luhmann, Niklas. Theorie der Verwaltungswissenschaft. Bestandsaufnahme und Entwurf. Köln 1966.
- Luhmann, Niklas. Funktionen und Folgen formaler Organisation (Schriftenreihen der Hochschule Speyer, Band 20). Berlin 1964.
- Luhmann, Niklas. Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie ( Schriften zum Öffentlichen Recht, 24). Berlin 1965.
- Luhmann, Niklas. Legitimation durch Verfahren, in: Hrsg. Narr, Wolf-Dieter/Offe, Claus. Wohlfahrtsstaat und Massenloyalität ( Neue Wissenschaftliche Bibliothek, 79) S. 233-335, Köln 1975.
- Mann, Thomas. Die Bekenntnisse des Hochstapler Felix Krull. Drankfurt a.M. 2000.
- Mummendey, Dieter. Psychologie der Selbstdarstellung. Bielefeld 1990.
- Quaritsch, Helmut. Die Probleme der Selbstdarstellung des Staates (Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart. Eine Sammlung von Vorträgen und Schriften aus dem Gebiet der gesamten Staatswissenschaften. 478/479). Tübingen 1977.
- Sartre, Jean-Paul. Das Sein und das Nichts. Hamburg 1952.
- Sartre, Jean-Paul. Huis Clos. Stuttgart u.a. 1999.
- Schütz, Astrid. Selbstdarstellung von Politikern. Analyse von Wahlkampfauftritten. Weinheim 1992.
- Shakespeare, William. As you like it. in: The complete Work of William Shakespeare, 10. Auflage, Stanford Conneticut.
[...]
1 Shakespeare, William. As you like it. in: The complete Work of William Shakespeare, 10. Auflage, Stanford Conneticut S. 229-257.
2 Vgl. Luhmann, Niclas. Funktionen und Folgen formaler Organisation (Schriftenreihen der Hochschule Speyer, Band 20). Berlin 1964, S. 110 (Luhmann: Funktionen und Folgen).
3 Ebd. S.110.
4 Goffman, Erving. The presentation of self in Everyday live. Edinburgh 1958. In dieser Arbeit wird aus der deutschen Übersetzung zitiert, die unter folgendem Titel erschien: Goffman, Erving. Wir alle Spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München 1969 (Goffman: Theater).
5 Vgl. u.a. Luhmann: Funktionen und Folgen. Luhmann, Niclas. Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie ( Schriften zum Öffentlichen Recht, 24). Berlin 1965 (Luhmann: Grundrechte). Luhmann, Niclas. Legitimation durch Verfahren, in: Hrsg. Narr, Wolf-Dieter/Offe, Claus. Wohlfahrtsstaat und Massenloyalität ( Neue Wissenschaftliche Bibliothek, 79) S. 233-335, Köln 1975.
6 Quaritsch, Helmut. Die Probleme der Selbstdarstellung des Staates (Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart. Eine Sammlung von Vorträgen und Schriften aus dem Gebiet der gesamten Staatswissenschaften. 478/479). Tübingen 1977.
7 Mummendey, Dieter. Psychologie der Selbstdarstellung. Bielefeld 1990 (Mummendey). Schütz, Astrid. Selbstdarstellung von Politikern. Analyse von Wahlkampfauftritten. Weinheim, 1992 (Schütz).
8 Vgl. Schütz. S. 19.
9 Ebd. S. 20.
10 Vgl. ebd. S. 21.
11 Goffman: Theater. S. 5.
12 Vgl. Luhmann: Grundrechte. S.66.
13 Vgl. Mummendey. S.43.
14 Ebd. S.44.
15 Vgl. Ebd. S. 48.
16 Vgl. Mummendey. S. 57.
17 Sartre, Jean-Paul. Das Sein und das Nichts. Hamburg 1952. S.106. Für die philosophische Richtung des Existenzialismus, deren exponiertester Vertreter Jean-Paul Sartre war, ist der eingeschränkte Blickwinkel, mit dem wir einander Betrachten, die größte Gefahr, für die individuelle Freiheit des Einzelnen. Vgl. Sartre, Jean-Paul. Huis Clos. Stuttgart u.a. 1999. Ein anderer Aspekt des gleichen Phänomes findet sich auch bei Thomas Mann in : Mann, Thomas. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Frankfurt a.M. 2000.
18 Goffman: Theater. S. 227.
19 Vgl. ebd. S.227.
20 Luhmann, Niklas. Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie ( Schriften zum öffentlichen Recht, 24). Berlin 1965 (Luhmann: Grundrechte).
21 ebd. S. 53.
22 ebd. S. 54. Luhmann wiederspricht mit dieser Aussage der These von der immer weiter voranschreitenden Angleichung der “Massenmenschen”, deren Persönlichkeit immer wieter eingeschränkt wird, vgl. Wintrich Josef, M. Zur Problematik der Grundrechte, Köln-Opladen 1957, S. 14. Dabei ist Luhmanns Argumentation durchaus überzeugend und eine genauere Betrachtung der Sozialgeschichte stützt seine These zusätzlich.
23 Neue Studienfächer wie Werbepsychologie (z.B. FH Wernigerode) dokumentieren, dass auch die Professionalisierung der Werbung in den letzten Jahren massiv zugenommen hat.
24 Bergler Reinhold. Dimensionen der Werbemittelanalyse, in: Bergler, Reinhold (Hrsg.). Marktpsychologie. Bern 1972. S. 220-268 (Bergler).
25 Ebd, S. 220.
26 Vgl. ebd. S. 220.
27 Zur Kommunikation zwischen Staat und Umwelt vgl. David Easton Modell ”A Framework of Political Analysis, in: Narr, Wolf Dieter. Einführung in die moderne politische Theorie. Theoriebegriffe und Systemtheorie. Stuttgart 1971.
28 Luhmann: Funktionen. S. 110.
29 Luhmann, Niklas. Staat und Politik. Zur Semantik der Selbstbeschreibung politischer Systeme, in: PVS Politische Theoriegeschichte. Probleme einer Teildisziplin der Politischen Wissenschaft, Sonderheft 15/1984. S. 99.
30 Goffman, Erving. Communication in an Island Community ( Dissertation, University of Chicago 1953). Diese Arbeit lag dem Verfasser des Textes nicht im Original vor und wird nur aus zweiter Hand angeführt.
31 Vgl. Goffmann: Theater. S. 161-173
32 Ebd. S.127.
32 Vgl. ebd. S. 128.
34 Vgl. Austin, Jane. Sense and Sensibility. Zuletzt auf deutsch verlegt, als: Verstand und Gefühl, Zürich 1996.
34 Vgl. Mummendey. S. 52.
35 Vgl. Goffmann: Theater. S. 102.
36 Ebd. S. 175.
38 Vgl. Luhmann: Funktionen. S.108.
39 Vgl. ebd. S.109. Vgl. Quaritsch. S. 10.
40 Etzioni, Amitai. Two Approaches to Organisational Analysis: A Critique and a Suggestion, in: Administrative Science Quarterly 5 (1960) S. 257-278.
41 vgl. Luhmann: Funktionen. S. 119.
42 Luhmann: Funktionen. S. 111.
43 Vgl. ebd. S.111.
43 Vgl. ebd. S. 113.
44 Vgl. ebd. S. 112.
46 ebd. S.113-115.
46 Bundesbeamtengesetz, mit Erläuterung von Ulrich Batis. 2., völlig neu bearbeitete Auflage. München 1997.
48 Luhmann, Niklas. Theorie der Verwaltungswissenschaft. Bestandsaufnahme und Entwurf. Köln 1966.
49 Vgl. Luhmann Niklas: Funktionen. S.110.
50 ebd. S.117.
51 Vgl.Quaritsch. S.11.
52 Ebd. S.13.
53 Ebd. S.33.
54 Ebd. S. 49.
55 Kunczik, Michael. Public Relations für Staaten. Die Imagepflege von Nationen als Aspekt der Internationalen Kommunikation. Zum Forschungsstand, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderband 30, 1989. S. 165 (Kunczik).
55 Vgl. ebd. S. 168.
57 Beispiele hierfür sind die Werbefeldzüge in Rundfunk, TV und Printmedien. Die Ägypten und die Türkei zu Beginn der Winterreisesaison 2000 gestartet haben.
58 Vgl. ebd. S.168.
59 Kunczik. S. 175.
60 Henry Lua war Verleger und Gründer des TIME Magazine.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Selbstdarstellung?
Diese Arbeit untersucht die Selbstdarstellung nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch von sozialen Systemen, insbesondere der staatlichen Verwaltung. Sie analysiert, inwieweit Selbstdarstellung eine Kategorie wird, die das Handeln, insbesondere des Staates, bestimmt.
Wie ist die Vorgehensweise in dieser Arbeit?
Die Arbeit gibt zunächst Einblicke in verschiedene Forschungsfelder wie Psychologie und Wirtschaftswissenschaften, um die Selbstdarstellung des Einzelnen zu untersuchen. Anschließend rückt die Soziologie und damit die Selbstdarstellung sozialer Systeme in den Mittelpunkt, um die Erkenntnisse auf den Staat anzuwenden.
Welche wichtigen Forscher werden in Bezug auf Selbstdarstellung erwähnt?
Erving Goffman wird für seine Arbeit "The Presentation of Self in Everyday Life" genannt, Niclas Luhmann für seine soziologische Analyse der Selbstdarstellung sozialer Systeme und Helmut Quaritsch für seine staatswissenschaftliche Sicht auf die Selbstdarstellung des Staates.
Was versteht man unter "Person vs. Situation" im Kontext der Selbstdarstellung?
Das Verhalten wird sowohl durch die Persönlichkeit als auch durch die jeweilige Situation bestimmt. Es wird zwischen starken (wenig Spielraum für Selbstdarstellung) und schwachen (viel Spielraum für Selbstdarstellung) Situationen unterschieden.
Was bedeuten "gives" und "gives off" im Zusammenhang mit Selbstdarstellung?
"Gives" bezieht sich auf das, was eine Person direkt über sich mitteilt, während "gives off" das ist, was andere aus dem Verhalten der Person schließen.
Wie wird der Vergleich zum Theater in der Psychologie der Selbstdarstellung verwendet?
Es wird unterschieden zwischen einem "backstage Bereich" (Privates Ich) und einem "offstage Bereich" (Öffentliches Ich), wobei jede Person nicht nur Darsteller, sondern auch Zuschauer ist. Menschen füllen Rollen aus, ähnlich wie Schauspieler auf einer Bühne.
Welche Rolle spielt Werbung bei der Selbstdarstellung?
Firmen nutzen Selbstdarstellung, um ihre Produkte mit einem bestimmten Image zu versehen und den Verkauf zu fördern. Gleichzeitig beeinflusst die Werbung auch die Selbstdarstellung des Einzelnen, indem sie Idealvorstellungen von Konsumentengruppen bedient.
Was ist eine "Ensembledarstellung" im Kontext sozialer Systeme?
Wenn soziale Gruppen sich gegenüber ihrer Umwelt als geschlossenes System darstellen, spricht man von einer Ensemble-Verschwörung, bei der Geheimnisse eine wichtige Rolle spielen, um die Gruppe abzugrenzen.
Wie passen sich Organisationen an ihre Umwelt an?
Der wesentlichste Faktor ist der Zweck des Systems, also welche Leistungen dem System etwas einbringen. Organisationen müssen ihren Zweck kommunizieren und Kräfte, die eigentlich der Zweckerfüllung dienen, zur Zweckdarstellung abstellen.
Welche Rolle spielt die Verwaltung bei der Selbstdarstellung des Staates?
Verwaltungen sind Organisationen, deren Zweck es ist, Entscheidungen zu kommunizieren. Sie sind der ideale Ausgangspunkt, um die Selbstdarstellung des Staates zu betrachten, da sie die Kommunikation zwischen politischem System und Gesellschaft darstellen.
Wie dient die Organisationsstruktur der Selbstdarstellung der Verwaltung?
Die Organisationsstruktur ist ein wesentliches Mittel der Selbstdarstellung, da sie dazu beiträgt, die Entscheidungen der Verwaltung kalkulierbar zu machen.
Warum ist Idealisierung für die Selbstdarstellung der Verwaltung notwendig?
Die Wirklichkeit ist von sich aus nicht akzeptabel, daher ist eine Idealisierung notwendig. Fehler und Unzulänglichkeiten verschwinden hinter einer Fassade aus Korrektheit und sachlicher Kompetenz.
Was bedeutet unbürokratisches Verhalten im Kontext der Verwaltung?
Von der Verwaltung wird erwartet, dass sie neutral ist und ihre Entscheidungen gemäß ihrer Richtlinien fällt, gleichzeitig aber auch flexibel und unbürokratisch handelt. Sie muss sich also gleichzeitig als verlässlich und flexibel darstellen.
Wie stellt sich der Staat nach Innen dar?
Der Staat nutzt Staatssymbole, Staatsarchitektur und besondere Veranstaltungen, um eine Identifikation zu ermöglichen und die Loyalität seiner Bürger zu gewinnen.
Wie erfolgt die Selbstdarstellung des Staates im internationalen Kontext?
Staaten müssen sich auch gegenüber anderen Staaten darstellen, um ihr Image zu pflegen und wirtschaftliche oder politische Ziele zu erreichen.
- Quote paper
- Phillip-Alexander Harter (Author), 2001, Selbstdarstellung des Staates als Kategorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104188