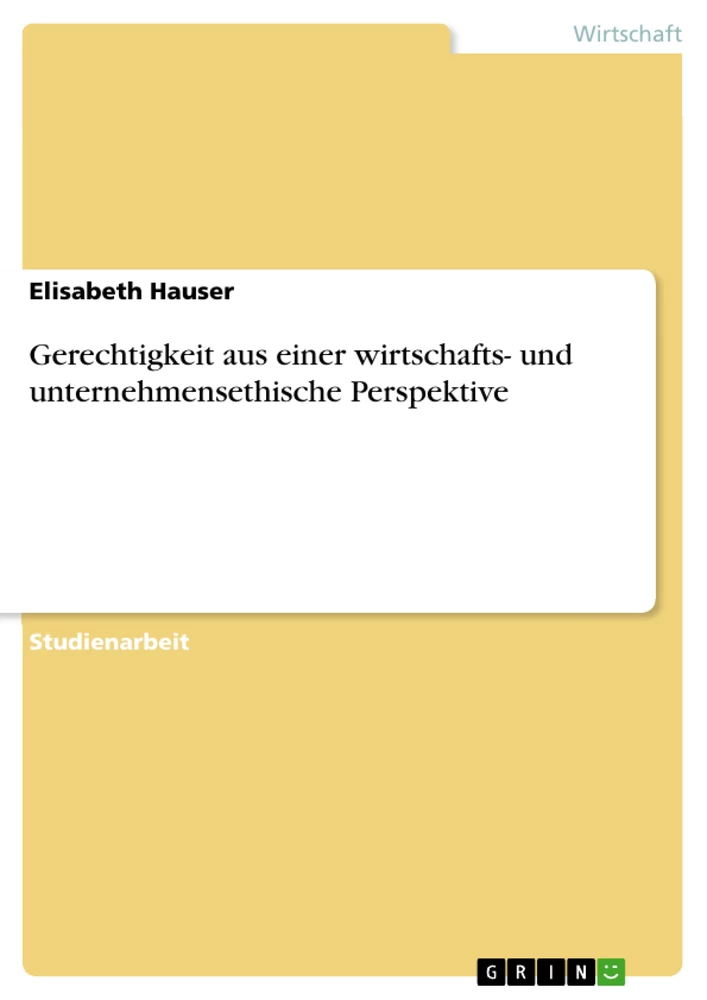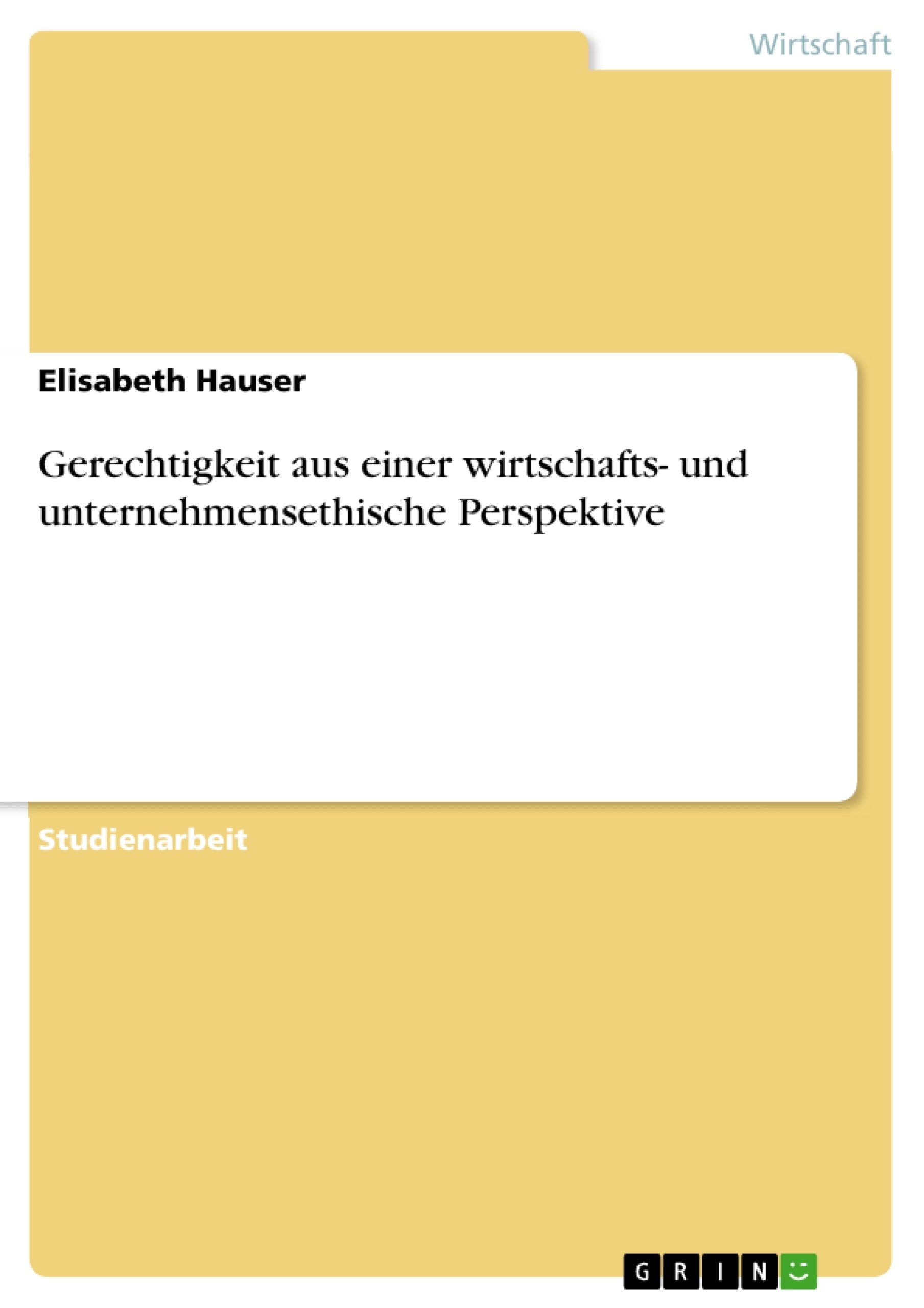In dieser Arbeit stellt sich die Frage: inwiefern geht es in der Ökonomie überhaupt um Gerechtigkeit und wie kann diese realisiert werden? Der Gerechtigkeitsbegriff spielt in der Ethik eine zentrale Rolle. Eine Aufgabe der Wirtschaftsethik ist die Explikation der grundlegenden normativen Leitbegriffe wie Solidarität und Gerechtigkeit. Wirtschaftliche Entscheidungen betreffen die legitimen Interessen anderer. Daher darf, und muss, immer gefragt werden, ob sie umfassend vernünftig und moralisch richtig sein. Bei der Betrachtung einer gerechten und fairen Gestaltung einer wirtschaftlichen Ordnung spielt die Globalisierung eine wichtige Rolle. Aufgrund der heutigen transnationalen Tätigkeiten von Unternehmen, sind auch die internationalen Beziehungen und damit verbundene internationale, wirtschaftliche Gerechtigkeit immer häufiger Gegenstand von Diskussionen. Die Forderungen nach mehr Moral in der Wirtschaft werfen aber auch eine ganze Reihe weiterer Fragen auf – Fragen der Gerechtigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gerechtigkeit in der Ökonomie
- Gerechte Arbeitsbedingungen
- Arbeitsentgelte und Gerechtigkeit
- Geschlechtergerechtigkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem komplexen Thema der Gerechtigkeit im Kontext der Wirtschafts- und Unternehmensethik. Ziel ist es, die Bedeutung des Gerechtigkeitsbegriffs in der Ökonomie zu analysieren und anhand relevanter Beispiele zu verdeutlichen, wie sich Gerechtigkeitstheorien in der Praxis manifestieren.
- Der Gerechtigkeitsbegriff nach Aristoteles und seine Relevanz für die Wirtschaft
- Gerechtigkeitsprinzipien in der Marktwirtschaft: Tauschgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Bedürfnisgerechtigkeit und Verfahrensgerechtigkeit
- Aktuelle Herausforderungen im Bereich der Arbeitsbedingungen, Arbeitsentgelte und Geschlechtergerechtigkeit
- Die Rolle der Sozialen Marktwirtschaft und ordnungspolitischer Strategien zur Gestaltung einer gerechteren Wirtschaftsordnung
- Der Einfluss von Globalisierung und transnationalen Unternehmen auf die Diskussion um internationale Gerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Gerechtigkeitsbegriff als zentrales Element der Wirtschaftsethik vor und beleuchtet die Bedeutung von Moral in der Wirtschaft. Die Globalisierung und die internationalen Beziehungen werden als wichtige Einflussfaktoren auf die Debatte um wirtschaftliche Gerechtigkeit hervorgehoben.
- Gerechtigkeit in der Ökonomie: Dieses Kapitel analysiert den Gerechtigkeitsbegriff nach Aristoteles und seine Anwendung auf die Wirtschaft. Es werden die austeilende und die ausgleichende Gerechtigkeit sowie deren Bedeutung für die Verteilung von Gütern und die Gestaltung von Märkten diskutiert.
- Gerechte Arbeitsbedingungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von gerechten Arbeitsbedingungen im Kontext der Wirtschaftsethik. Es werden aktuelle Herausforderungen und Debatten im Bereich der Arbeitsbedingungen und deren Auswirkungen auf die Gerechtigkeit diskutiert.
- Arbeitsentgelte und Gerechtigkeit: Das Kapitel thematisiert die Frage der gerechten Arbeitsentgelte und beleuchtet die verschiedenen Gerechtigkeitskonzepte, die im Zusammenhang mit Löhnen und Gehältern diskutiert werden. Aktuelle Problemfelder wie die Lohngerechtigkeit und die Auswirkungen der Corona-Krise werden aufgezeigt.
- Geschlechtergerechtigkeit: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Geschlechtergerechtigkeit in der Wirtschaft. Es werden die Herausforderungen und Problemfelder im Zusammenhang mit der Gleichstellung von Frauen und Männern im Arbeitsleben beleuchtet.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, Aristoteles, austeilende Gerechtigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit, Marktwirtschaft, Tauschgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Bedürfnisgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit, Arbeitsbedingungen, Arbeitsentgelte, Geschlechtergerechtigkeit, Soziale Marktwirtschaft, Ordnungspolitik, Globalisierung, Internationale Gerechtigkeit
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Gerechtigkeit in der Wirtschaftsethik?
Die Wirtschaftsethik untersucht normative Leitbegriffe wie Solidarität und Gerechtigkeit, um zu bewerten, ob wirtschaftliche Entscheidungen moralisch richtig und vernünftig sind.
Was ist der Unterschied zwischen austeilender und ausgleichender Gerechtigkeit?
Basierend auf Aristoteles bezieht sich die austeilende Gerechtigkeit auf die Verteilung von Gütern nach Verdienst, während die ausgleichende (Tausch-)Gerechtigkeit auf fairen Austauschverhältnissen basiert.
Was versteht man unter Leistungsgerechtigkeit und Bedürfnisgerechtigkeit?
Leistungsgerechtigkeit belohnt den individuellen Beitrag, während Bedürfnisgerechtigkeit darauf abzielt, jedem Menschen ein menschenwürdiges Dasein unabhängig von der Marktleistung zu ermöglichen.
Wie beeinflusst die Globalisierung die wirtschaftliche Gerechtigkeit?
Durch transnationale Tätigkeiten verschiebt sich die Debatte auf internationale Beziehungen und die Frage, wie faire Standards weltweit durchgesetzt werden können.
Ist die Soziale Marktwirtschaft ein Modell für mehr Gerechtigkeit?
Ja, sie nutzt ordnungspolitische Strategien, um Marktfreiheit mit sozialem Ausgleich und fairen Wettbewerbsbedingungen zu verbinden.
- Quote paper
- Elisabeth Hauser (Author), 2020, Gerechtigkeit aus einer wirtschafts- und unternehmensethische Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1042180