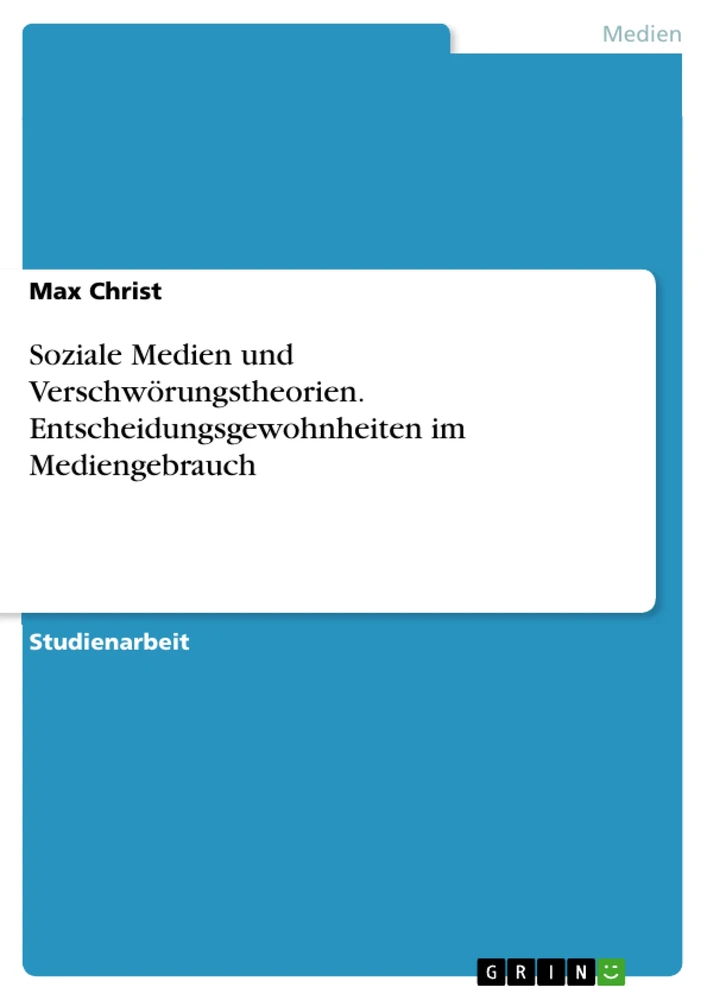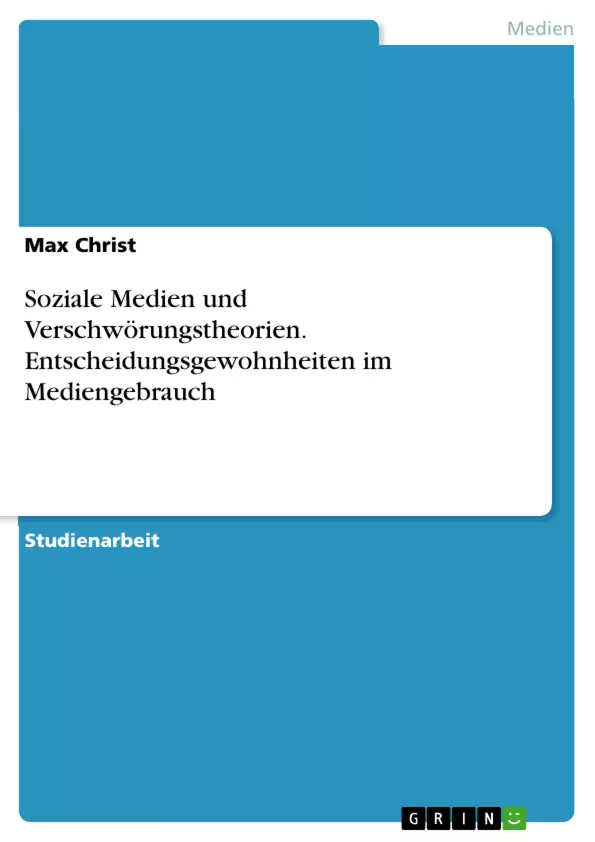Der zentrale Gegenstand der vorliegenden Untersuchung richtet sich auf die Verschwörungsmentalität als eine Vorbedingung für Verschwörungsideologie. Die Corona-Pandemie stellt enorme Anforderungen an unsere Fähigkeit, Ambiguität zu ertragen bzw. mit Unsicherheit zu leben. Neben diesen situativen Herausforderungen ist die Reduzierung von Unsicherheit stark abhängig von den individuellen Persönlichkeitseigenschaften der Betroffenen und deren Informations- und Kommunikationsquellen. Dies schafft einen Nährboden für die epidemische Ausbreitung von sogenannten Verschwörungstheorien und deren ungebremste mediale Verbreitung im Internet und den Sozialen Medien.
Um ihre Unsicherheit abzubauen, neigen Verschwörungsgläubige zur Annahme einfacher Schuldursachen für Ereignisse, die sie geheimen Eliten zuschreiben. Den Begriff "Verschwörungstheorie" wird in dieser Studie nicht benutzt, da die darin enthaltenen Aussagen nicht falsifiziert werden können und damit wissenschaftlichen Anforderungen nicht genügen. Stattdessen wird der Begriff der Verschwörungsideologie für manifeste, d.h. veröffentlichte Verschwörungsannahmen gebraucht.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung, Zielstellung und Forschungsfrage
- Was kennzeichnet Verschwörungsideologien
- Was kennzeichnet eine Verschwörungsmentalität?
- Einfluss von Internet und Medien
- Die Bedeutung von Internet und Medien für die Verbreitung von Verschwörungsglauben
- Glaubwürdigkeit von Medien
- Kognitive Geschlossenheit und Verschwörungsglauben
- Hypothesen
- Fragebogendesign und Datenerhebung
- Datenauswertung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studie untersucht die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Mediennutzung und Entscheidungsgewohnheiten im Mediengebrauch, insbesondere im Hinblick auf die Verbreitung von Verschwörungsideologien. Sie analysiert die Rolle der kognitiven Geschlossenheit als Persönlichkeitsdimension im Kontext der Verschwörungsmentalität und deren Zusammenhang mit Medienkompetenz.
- Einfluss der Corona-Pandemie auf Mediennutzung und Entscheidungsgewohnheiten
- Rolle der kognitiven Geschlossenheit bei der Akzeptanz von Verschwörungsideologien
- Zusammenhang zwischen kognitiver Geschlossenheit und Medienkompetenz
- Verbreitung von Verschwörungsideologien in den Medien
- Analyse der Verschwörungsmentalität als latente Persönlichkeitseigenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Problemstellung, Zielstellung und Forschungsfrage: Dieses Kapitel beschreibt den Forschungsgegenstand und die zentralen Fragestellungen der Studie, die sich mit der Verschwörungsmentalität im Kontext der Corona-Pandemie befassen.
- Was kennzeichnet Verschwörungsideologien: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Verschwörungsideologie und zeichnet dessen Merkmale und historische Entwicklung nach. Es zeigt die Bedeutung von Kritik und Falsifizierbarkeit in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien auf.
- Was kennzeichnet eine Verschwörungsmentalität?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Verschwörungsmentalität als latente Persönlichkeitseigenschaft und beschreibt deren Merkmale und Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Informationen und die Bildung von Meinungen.
- Einfluss von Internet und Medien: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Internet und Medien bei der Verbreitung von Verschwörungsglauben und untersucht die Glaubwürdigkeit von Medien im Kontext von Verschwörungsideologien.
- Kognitive Geschlossenheit und Verschwörungsglauben: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der kognitiven Geschlossenheit als Persönlichkeitsdimension im Zusammenhang mit der Akzeptanz von Verschwörungsideologien.
- Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert Hypothesen, die im weiteren Verlauf der Studie anhand von empirischen Daten überprüft werden.
- Fragebogendesign und Datenerhebung: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie und die Entwicklung und Anwendung des Fragebogens zur Erhebung von Daten.
Schlüsselwörter
Die Studie konzentriert sich auf die Themen Mediennutzung, Entscheidungsgewohnheiten, Verschwörungsmentalität, kognitive Geschlossenheit, Medienkompetenz, Corona-Pandemie, Verschwörungsideologien und die Verbreitung von Desinformationen im Internet und in sozialen Medien. Im Mittelpunkt steht die empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen kognitiver Geschlossenheit, Medienkompetenz und der Akzeptanz von Verschwörungstheorien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und -ideologie?
Die Studie nutzt den Begriff Ideologie für manifeste Annahmen, da "Theorien" oft nicht wissenschaftlich falsifizierbar sind.
Was kennzeichnet eine Verschwörungsmentalität?
Es ist eine latente Persönlichkeitseigenschaft, die zur Annahme geheimer Mächte und einfacher Schuldzuweisungen neigt, um Unsicherheit abzubauen.
Wie beeinflusste Corona die Verbreitung von Verschwörungsglauben?
Die Pandemie erzeugte hohe Unsicherheit und Ambiguität, was den Nährboden für die epidemische Ausbreitung von Ideologien in sozialen Medien schuf.
Was bedeutet "kognitive Geschlossenheit"?
Es beschreibt das Bedürfnis nach eindeutigen Antworten und die Abneigung gegen Unsicherheit, was die Akzeptanz von Verschwörungsideologien fördern kann.
Welche Rolle spielt die Medienkompetenz?
Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Medienkompetenz und der Fähigkeit, Desinformationen im Internet kritisch zu hinterfragen.
- Quote paper
- Max Christ (Author), 2021, Soziale Medien und Verschwörungstheorien. Entscheidungsgewohnheiten im Mediengebrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1042545