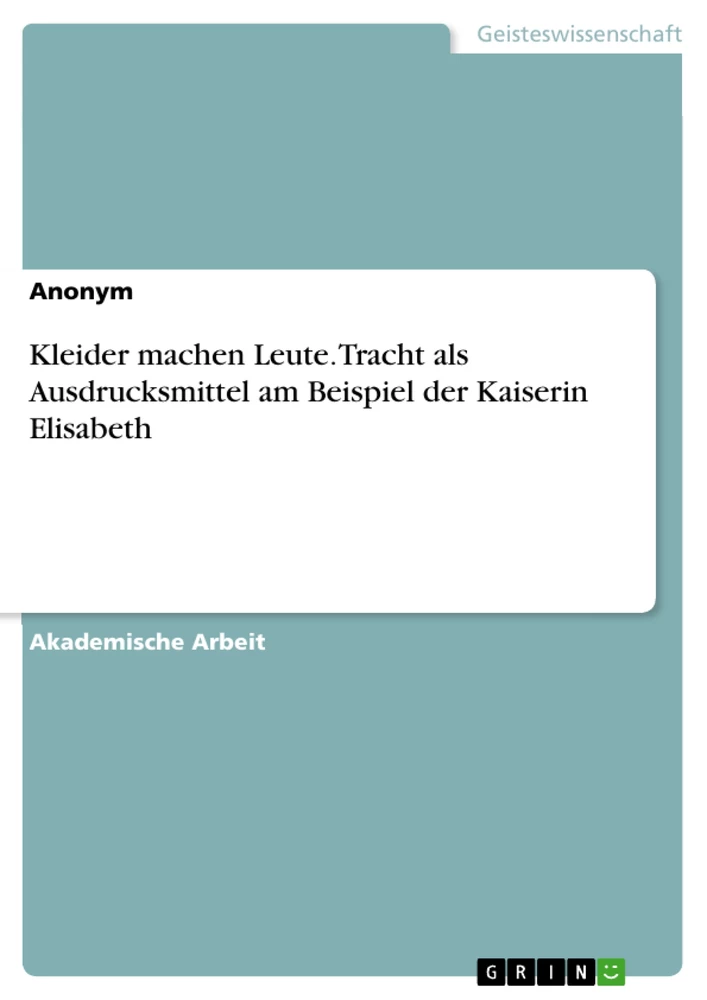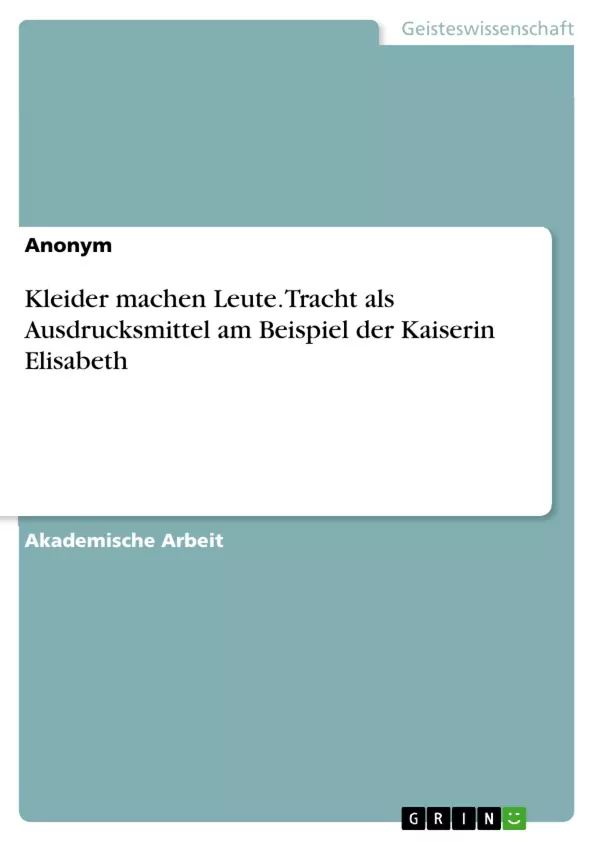Nach einem knappen historischen Überblick über die ungarische Nationaltracht als Hofkleidung sollen in dieser Arbeit die zeitlosen Aspekte des Tragens von Tracht anhand biographischer Aspekte aus dem Leben Elisabeths betrachtet werden. Die dabei herauskristallisierten zentralen Motive erscheinen auf den ersten Blick widersprüchlich – in einem Wechselspiel zwischen Aspekten wie Tradition, Repräsentation, Kollektiv, Uniformität und nationaler Zugehörigkeit; zwischen Symbol, Stereotyp und Unterhaltung auf der einen, Individualisierung und Abgrenzung, Selbstinszenierung und Provokation auf der anderen Seite. Es wird dabei deutlich erkennbar, dass es beim Tragen von Tracht stets um Konzepte der Repräsentation und der Identitätsbildung geht, deren Grenzen häufig schwer greifbar und ineinander verschwommen bleiben.
Trotz seiner Loyalität für die Wiener Regierung trägt der ungarische Lehrer Johann Mailáth seiner Schülerin Elisabeth, der zukünftigen Königin von Ungarn, die österreichische Geschichte im ungarischen Sinne vor. Diese Unterrichtsstunden im Kreise der herzoglichen Familie in Bayern dürften bei der 15-Jährigen die Basis für ihre spätere politische Anschauung gelegt haben und sind in ihrer Bedeutung kaum zu unterschätzen. Obgleich sie sich überwiegend aus der Politik heraushält, macht Elisabeth doch eine Ausnahme, als es um Ungarn geht: 1867 ist ihr Einfluss entscheidend für den »Ausgleich« zwischen Österreich und Ungarn, dessen Höhepunkt die Königskrönung in Budapest darstellt.
Elisabeths Begeisterung für Ungarn spiegelt sich auch in ihrer Garderobe wider: Zeitlebens trägt sie zu besonderen Anlässen ungarische Nationaltracht und setzt damit eindeutige Zeichen. An ihrem Beispiel lassen sich auch heute – in einer Zeit, da »Tracht« nicht nur bei den Besuchern des Münchner Oktoberfestes eine neue Konjunktur erlebt – die unterschiedlichen Bedeutungs- und Ausdrucksebenen des Tragens von Tracht allgemein beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche Hintergründe
- Die Biographie Kaiserin Elisabeths
- Die ungarische Nationaltracht als Hofkleidung
- Bedeutungsebenen der Tracht
- Tracht als Ausdrucksmittel am Beispiel Elisabeths
- Kollektive Zugehörigkeit und Repräsentation
- Provokation und Abgrenzung
- Identität und Individualisierung
- Selbst-Inszenierung und Unterhaltungswert
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der ungarischen Nationaltracht als Ausdrucksmittel anhand des Beispiels von Kaiserin Elisabeth. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Tracht sowohl kollektive Zugehörigkeit und Repräsentation als auch individuelle Identität und Selbstinszenierung widerspiegeln konnte.
- Die historische Entwicklung der ungarischen Nationaltracht als Hofkleidung
- Die verschiedenen Bedeutungsebenen des Tragens von Tracht
- Die Rolle der Tracht in der Selbstinszenierung und Identitätsbildung Kaiserin Elisabeths
- Der Kontrast zwischen Tradition und Modernität im Kontext der Trachtenmode
- Die Verbindung von politischer und sozialer Bedeutung der Tracht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung der ungarischen Nationaltracht im Leben Kaiserin Elisabeths. Sie führt den Leser in die Themenbereiche ein, die in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet werden.
- Geschichtliche Hintergründe: Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der ungarischen Nationaltracht als Hofkleidung und beleuchtet ihre Bedeutung als Ausdruck nationaler Identität und politisches Symbol. Es geht auch auf die Biografie Kaiserin Elisabeths ein und zeichnet ein Bild ihrer frühen Prägung durch ungarische Kultur.
- Tracht als Ausdrucksmittel am Beispiel Elisabeths: Dieses Kapitel befasst sich mit der vielschichtigen Bedeutung der ungarischen Nationaltracht im Kontext der Persönlichkeit und des Lebens von Kaiserin Elisabeth. Es analysiert, wie die Tracht in verschiedenen Situationen und zu unterschiedlichen Anlässen als Mittel der Repräsentation, der Selbstinszenierung und der Identitätsbildung fungierte.
Schlüsselwörter
Ungarische Nationaltracht, Kaiserin Elisabeth, Repräsentation, Identität, Individualisierung, Selbstinszenierung, Tradition, Moderne, Hofkleidung, politische Symbolik, Habsburger, Ungarn.
Häufig gestellte Fragen zu Kaiserin Elisabeth und der Tracht
Warum trug Kaiserin Elisabeth ungarische Nationaltracht?
Sie nutzte die Tracht als politisches Statement ihrer Verbundenheit mit Ungarn und als Mittel zur persönlichen Identitätsbildung und Abgrenzung vom Wiener Hof.
Welche Bedeutung hat Tracht allgemein als Ausdrucksmittel?
Tracht symbolisiert kollektive Zugehörigkeit, nationale Identität und Tradition, kann aber auch zur bewussten Provokation oder Selbstinszenierung eingesetzt werden.
Wie beeinflusste Elisabeth den "Ausgleich" von 1867?
Ihr Einfluss auf Kaiser Franz Joseph war entscheidend für die Versöhnung mit Ungarn, was in der Krönung des Kaiserpaares in Budapest gipfelte.
Was war die ungarische Nationaltracht als Hofkleidung?
Es handelte sich um eine festliche Kleidung, die traditionelle ungarische Elemente mit den Anforderungen der höfischen Etikette verband.
Diente die Kleidung Elisabeth auch zur Provokation?
Ja, durch das Tragen ungarischer Kleidung am Wiener Hof signalisierte sie oft ihre Distanz zur strengen spanischen Hofetikette und ihre Vorliebe für die ungarische Kultur.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Kleider machen Leute. Tracht als Ausdrucksmittel am Beispiel der Kaiserin Elisabeth, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043062