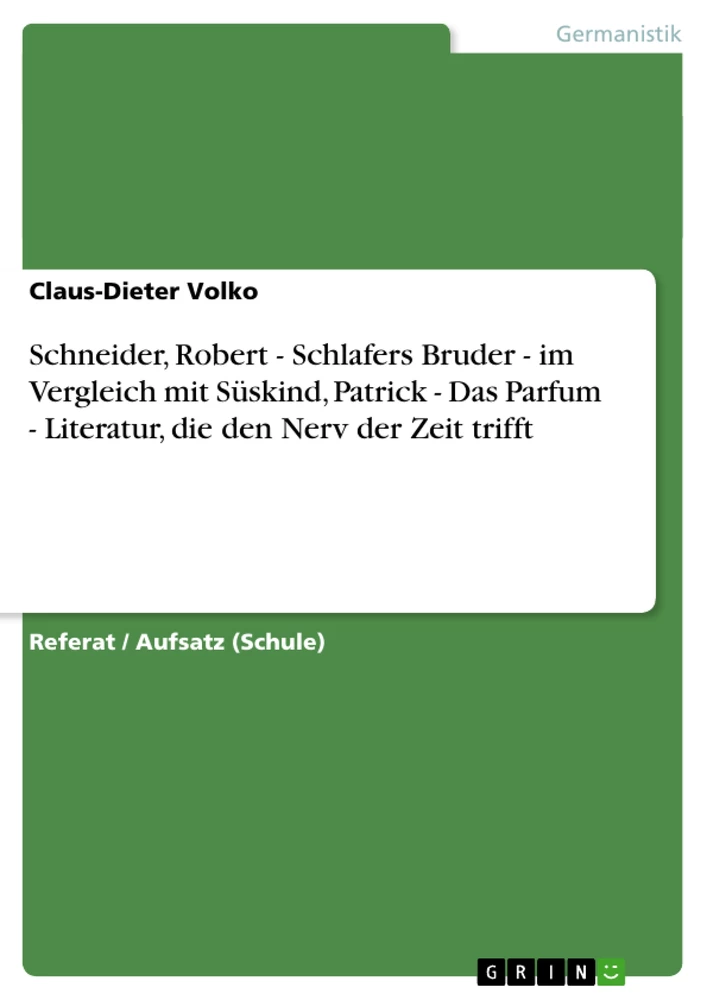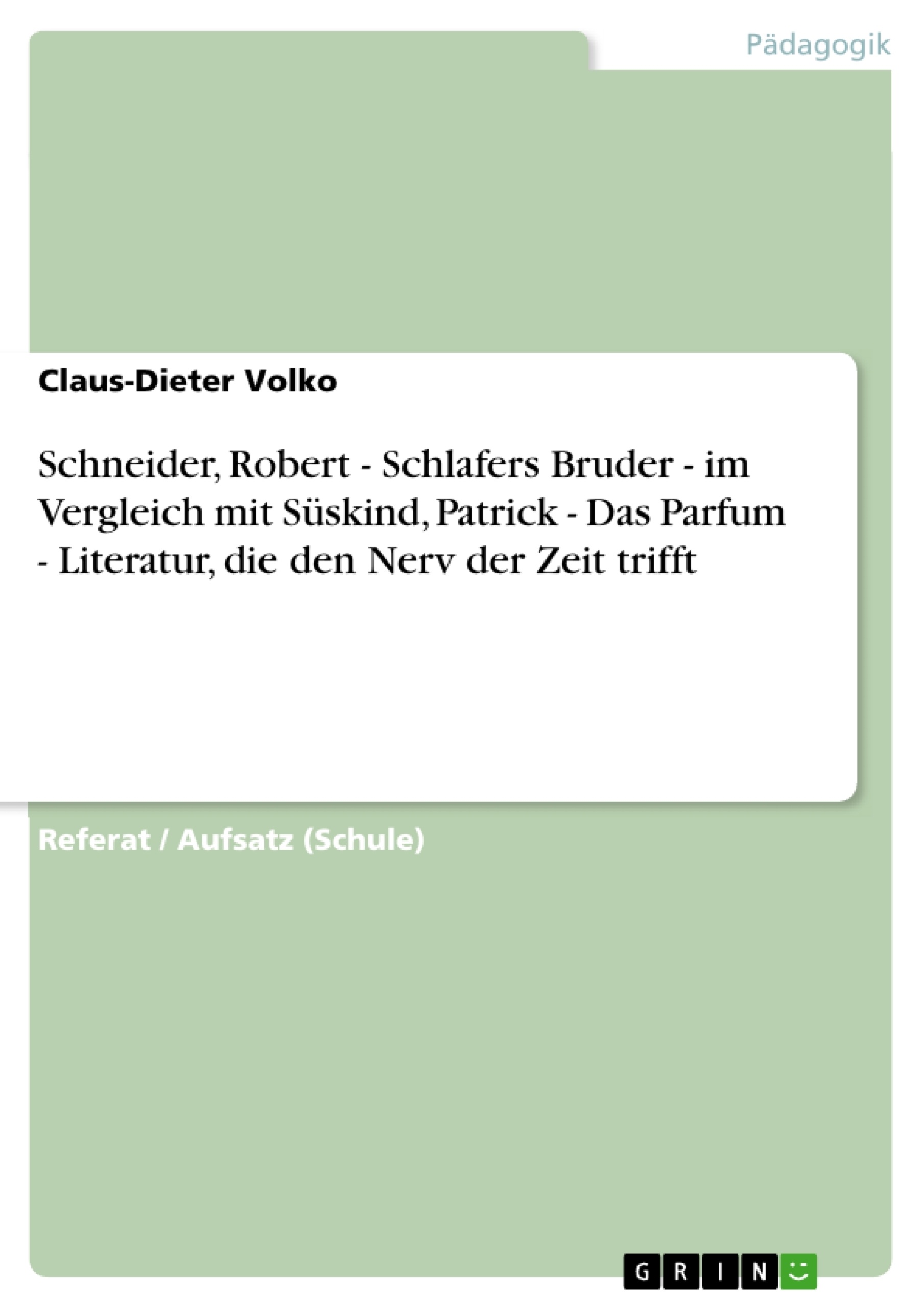Was verbindet einen mörderischen Parfümeur im Frankreich des 18. Jahrhunderts mit einem genialen Musiker im Vorarlberg des frühen 19. Jahrhunderts? Tauchen Sie ein in eine fesselnde Analyse, die die literarischen Meisterwerke "Das Parfüm" von Patrick Süskind und "Schlafes Bruder" von Robert Schneider vergleicht und überraschende Parallelen offenbart. Diese tiefgründige Untersuchung enthüllt, wie beide Romane, angesiedelt im Genre des historischen Romans, die Leser in die Psyche außergewöhnlicher Charaktere entführen, die in einer von Ignoranz geprägten Welt nach Anerkennung suchen. Entdecken Sie die Gemeinsamkeiten im Motiv des Genies, der Initiationserlebnisse und der Sprachlosigkeit, die beide Werke zu Bestsellern machten. Ergründen Sie die Frage, inwieweit sich der moderne Mensch, gefangen in der Anonymität der Masse, mit den Protagonisten identifizieren kann, die nach Ausdruck und Bedeutung suchen. Diese vergleichende Betrachtung beleuchtet nicht nur die literarischen Feinheiten beider Romane, sondern wirft auch ein Licht auf zeitlose Themen wie Talent, Isolation und die Suche nach dem Sinn des Lebens. Eine faszinierende Reise in die Welt der Literatur, die den Leser dazu anregt, über die eigene Wahrnehmung und die verborgenen Tiefen der menschlichen Natur nachzudenken. Erfahren Sie, wie Süskinds humorvoll-ironischer Stil und Schneiders tragischer Pathos die Leser in ihren Bann ziehen und warum diese Werke auch heute noch relevant sind. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Literatur, Psychologie und die conditio humana interessieren. Lassen Sie sich von der Brillanz Süskinds und Schneiders inspirieren und entdecken Sie die verborgenen Botschaften in ihren zeitlosen Meisterwerken, die den Leser noch lange nach der Lektüre beschäftigen werden. Eine literarische Schatzsuche, die neue Perspektiven eröffnet und zum Nachdenken anregt.
Literatur, die den Nerv der Zeit trifft
"Das Parfüm" von Patrick Süskind und Robert Schneiders "Schlafes Bruder": Ein Vergleich
Ein halbes Jahrzehnt liegt zwischen dem Erscheinen von "Das Parfüm" und "Schlafes Bruder". Beide Romane haben glänzende Kritiken erhalten, beide sind im ganzen deutschen Sprachraum, aber auch darüber hinaus zu Bestsellern avanciert. Was mag die Ursache für ihren Erfolg gewesen sein?
Wenn man nur ein Werk gesondert betrachtet, mag man verschiedenste, unterschiedlichste Gründe für seine große Akzeptanz beim Publikum finden. Hat man aber die Möglichkeit, zwei in ein- und derselben Epoche erschienene Beispiele schöngeistiger Literatur miteinander zu vergleichen, so lassen sie Gemeinsamkeiten finden, die sehr wahrscheinlich den Ausschlag für den Verkaufserfolg gegeben haben.
Beide Werke lassen sich offensichtlich in die Gattung des "historischen Romans" einordnen, denn ihre Handlungen spielen in der Vergangenheit, im vorrevolutionären Frankreich bzw. im Vorarlberg des frühen 19. Jahrhunderts. Sie sind aber auch psychologische Romane, die sich stark mit dem Charakter und der Entwicklung ihrer Hauptpersonen sowie dem Umfeld, dem diese ausgesetzt sind, befassen. Das sind meiner Meinung nach die beiden Gattungen, denen sich sowohl "Das Parfüm" als auch "Schlafes Bruder" eindeutig zuordnen lassen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. So ließe sich, oberflächlich betrachtet, nicht nur "Das Parfüm", sondern auch "Schlafes Bruder" als Kriminalroman auslegen: Immerhin werden ein paar Morde begangen und durchaus ausführlich geschildert. Die Einordnung von "Das Parfüm" in die Kategorie der Liebesromane, zu denen "Schlafes Bruder" sicherlich zählt, bereitet dagegen schon deutlich mehr Kopfschmerzen: Ich würde lieber die Bezeichnung "erotischer Roman" wählen.
Von all diesen Aspekten, nach denen man die Werke von Süskind und Schneider interpretieren könnte, scheint mir der psychologische am wichtigsten. Denn beide Romane haben das Motiv des Genies und die Thematik der Geniewerdung gemeinsam: Ein Mensch mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wird in ein ziemlich bescheidenes Umfeld hineingeboren. Seine Talente werden zunächst nicht erkannt, da seine Makel stärker zu Tage treten und so den Blick auf das Herausragende verstellen. Der wundersame Parfümeur, der begnadete Musiker, sie beide wachsen in einer ignoranten, ja feindseligen Umgebung auf. Sie selbst ahnen von ihrer Hochbegabung vorerst wenig, bis es zu einer merkwürdigen Initiation kommt: im Falle Grenouilles die Begegnung mit dem wundervoll duftendem Mädchen, bei Johannes Elias Alder das Klangerlebnis und die gleichzeitige körperliche Deformation auf dem Stein im Gebirge. Die Initiation als zweite Geburt ist ein weiteres gemeinsames Motiv der beiden auktorial erzählten Romane. Sie führt dazu, dass sich die Handlungsträger ihrer Fähigkeiten bewusst werden und fortan zielstrebig danach trachten, von ihnen Gebrauch zu machen. Aus eigener Kraft gelingt es ihnen, der Erfüllung ihrer künstlerischen Ambitionen einen Schritt näherzukommen: Grenouille wird Assistent M. Baldinis, Elias Balgtreter des Dorforganisten und später dessen Stellvertreter.
Während Elias von da an aber lange Zeit keine weiteren Entwicklungen in seiner künstlerischen Laufbahn durchmacht und das unerträgliche Leid des Liebenden, dessen Liebe offenbar nicht erwidert wird, an seinen Kräften zehrt, bis es ihn vollends vernichtet, zieht Grenouille fort in die weite Welt, erfährt im Zentralmassiv eine Art zweiter Initiation und verhilft in Südfrankreich einem adeligen Pseudowissenschaftler zu Ruhm und Ehre. Zwar werden seine mächtigen Fähigkeiten noch nicht vom allgemeinen Publikum erkannt, doch ist sich Grenouille dessen bewusst, dass er auf seinem Gebiet einmalig und nicht zu übertreffen ist. Elias dagegen kennt zwar sein Talent und weiß, dass keiner in Eschberg ihm musikalisch das Wasser reichen kann, aber er ist sich nicht im Klaren, welch hervorragende Stellung er in der gesamten Musikwelt haben könnte, weil er die Problematik der Liebe für wichtiger hält. Dies ist der einzige wesentliche Unterschied in der Handlungen der beiden Romane: Der eine kennt seinen hohen Stellenwert, der andere würde ihn, selbst wenn er von ihm erführe, leugnen.
Beim Schluss lassen sich dagegen wieder deutliche Parallelen erkennen. Die Helden erhalten die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten einem Publikum vorzuführen - oder, besser: sie auf ein Publikum auszuüben. Direkt magisch mutet der Effekt an, den Schneider und Süskind in einem Feuerwerk an Superlativen und Metaphern, einem wahrhaften Genus grande ausführlich schildern, das die Grenzen zwischen Realität und Fantasie, zwischen Vernunftmäßigem und Irrationalem vollends sprengt. Doch richtig ergreifend ist das traurige Ende, die qualvollen Selbstmorde (wieder ein gemeinsames Motiv!) beider Helden unmittelbar nach ihren größten Erfolgen, die, was das Ganze besonders tragisch macht, ja auch der Auslöser des Wunsches zu sterben sind: Grenouille weiß, dass er seine Bestimmung erfüllt hat; er könnte jetzt natürlich sein Parfüm verwenden, um die Weltherrschaft zu erlangen, aber das ist nicht sein Ziel. Elias hat sich bei der Bearbeitung der Todessehnsucht an der Orgel derart eingesetzt, dass er der Überzeugung ist, nun seiner musikalischen Botschaft entsprechend handeln zu müssen.
Kann es sein, dass sich viele Menschen selbst für besonders begabt - um nicht das müßige Wort "Genie" zu verwenden - halten, sei es auf dem Gebiet der Kunst, sei es in einem anderen Bereich, und sich von ihren Mitmenschen nicht ausreichend gewürdigt fühlen? Jedenfalls wäre dies eine mögliche Ursache, warum beide Werke einen so hohen Beliebtheitsgrad erlangt haben. Denn meiner Meinung nach kommt es bei einem psychologischen Roman immer darauf an, ob man sich mit der im Mittelpunkt stehenden Person identifizieren kann. Ist das nicht der Fall, so wird die Handlung schnell uninteressant. Findet man jedoch besonders viele übereinstimmende Persönlichkeitszüge, ist man gierig, weiterzulesen. Man will wissen: Wird dieser Mensch auch mit denselben Problemen konfrontiert wie ich, und wie geht er mit ihnen um? Was macht er richtig, was falsch? Wozu könnte mein Handeln führen, wenn ich so weitermache wie bisher? Was kann ich aus dem Erfolg oder dem Scheitern dieser Romanfigur lernen?
Beiden Werken ist auch die Sprachlosigkeit als Motiv gemeinsam. Grenouille ist verschwiegen und introvertiert, auch die anderen Menschen - wie es bei M. Baldini besonders deutlich gezeigt wird - sprechen ihre wahren Gedanken und Absichten nie aus, sondern sind falsch, berechnend und hinterlistig; in der Vorarlberger Bauernwelt wird Kommunikation überhaupt kleingeschrieben (bzw. gar nicht geschrieben, weil es sich ja mehrheitlich um Analphabeten handelt), nicht einmal gegenseitige Zuneigung wird bekundet, woran Elias bekanntermaßen schließlich zerbricht. Dieses Problem ist auch in der heutigen Welt präsent. Durch die zunehmende Verstädterung und das zwar nicht im deutschen Sprachraum, immerhin aber weltweit explosionsartig angestiegene Bevölkerungswachstum fühlt sich der Einzelne zunehmend als einer unter vielen und nicht als Individuum mit all seinen spezifischen Vorzügen und Neigungen wahrgenommen. Das versuchen Trenderscheinungen wie Talkshows, "Reality-Soaps" und das Veröffentlichen von Tagebüchern im Internet auszugleichen, doch durch die Masse an Angeboten und den daraus für die Produzenten resultierenden Druck, mit Sensationen aufzuwarten, fühlen sich die Zuseher bzw. Leser mit Oberflächlichem abgespeist und die Zur-Schau-Steller erst recht nicht ausreichend gewürdigt. Psychologische Romane wie "Schlafes Bruder" und "Das Parfüm" erlauben da einen wohltuend ausführlichen Blick auf das Seelenleben einer fiktiven Personen, die für einen bestimmten Menschentyp steht, aber auch auf die eigene Psyche und die des Autors.
Trotz ihres vermeintlich historischen Hintergrundes sind die Werke der Herren Schneider und Süskind also aktuell und gegenwartsbezogen. Es handelt sich um Literatur, die den Nerv der Zeit trifft und als solche auch in die Geschichte eingehen wird, sofern die Germanisten der zukünftigen Generationen nicht anderer Meinung sein werden (das kann man heute nicht vorhersehen).
Der humorvoll-ironische Stil des Patrick Süskind, für den Marcel Reich-Ranicki ihn als "endlich wieder ein(en) deutschen Erzähler, der erzählen kann" bezeichnet hat, ist vom sprachlichen Niveau her durchaus mit einem Grimmelshausen zu vergleichen, der immerhin als der bedeutendste Prosaschriftsteller im Barock gilt. Auch gegen den tragischen Pathos eines Robert Schneider hätte ich, wäre ich Philologe, nichts einzuwenden. Zwar sind ihm manchmal Schnitzer passiert und hat manch kolloquiale Redensart in seinen Romanerstling Eingang gefunden, doch nur zu gut erinnern wir uns an den jungen Goethe und seinen "Götz von Berlichingen"...!
Abschließend sei gesagt, dass sicherlich viele Menschen dem Beispiel Süskinds und Schneiders folgen werden - bzw. schon Folge geleistet haben - und versuchen werden, aktuelle psychologische Probleme, die vielen Menschen gemeinsam sind, in Romane zu verpacken. Auch wenn sie stilistisch vielleicht nicht ganz an die Vorbilder herankommen werden und die Literaturwissenschaft sie Plagiate nennen wird, die keines Blickes zu würdigen seien, so haben sie das Potenzial, viele Leser anzusprechen. Meiner Meinung nach sind solche "Nachahmer" nicht generell als wertlos abzutun. Im Gegenteil, gerade von einem psychologischen Roman wird sich jeder anders angesprochen fühlen, und man soll jedem Einzelnen die Möglichkeit einer individuellen Bewertung lassen. Schließlich hätte ein Kenner der aktuellen Literatur angesichts all ihrer Parallelen, die ich in diesem Aufsatz aufgewühlt habe, auch "Schlafes Bruder" als Plagiat von Süskinds vorher erschienenem Werk bezeichnen und Robert Schneider des "Ideenklaus" bezichtigen können. Bekanntlich ist das Manuskript zunächst auch von einer großen Zahl von Verlagen abgelehnt worden, bis sich schließlich der vor dem Konkurs stehende Leipziger Reclam-Verlag bereit erklärt hat, es in Buchform zu veröffentlichen. Der große Erfolg, sowohl beim allgemeinen Publikum als auch bei Kritikern und in intellektuellen Kreises, zeigt, dass eine Bewertung rein nach vermeintlich wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht immer zielführend ist.
(Bei obigem Text handelte es sich um meine allerletzte Deutschschularbeit, geschrieben am 17. Februar 2001 innerhalb von drei Schulstunden.)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über "Das Parfüm" und "Schlafes Bruder"?
Der Text ist ein Vergleich der Romane "Das Parfüm" von Patrick Süskind und "Schlafes Bruder" von Robert Schneider. Er analysiert die Gemeinsamkeiten, die zum Erfolg der beiden Bücher beigetragen haben, insbesondere im Hinblick auf ihre Einordnung als historische und psychologische Romane.
Welche Gattungen werden für "Das Parfüm" und "Schlafes Bruder" in Betracht gezogen?
Beide Romane werden primär als historische und psychologische Romane eingeordnet. "Das Parfüm" wird auch kurz als Kriminalroman und als "erotischer Roman" erwogen, während "Schlafes Bruder" als Liebesroman betrachtet wird.
Welches gemeinsame Motiv wird in beiden Romanen hervorgehoben?
Ein zentrales Motiv ist die Geniewerdung. Beide Romane handeln von Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die in bescheidenen Verhältnissen aufwachsen und deren Talente erst durch eine Art Initiation erkannt und entwickelt werden.
Wie unterscheiden sich die Entwicklung und das Ende der Protagonisten in den Romanen?
Grenouille in "Das Parfüm" erkennt seinen hohen Stellenwert und seine einzigartigen Fähigkeiten an, während Elias in "Schlafes Bruder" seinen möglichen Einfluss in der Musikwelt nicht erkennt, da er sich auf die Problematik der unerwiderten Liebe konzentriert. Beide Protagonisten sterben jedoch qualvoll durch Selbstmord unmittelbar nach ihren größten Erfolgen.
Welche Bedeutung hat das Motiv der Sprachlosigkeit in den Romanen?
Die Sprachlosigkeit wird als ein weiteres gemeinsames Motiv hervorgehoben. Grenouille ist verschwiegen, und die Kommunikation in beiden Romanen wird als eingeschränkt dargestellt, was zu Missverständnissen und Leid führt.
Welche Verbindung wird zwischen den Romanen und der modernen Welt hergestellt?
Der Text argumentiert, dass die Romane trotz ihres historischen Hintergrundes aktuell und gegenwartsbezogen sind, da sie psychologische Probleme ansprechen, die vielen Menschen gemeinsam sind, wie das Gefühl der Nicht-Würdigung und die Sprachlosigkeit in einer zunehmend anonymen Gesellschaft.
Wie wird der Stil der Autoren Süskind und Schneider bewertet?
Der humorvoll-ironische Stil von Patrick Süskind wird mit dem Stil von Grimmelshausen verglichen. Der tragische Pathos von Robert Schneider wird ebenfalls positiv hervorgehoben, obwohl kleinere stilistische Mängel eingeräumt werden.
Was ist die abschließende Bewertung des Textes?
Abschließend wird argumentiert, dass Nachahmer von Süskind und Schneider nicht generell als wertlos abzutun sind, da psychologische Romane individuelle Bewertungen zulassen und ein Kenner der aktuellen Literatur angesichts all ihrer Parallelen, die in diesem Aufsatz aufgewühlt habe, auch "Schlafes Bruder" als Plagiat von Süskinds vorher erschienenem Werk bezeichnen und Robert Schneider des "Ideenklaus" bezichtigen können.
- Citar trabajo
- Claus-Dieter Volko (Autor), 2001, Schneider, Robert - Schlafers Bruder - im Vergleich mit Süskind, Patrick - Das Parfum - Literatur, die den Nerv der Zeit trifft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104335