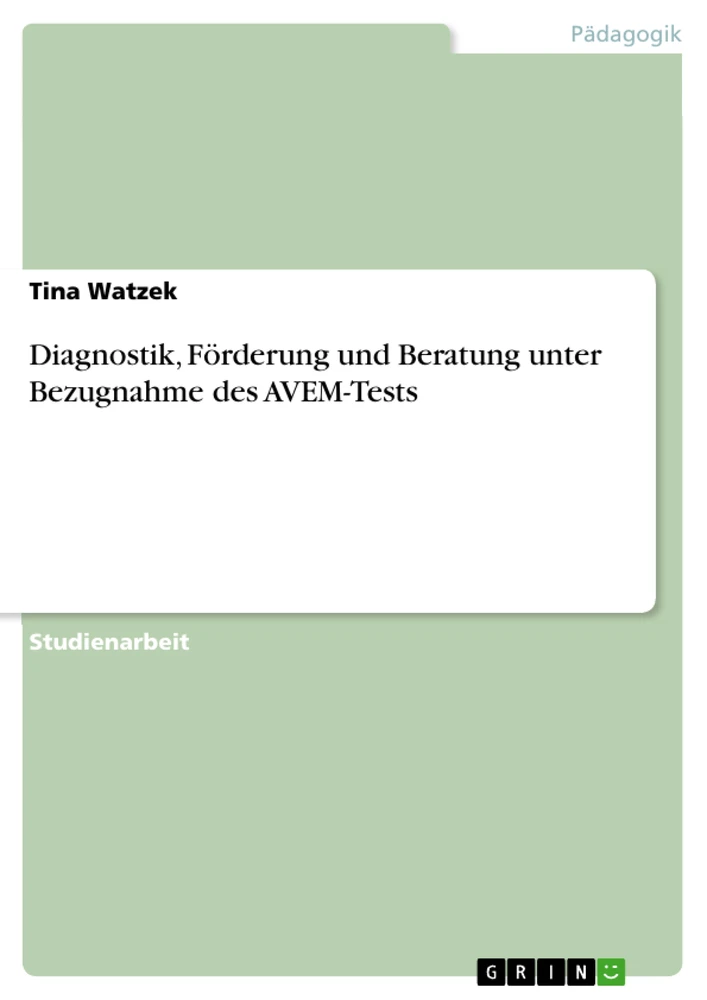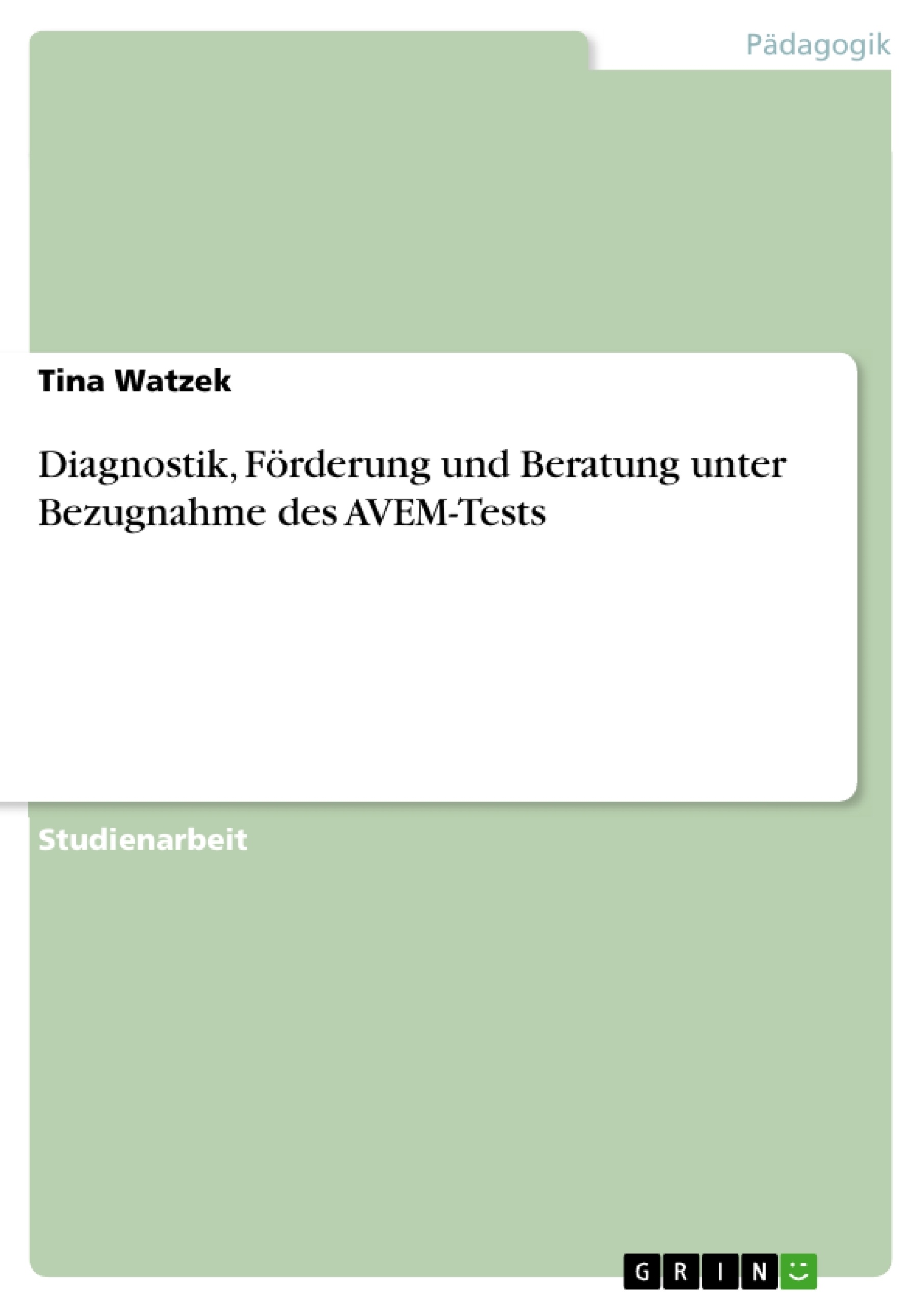Die vorliegende Arbeit ist eine Projektarbeit mit Interview eines Schulkindes.
Es wurde der Test Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM) von Uwe Schaarschmidt und Andreas W. Fischer durchgeführt. Dieser Test bezieht sich vor allem auf das Arbeits- und Berufsleben der untersuchten Personen und soll Fragen zur Personalentwicklung und zur Arbeitsgestaltung unter Gesundheitsbezug klären. Mit Hilfe des Testes können Aussagen über förderliche und gefährdende Verhaltensmuster hinsichtlich des Arbeitsalltages getroffen werden und somit entsprechende Maßnahmen zur Prävention oder Rehabilitation getroffen werden. Der Test besteht aus 66 Fragen, die sich auf 11 verschiedenen Dimensionen verteilen. Die Ergebnisse dieser Fragen unter Bezugnahme der erwähnten Dimensionen ergeben vier unterschiedliche Verhaltens- und Erlebensmuster: Muster G (Gesundheit), Muster S (Schonung), Risikomuster A (Selbstüberforderung) und Risikomuster B (Resignation).
Inhaltsverzeichnis
- Personenbeschreibung
- Ableitung diagnostischer Fragestellungen und Untersuchungshypothesen
- Hypothetische Wahl diagnostischer Mittel
- Untersuchungsbericht
- Untersuchungsmethode und Darstellung der Durchführung
- Darstellung der Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Förderung
- Reflexion
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Leitfaden des Erstgesprächs
- Protokoll des Erstgesprächs
- Beobachtungsprotokoll zur Testdurchführung
- Teststeckbrief AVEM
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schulleistungen von Lukas, einem 13-jährigen Schüler, unter besonderer Berücksichtigung seiner Motivation. Das Hauptziel ist die Analyse des Zusammenhangs zwischen Lukas' Motivation, seiner familiären Situation und seinen schulischen Leistungen. Die Arbeit basiert auf einem Interview mit Lukas und nutzt das AVEM-Testverfahren zur Diagnose.
- Analyse der Lernmotivation von Lukas
- Einfluss der familiären Situation auf die Schulleistung
- Zusammenhang zwischen Motivation und Schulleistung
- Identifizierung möglicher Fördermaßnahmen
- Reflexion der diagnostischen und fördernden Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Personenbeschreibung: Diese Kapitel beschreibt Lukas, einen 13-jährigen Schüler der 7. Klasse einer Realschule. Es wird sein Schulalltag, seine Noten, seine Interessen und seine familiäre Situation detailliert dargestellt. Lukas zeigt ein differenziertes Leistungsbild mit Stärken in einigen Fächern und Schwächen in anderen, insbesondere Mathematik. Seine Motivation erscheint uneinheitlich, wobei er in manchen Fächern gute Leistungen erbringt, in anderen jedoch weniger Engagement zeigt. Die Beschreibung legt den Fokus auf seine Persönlichkeit, seine Beziehungen zu Mitschülern und Lehrkräften und seine Einstellung zum Lernen. Sein familiäres Umfeld, geprägt von der Erkrankung des Vaters, wird als ein möglicher Einflussfaktor auf seine Motivation und seinen Umgang mit schulischen Anforderungen beschrieben. Seine Motivation scheint von der Art des Unterrichts und dem Lehrer abhängig zu sein, weniger von der Bedeutung des jeweiligen Faches.
Ableitung diagnostischer Fragestellungen und Untersuchungshypothesen: Dieses Kapitel leitet aus der Personenbeschreibung diagnostische Fragestellungen ab. Der Fokus liegt auf der Analyse der möglichen Zusammenhänge zwischen Lukas' unterdurchschnittlicher Motivation und seinen Schulleistungen. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass Lukas' verbesserungswürdige Leistungen auf einer unterdurchschnittlich ausgeprägten Motivationskompetenz beruhen könnten, die wiederum durch die geringe familiäre Resonanz auf seine schulischen Leistungen beeinflusst sein könnte. Die Kapitel verwendet etablierte Modelle der Schulleistungsforschung (Hesse & Latzko, Walberg et al.) um die Bedeutung der Lernmotivation für den Schulerfolg zu untermauern. Es betont jedoch auch, dass Motivation alleine nicht ausreicht, und die intellektuellen Fähigkeiten des Schülers berücksichtigt werden müssen.
Schlüsselwörter
Lernmotivation, Schulleistung, Familienresonanz, Diagnostik, Förderung, AVEM-Test, Motivationskompetenz, Schülerprofil, individuelle Förderung, handlungsorientierter Unterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Schulleistungen von Lukas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Schulleistungen des 13-jährigen Lukas, insbesondere im Hinblick auf seinen Zusammenhang zwischen seiner Motivation, seiner familiären Situation und seinen schulischen Leistungen. Es wird ein detailliertes Schülerprofil erstellt und mithilfe des AVEM-Tests diagnostiziert.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Analyse basiert auf einem Interview mit Lukas und dem AVEM-Testverfahren. Die Arbeit stützt sich auf etablierte Modelle der Schulleistungsforschung (Hesse & Latzko, Walberg et al.), um den Einfluss der Lernmotivation auf den Schulerfolg zu belegen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Personenbeschreibung, Ableitung diagnostischer Fragestellungen und Untersuchungshypothesen, Hypothetische Wahl diagnostischer Mittel, Untersuchungsbericht (inkl. Methode, Ergebnisse und Interpretation), Förderung, Reflexion, Literaturverzeichnis und Anhang (mit Leitfaden und Protokollen des Erstgesprächs, Beobachtungsprotokoll und Teststeckbrief AVEM).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Lernmotivation von Lukas, den Einfluss der familiären Situation auf seine Schulleistung, den Zusammenhang zwischen Motivation und Schulleistung sowie die Identifizierung und Reflexion möglicher Fördermaßnahmen. Ein besonderer Fokus liegt auf Lukas' unterdurchschnittlicher Motivation und deren möglichen Ursachen.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass Lukas' schwächere Leistungen auf einer unterdurchschnittlich ausgeprägten Motivationskompetenz beruhen könnten, die wiederum durch die familiäre Situation (Erkrankung des Vaters) beeinflusst sein könnte. Es wird jedoch betont, dass Motivation nicht der einzige Faktor für Schulleistung ist.
Was sind die Ergebnisse der Personenbeschreibung?
Lukas ist ein 13-jähriger Schüler der 7. Klasse mit einem differenzierten Leistungsbild: Stärken in einigen Fächern, Schwächen in anderen (insbesondere Mathematik). Seine Motivation ist uneinheitlich und scheint von der Art des Unterrichts und dem Lehrer abhängig zu sein, weniger von der Bedeutung des Faches. Die familiäre Situation (Vaterkrankheit) wird als möglicher Einflussfaktor genannt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lernmotivation, Schulleistung, Familienresonanz, Diagnostik, Förderung, AVEM-Test, Motivationskompetenz, Schülerprofil, individuelle Förderung, handlungsorientierter Unterricht.
Wo finde ich den Anhang?
Der Anhang enthält einen Leitfaden und Protokoll des Erstgesprächs mit Lukas, ein Beobachtungsprotokoll zur Testdurchführung und den Teststeckbrief des AVEM-Tests.
Welche konkreten Fördermaßnahmen werden vorgeschlagen?
Die Arbeit beschreibt im Kapitel "Förderung" konkrete Maßnahmen, die auf den Ergebnissen der Diagnostik basieren. Die konkreten Vorschläge werden hier jedoch nicht explizit aufgeführt und müssen im Volltext nachgelesen werden.
- Citar trabajo
- Tina Watzek (Autor), 2021, Diagnostik, Förderung und Beratung unter Bezugnahme des AVEM-Tests, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043505