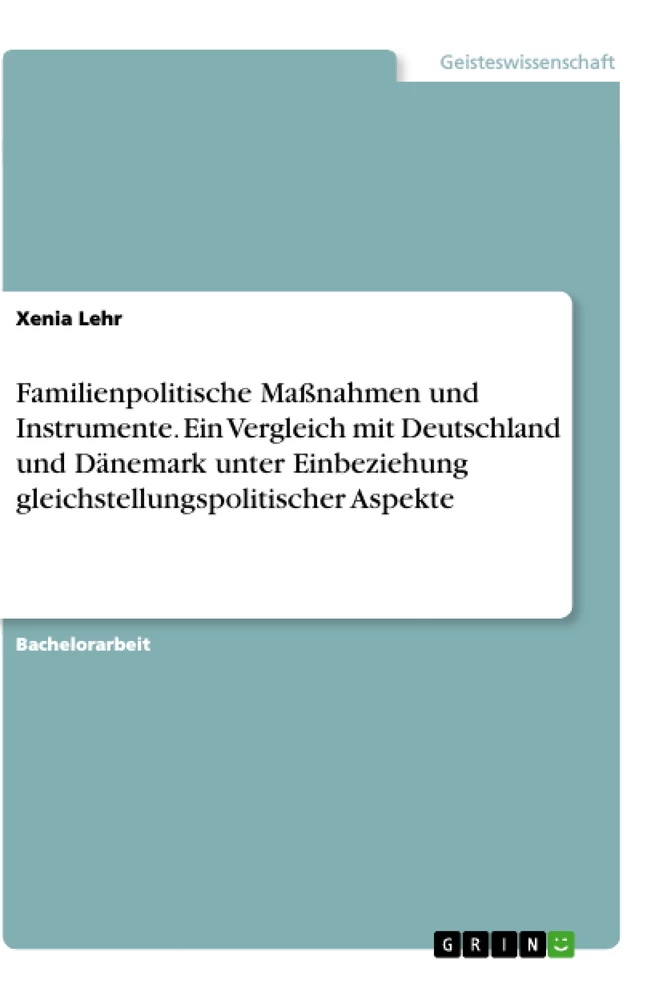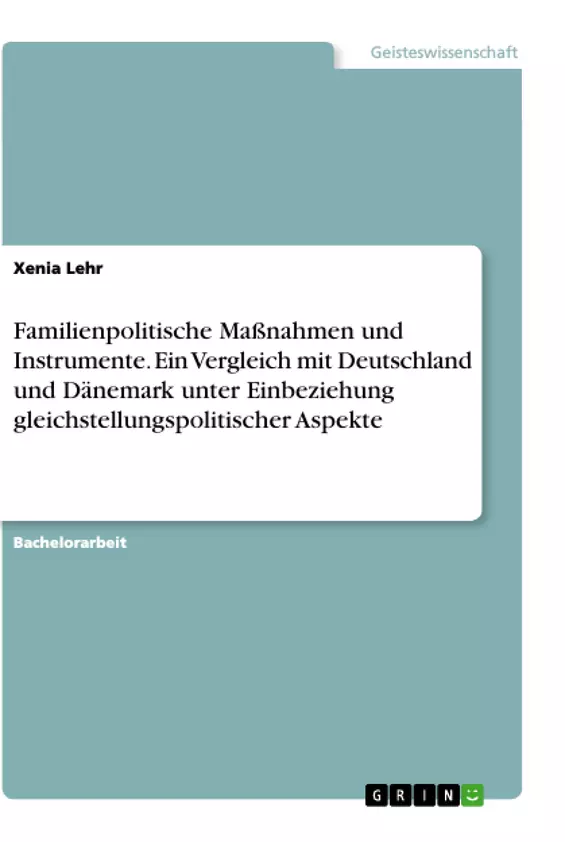Die Bachelorarbeit betrachtet die politischen und strategischen Rahmenbedingungen in Deutschland und Dänemark und versucht, einen Zusammenhang zur Geburtenrate in den jeweiligen Ländern herzustellen. Dabei liegt der Fokus auf dem Vergleich der monetären und infrastrukturellen Bedingungen in Bezug auf Familienpolitik.
Seit der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder im Oktober 1998 in einem Moment situativer Vergesslichkeit Familienpolitik als „Gedöns“ bezeichnete, ist diese mehr und mehr in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Die Neuregelungen zum Bundeselterngeldgesetz vom 1. Januar 2007 sind jedoch, zumindest was die inhaltliche Ausgestaltung angeht, nicht neu. Bereits 1985 wurden erste Vorschläge zu einem „Elternurlaub“ gemacht. Vorgesehen war eine zwölf Monate lange Freistellung mit einer Verlängerung um drei Monate, wenn Eltern sich die Aufgabe teilen. Die Vertreterinnen Christine Bergmann und die spätere Familienministerin Renate Schmidt setzten sich mit ihren Ideen nicht durch und erst 20 Jahre später zogen die Sozialdemokraten mit dem Elterngeld in den Wahlkampf.
Nach einer repräsentativen Umfrage zu Familienleben und Familienpolitik erwarten 63 Prozent der Bevölkerung eine Erleichterung von der Politik, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. 48 Prozent wünschen sich ein größeres Angebot an Ganztagskindergärten und Ganztagsschulen und 44 Prozent fordern ein größeres Angebot an Kinderkrippen. 64 Prozent der Befragten glauben, dass in Deutschland die Möglichkeit zur Vereinbarung von Familie und Beruf schlechter gelöst sei als in anderen Ländern. Gleichzeitig denken 84 Prozent der Frauen in Deutschland, dass der Beruf ein wichtiger Aspekt persönlicher Unabhängigkeit ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen zu Familienpolitik
- Begriffsbestimmung
- Wirkungsanalyse von Familienpolitik
- Regimeansatz und Leitbilder in den Wohlfahrtsstaaten Deutschland und Dänemark
- Historische Grundlagen zu Familienpolitik
- Deutschland
- Dänemark
- Familienpolitische Maßnahmen im Vergleich
- Organisation der Familienpolitik in Deutschland und Dänemark
- Ausgaben für Ehe und Familie im Vergleich
- Monetäre Leistungen
- Zeitpolitik
- Infrastrukturleistungen
- Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren
- Kinderbetreuung für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt
- Kinderbetreuung für Schulkinder
- Zusammenfassung
- Individuelle Lebenslagen in Deutschland und Dänemark
- Die Erwerbssituation von Frauen
- Die Kinderrate im Vergleich
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Familienpolitischen Maßnahmen und Instrumenten in Deutschland und Dänemark und analysiert diese im Kontext gleichstellungspolitischer Aspekte. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Familienpolitik in beiden Ländern aufzuzeigen und diese in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Lebenslagen von Familien und insbesondere Frauen zu bewerten.
- Vergleichende Analyse der Familienpolitik in Deutschland und Dänemark
- Bewertung der Auswirkungen der Familienpolitik auf die Lebenslagen von Familien
- Bedeutung gleichstellungspolitischer Aspekte im Kontext der Familienpolitik
- Analyse der Organisation und Finanzierung der Familienpolitik in beiden Ländern
- Untersuchung der verschiedenen Familienpolitischen Maßnahmen und Instrumente, wie z.B. monetäre Leistungen, Zeitpolitik und Infrastrukturleistungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und definiert den Begriff der Familienpolitik. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Familienpolitik und die Wirkungsanalyse von Familienpolitik erläutert. Dabei wird auch der Regimeansatz und die Leitbilder in den Wohlfahrtsstaaten Deutschland und Dänemark beleuchtet.
Im zweiten Kapitel werden die historischen Grundlagen der Familienpolitik in Deutschland und Dänemark dargestellt.
Das dritte Kapitel bietet einen Vergleich der Familienpolitischen Maßnahmen in beiden Ländern. Es werden die Organisation der Familienpolitik, die Ausgaben für Ehe und Familie, die monetären Leistungen, die Zeitpolitik und die Infrastrukturleistungen analysiert.
Im vierten Kapitel werden die individuellen Lebenslagen in Deutschland und Dänemark im Hinblick auf die Erwerbssituation von Frauen und die Kinderrate im Vergleich betrachtet.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, Deutschland, Dänemark, Gleichstellungspolitik, Familienleben, Kinderbetreuung, Erwerbstätigkeit, Familienleistungen, Wohlfahrtsstaat, Lebenslagen, Frauen, Kinder, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich die Familienpolitik in Deutschland und Dänemark?
Die Arbeit vergleicht monetäre Leistungen (wie Elterngeld) und Infrastrukturleistungen (Kinderbetreuung), um Unterschiede in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufzuzeigen.
Welchen Einfluss hat die Kinderbetreuung auf die Geburtenrate?
Es wird untersucht, ob ein besseres Angebot an Ganztagsbetreuung und Krippenplätzen, wie es in Dänemark existiert, zu einer höheren Geburtenrate führt.
Was ist das Bundeselterngeldgesetz von 2007?
Dieses Gesetz führte in Deutschland das Elterngeld ein, um Vätern und Müttern die Freistellung nach der Geburt zu erleichtern – ein Konzept, das teils schon 20 Jahre zuvor diskutiert wurde.
Wie wichtig ist Berufstätigkeit für Frauen in Deutschland?
Laut einer Umfrage in der Arbeit halten 84 Prozent der Frauen in Deutschland ihren Beruf für einen wichtigen Aspekt ihrer persönlichen Unabhängigkeit.
Was bedeutet der „Regimeansatz“ in der Wohlfahrtsforschung?
Dieser theoretische Ansatz hilft dabei, die unterschiedlichen Leitbilder und Strukturen der Sozialstaaten Deutschland (eher konservativ-korporatistisch) und Dänemark (eher sozialdemokratisch-universell) zu vergleichen.
Wer bezeichnete Familienpolitik als „Gedöns“?
Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder tätigte diese Äußerung im Jahr 1998, was die Familienpolitik damals stark in den Fokus der öffentlichen Kritik rückte.
- Quote paper
- Xenia Lehr (Author), 2009, Familienpolitische Maßnahmen und Instrumente. Ein Vergleich mit Deutschland und Dänemark unter Einbeziehung gleichstellungspolitischer Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043534