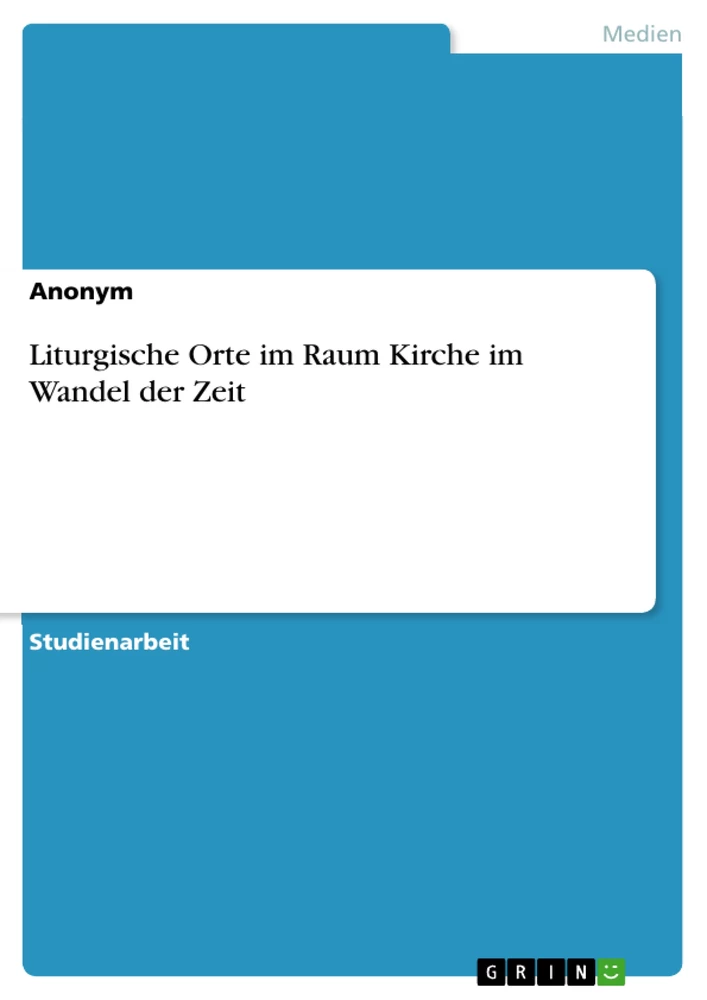Jede katholische Kirche auf der Welt sieht unterschiedlich aus, es existieren verschiedene Baustile aus den unterschiedlichsten Zeiten, jedes Land hat seine eigene Art Kirchen zu verzieren und zu erhalten, jede Kirche ist einer Heiligen oder einem Heiligen geweiht und erhält dadurch individuelle Züge und auch aufgrund der eigenen Geschichte des jeweiligen Gotteshauses erhält die Kirche einen besonderen Charakter. Jede einzelne Kirche ist demnach ein individuelles Bauwerk und nur einmal auf der ganzen Welt vorhanden.
Eines haben sie jedoch alle gemeinsam, nämlich die festgelegten liturgischen Gegenstände und die bestimmten liturgischen Bauteile einer Kirche. Diese Hausarbeit wird sich mit diesen liturgischen Orten im Raum Kirche insbesondere im Wandel der Zeit beschäftigen.
Zunächst einmal geht diese Arbeit auf die einzelnen großen Baustile der Geschichte ein: frühchristliche Kirchen, romanische Bauweise, gotische Kirchen, die Gotteshäuser der Renaissance, die barocken Kirchen und schließlich die modernen Gotteshäuser heutzutage. Kapitel zwei geht näher auf die einzelnen liturgischen Bestandteile im Raum Kirche ein und beschreibt sie im Wandel der Zeit. Hier sind Altar, Ambo, Tabernakel, Taufbrunnen/- stein und Empore zu nennen.
Diese Hausarbeit geht zudem kurz auf weitere Bestandteile ein. Daraufhin folgt ein zusammenfassendes Fazit, welches die Hausarbeit abrundet, Klarheit über die liturgischen Orte im Wandel der Zeit bringt und einen Ausblick auf die Zukunft der Kirche wagt.
Inhaltsverzeichnis
- Der Raum Kirche im Wandel der Zeit
- Frühchristlich
- Romanisch
- Gotisch
- Renaissance
- Barock
- Heute
- Bestandteile
- Altar
- Ambo
- Tabernakel
- Taufbrunnen/ -stein
- Empore
- Weitere Bestandteile
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den liturgischen Orten im Raum Kirche, insbesondere im Wandel der Zeit. Sie beleuchtet die Entwicklung des Kirchenraums von der frühchristlichen Zeit bis zur Gegenwart und analysiert die Bedeutung der verschiedenen liturgischen Bestandteile. Die Arbeit geht auf die Gestaltungskriterien von Kirchenräumen ein und beleuchtet die symbolische Bedeutung der liturgischen Orte.
- Die Entwicklung des Kirchenraums im Wandel der Zeit
- Die Bedeutung der liturgischen Orte im Raum Kirche
- Die symbolische Bedeutung der Gestaltung von Kirchenräumen
- Die liturgischen Dienste und ihre Bedeutung im Kirchenraum
- Die Gestaltungskriterien für Kirchenräume
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit behandelt die Entwicklung des Kirchenraums im Wandel der Zeit. Es untersucht die unterschiedlichen Baustile und Gestaltungsprinzipien der verschiedenen Epochen, von der frühchristlichen Zeit über das Mittelalter bis zur Gegenwart.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen liturgischen Bestandteile im Raum Kirche. Es erläutert die Bedeutung und die symbolische Bedeutung von Altar, Ambo, Tabernakel, Taufbrunnen/ -stein und Empore im Wandel der Zeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Hausarbeit sind liturgische Orte, Kirchenraum, Wandel der Zeit, Baustile, Gestaltung, Symbolismus, Liturgie, liturgische Bestandteile, Altar, Ambo, Tabernakel, Taufbrunnen, Empore, Gemeinde, Zeichencharakter, Anrufcharakter, Gebetsrichtung.
Häufig gestellte Fragen
Welche liturgischen Orte sind in einer katholischen Kirche zentral?
Zu den wichtigsten Bestandteilen gehören der Altar, der Ambo (Ort der Wortverkündigung), der Tabernakel, der Taufstein und die Empore.
Wie veränderte sich der Kirchenraum im Laufe der Epochen?
Der Kirchenbau entwickelte sich von schlichten frühchristlichen Räumen über die massive Romanik und die lichtdurchflutete Gotik bis hin zu den prunkvollen Barockkirchen und der funktionalen Moderne.
Welche symbolische Bedeutung hat der Altar?
Der Altar gilt als Zentrum der Eucharistiefeier und symbolisiert Christus selbst. Seine Gestaltung und Platzierung haben sich je nach liturgischer Ausrichtung über die Jahrhunderte gewandelt.
Was ist ein Ambo und welche Funktion hat er?
Der Ambo ist der Ort, von dem aus die biblischen Lesungen und das Evangelium verkündet werden. Er repräsentiert den „Tisch des Wortes“.
Warum sieht jede katholische Kirche individuell aus?
Dies liegt an den unterschiedlichen Baustilen der jeweiligen Zeit, regionalen Traditionen, der Widmung an bestimmte Heilige und der spezifischen Geschichte des jeweiligen Gotteshauses.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Liturgische Orte im Raum Kirche im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043558