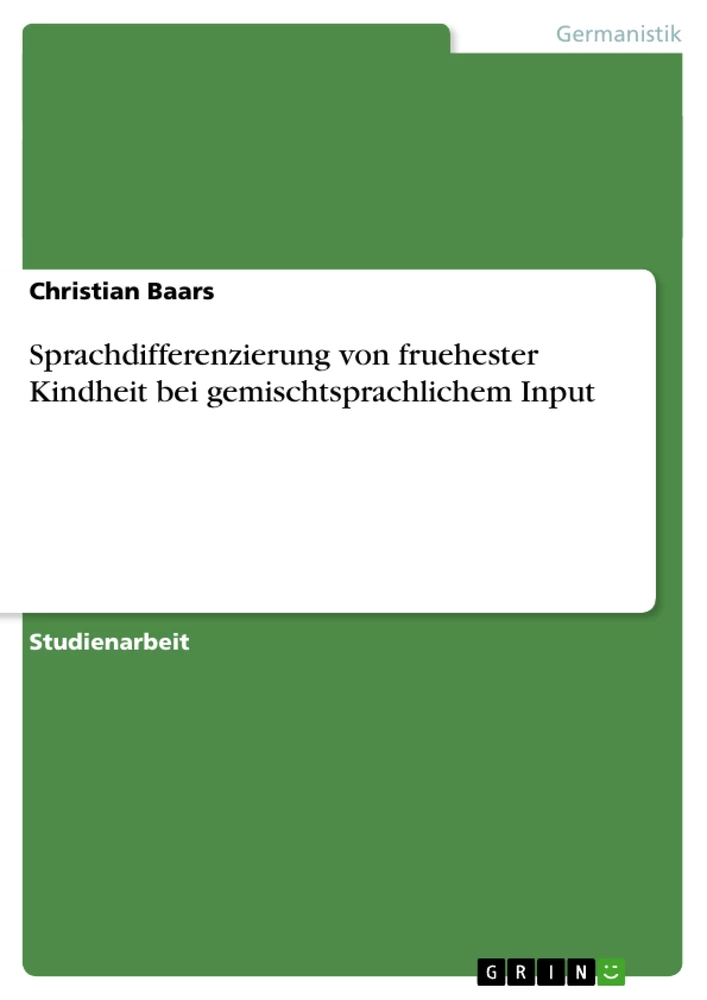Inhalt
1) Einleitung
2) Sprachdifferenzierung in frühester Kindheit? - Stand der Forschung
2.1) Die „one-system hypothesis“
2.2) Die „two-system hypothesis“
3) Die Studie von Smith (1936)
4) Burling (1971)
5) Tabouret-Keller (1963)
6) Bentahila & Davies (1994)
7) Genesee, Nicoladis & Paradis (1995)
8) Schlußfolgerung
9) Literaturverzeichnis
1) Einleitung
Eine Frage taucht in der Literatur zum bilingualen Erstspracherwerb immer wieder auf und scheint die zentrale Problematik der Forschung zu sein: Können bilinguale Kinder die beiden Sprachsysteme von Beginn an differenzieren?
Diese Diskussion ist stark kontrovers geführt worden. Es haben sich dabei zwei Hypothesen herausgebildet, zum einen die „one-system theory“ (Redlinger & Park, 1980) oder „unitary language system hypothesis“ (Genesee, 1989), zum anderen die „two-system hypothesis“ (Lanza, 1990) oder „separate development hypothesis“ (DeHouwer, 1990).
Als Hauptargument für die „one system hypothesis“ wird zumeist das Vermischen der beiden Sprachen bei bilingualen Kindern, vor allem auf lexikalischer Ebene, angeführt (beispielsweise Swain, 1972; Leopold, 1978, Volterra & Taeschner, 1978). Doch neuere Untersuchungen von Meisel (1989), Genesee (1989), Lanza (1990) oder de Houwer (1990) weisen diese Argumentation zurück und zeigen, daß bilinguale Kinder schon in einem sehr frühen linguistischen Entwicklungsstadium die Sprachsysteme differenzieren können, zumindest dann, wenn die Quellen des Inputs strikt voneinander getrennt sind, also ein Elternteil sich nur in jeweils einer Sprache an die Kinder wendet, die Eltern sich also an die Strategie „one person - one language“ (Romaine, 1995:183f.) halten.
Fast alle bislang veröffentlichten Studien beziehen sich auf Familien, in denen die bilinguale Erziehung so gehandhabt wird. Doch handelt es sich hierbei eher um einen atypischen Fall.
„The exceptional situation of the child is usually due to the fact that one or both of the parents use a language other than the dominant community language, generally because this is their native language, though sometimes a parent may deliberately choose to adopt a non-native language which is not the community language either (as in the case of Saunders, 1982)." (Bentahila & Davies, 1994:113)
Es gibt nur recht wenige Familien, in denen die Elternteile unterschiedliche Sprachen sprechen. Viel häufiger ist die Situation, daß sich die ganze Umgebung des Kindes inklusive der Eltern zweier Sprachen bedient und diese bunt durcheinander mischt. Romaine (1995) nennt diesen Fall als sechsten ihrer Typologisierung von Bilingualität, den Typ der „Mixed languages“.
„Parents are bilingual. Community: Sectors of community may also be bilingual. Strategy: Parents code-switch and mix languages.“ (Romaine, 1995:185)
Die Frage stellt sich, ob Kinder, bei denen die Eltern, und auch eventuell die Umgebung, die Sprachen vermischen, überhaupt zwei grammatikalische Kompetenzen aufbauen, und wenn ja, ob auch so früh wie Kinder, bei denen der Input der beiden Sprachsysteme aus separaten Quellen stammt.
In dieser Arbeit werde ich anhand der bisher vorliegenden (und mir bekannten) Studien und Beobachtungen, die sich mit Kinder beschäftigen, bei denen die Eltern und die Gesellschaft die Sprachen mischen, zeigen, daß dies tatsächlich der Fall ist. Die fünf Untersuchungen von Smith (1936), Tabouret-Keller (1963), Burling (1971), Bentahila & Davies (1994) und Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) habe ich hinsichtlich der Sprachendifferenzierung näher analysiert. Eine sechste Studie von Sonia Ellul (1978), die sich mit dem Erstspracherwerb bilingualer Kinder auf Malta befaßt, habe ich leider nicht rechtzeitig erhalten.
Zunächst werde ich jedoch die bisherige Diskussion um die frühe Differenzierung der beiden Systeme zusammenfassen, ehe ich mich der Analyse der genannten Studien widme.
Vorne weg schicke ich noch die notwendigen Begriffsdefinitionen. In Anlehnung an den Vorschlag von Meisel (1989b) verwende ich folgende Bezeichnungen für die Ursachen von Sprachmischungen:
Die Fusion ist auf der Ebene der grammatischen Kompetenz anzusiedeln und bedeutet, daß das bilinguale Kind nicht die grammatischen Systeme differenzieren kann. Das Code-Switching ist dahingegen ein Zeichen vorhandener grammatischer wie pragmatischer Kompetenz. Es bedeutet, daß das Kind je nach Gesprächspartner, Situation, Thema, etc. das Sprachsystem wählt. Code-Switching setzt folglich zwei bereits differenzierte Sprachsysteme voraus.
Das Code-Mixing bedingt ebenfalls das Vorhandensein zweier separater grammatischer Kompetenzen. Jedoch entspricht Code-Mixing keiner gezielten Sprachwahl, sondern bedeutet, daß Wörter aus der Sprache, die gerade nicht im Gebrauch ist, entliehen werden, weil der Sprecher sie in der zu dem Zeitpunkt verwandten Sprache nicht kennt oder sie nicht so oft benutzt. Dies stellt folglich einen Mangel an pragmatischer Kompetenz dar.
2) Sprachendifferenzierung von frühester Kindheit an?
Die Frage, ob es während des bilingualen Spracherwerbs immer eine Phase der Fusion geben muß, ist in den letzten Jahren zugunsten der Vertreter der „two-system hypothesis“ entschieden worden. Inzwischen scheint es unstrittig, daß es kein Stadium geben muß, in der die Kinder die beiden Sprachsysteme nicht differenzieren können.
2.1) Die „one-system hypothesis“
Die Vertreter der „one-system hypothesis“ haben Sprachmischungen in den frühen Phasen des bilingualen Erstspracherwerbs als Fusion, also als Evidenz für ein einziges vorhandenes Sprachsystem interpretiert.
„Words from the two languages did not belong to two different speach systems but to one.“ (Leopold, 1978:27)
Auch Swain (1977) fand ein „common storage modell“, in dem beide Sprachsysteme beim bilingualen Kind zusammengefaßt sind.
Die beiden bekanntesten Arbeiten, die die Hypothese des einzelnen Sprachsystems stützen sind die von Volterra & Taeschner (1978) und Redlinger & Park (1980).
Redlinger und Park haben ihre Arbeit ganz der Fragen gewidmet, ob beim bilingualen Spracherwerb das Kind zunächst nur ein oder doch zwei Systeme aufbaut. Das Ziel der Studie war eine systematische Analyse der Beziehung zwischen Sprachmischungen und der linguistischen Entwicklung. Die hohe Mischrate in der frühen Phase der Entwicklung wurde als Evidenz für keine vorhandene Differenzierung gesehen.
„These findings suggest that the subjects were involved in a gradual process of language differentiation and are in agreement with those of previous investigators supporting the one system approach to bilingual acquisition.“ (Redlinger & Park, 1980:344)
Volterra und Taeschner (1978) entwickelten ein Drei-Phasen Modell für den Spracherwerb eines bilingualen Kindes:
(I) das Kind verfügt nur über ein lexikalisches System, das Wörter aus beiden Sprachen enthält,
(II) Entwicklung zweier getrennter lexikalischer Systeme, jedoch besteht noch ein einzelnes syntaktisches System,
(III) grammatikalische Differenzierung der beiden linguistischen Systeme.
2.2) Die „two-system hypothesis“
Die Hauptkritik gegen die Vertreter der „one-system hypothesis“ richtet sich gegen die - auch von Volterra und Taeschner vorgebrachte - Argumentation, daß die Vermischung der beiden Sprachen ein Beleg für ein nicht getrenntes Sprachsystem ist.
„Mixing may decline with development, not because of separation of the languages is taking place but rather because the children are acquiring more complete linguistic repertoires and, therefore, do not need to borrow from or overextend between languages.“ (Genesee, 1989:166)
Mixing könnte nach Genesee auch beispielsweise eine Form der Übergeneralisiserung sein, vergleichbar der von monolingualen Kindern, nur daß bilinguale Kinder sowohl intra- wie interlingual übergeneralisieren. Solange sie nicht den spezifischen Ausdruck für etwas kennen, nutzen sie die Wörter, die sie schon gelernt haben, auch wenn sie aus der anderen Sprache stammen.
„Bilingual children may overextend longer than monolingual children because they hear more instances of particular nominals being used in specific contexts.“ (Genesee, 1989:168)
Genesee kommt zu dem Schluß, daß das Vermischen der Sprachen auf den Input durch die Eltern zurückzuführen sei und deshalb dieser stärker beachtet werden müsse.
Lanza (1990) hat genau dies getan und zwei bilingual norwegisch-englische Kinder (Siri und Thomas) untersucht, bei denen in einer Familie (Siri) die Eltern strikt die Sprachen getrennt haben und in der anderen (Tomas) Vater und Mutter zwar hauptsächlich in ihrer Muttersprache zu dem Kind gesprochen, jedoch auch teilweise gemischt haben. Dies führte ihrer Ansicht nach dazu, daß Tomas im Vergleich häufiger die Sprachen mischte. Doch sei dieses sprachliche Verhalten in den Gesprächen mit den Eltern auch aus seiner Sicht korrekt, da sie ja auch beide Sprachen verwenden. Lanza zeigt, daß sowohl Siri als auch Tomas die Sprachsysteme differenzieren können.
„The major finding of this study is that, contrary to the claims made by the proponents of the one-system hypothesis, bilingual children as young as two years of age can and do use their languages in contextually sensitive ways. [...] Bilingual awareness was demonstrated by the children in this study as the separation of languages when appropriate and the mixing of languages when the context deemed it appropriate. Hence language mixing per se is not be taken as a sign of a lack of bilingual awareness.“ (Lanza, 1990:435)
Auch die von De Houwer (1994) untersuchte, mit Holländisch und Englisch aufwachsende („one person - one language“) Kate bewies diese pragmatische Kompetenz. Zudem zeigt die morphosyntaktische Analyse ihrer Äußerungen, daß sie bereits zu Beginn der Studie (Alter von 2;7) über zwei separate Sprachsysteme verfügte. Diese Ergebnisse führten De Houwer zur „Separate Development Hypothesis“, die behauptet, daß 'the morphosyntactic development of a pre-school child regularly exposed to two languages from birth which are presented in a separated manner proceeds in a separate fashion for both languages' (De Houwer, 1990: 339)
Meisel (1989a) hat ebenfalls Kinder untersucht, deren sprachlicher Input strikt getrennt war. Um zu zeigen, daß die Kinder von Beginn an zwei separate Sprachsysteme aufbauen, suchte er nach syntaktischen Strukturen, die widerlegen, daß das Kind nur über ein nicht differenziertes System verfügen.
„If it could be shown that they use structures in which the two target systems (including the respective child language) differ, then this obviously also constitutes evidence against the alternative one-system hypothesis.“(Meisel 1989:19f.)
Die Frage, ab welcher Phase der linguistischen Entwicklung man davon ausgehen kann, daß das Kind grammatikalische Strukturen verwendet, kann dabei unberücksichtigt bleiben. Denn da Volterra und Taeschner wie auch Redlinger und Park von syntaktischen Kategorien, Regeln und grammatischen Systemen sprechen, interpretiert er deren Erkenntnisse dahingehend, daß das Kind sobald es grammatikalische Regeln anwendet, automatisch eine Syntax entwickelt, die sie auf beide Sprachen anwendet. (S. 21)
Daraus folgert er, daß man so bei bilingualen Kindern, lediglich nach einer Evidenz für den Gebrauch syntaktischer Kategorien und Regeln suchen und dann diesen Weg zurückverfolgen müsse.
„If one can show that a bilingual child uses different grammatical means for expressing the same or similar semantic-pragmatic functions in both languages, this not only indicates that s/he is indeed differentiating the two grammatical systems, but also constitutes what I believe to be the clearest evidence that one can and, indeed, must attribute to the child - the ability to use the grammatical mode.“ (Meisel 1989:21)
In seiner Studie zum Spracherwerb von bilingual französisch-deutschen Kindern hat er solche Unterschiede im Bereich der Wortstellung und der Subjekt-Verb-Kongruenz gefunden und damit hinreichend belegt, daß ein Individuum, das sich von einer sehr frühen Phase der Entwicklung an mit zwei linguistischen Systemen auseinandersetzen muß, diese sehr wohl differenzieren kann, ohne eine Phase der Fusion zu durchlaufen. Zudem fand er diese Belege in einer sehr frühen Phase der Entwicklung, nämlich sobald das Kind Äußerungen produziert, die mehr als ein Wort beinhalten.
Ergänzend haben auch Koehn und Müller (1990) Belege in sich in den Zielsprachen unterscheidenden syntaktischen Bereichen bei bilingual französich-deutschen Kinder gefunden. Sie haben den Wortstellungs-, Genus- und Numeruserwerb näher untersucht. Sie halten im Ergebnis jedoch fest, daß diese Erkenntnisse nicht unbedingt generalisierbar seien. Es seien Kinder untersucht worden, die aufgrund der von den Eltern verfolgten Strategie „one person - one language“ balanciert bilingual gewesen seien und so über „optimale Voraussetzungen für den bilingualen Spracherwerb“ (S.57) verfügt hätten.
Interessant ist also die Frage, ob auch Kinder, bei denen der Input der Sprachen absolut nicht getrennt ist, sondern von den Eltern durchgängig gemischt werden und die auch eventuell nicht balanciert bilingual sind, ebenfalls Belege für eine frühe Differenzierung gefunden werden können.
M. E. Smith (1936)
Eine der ersten Beobachtungen des bilingualen Erstspracherwerbs sind die Aufzeichnungen in Tagebuchform der Amerikanerin F.M. Smith, die den Spracherwerb ihrer acht Kinder festhielt. Madorah E. Smith hat dies ausgewertet und veröffentlicht.
Alle acht wurden in China geboren und lebten auch dort, mit Ausnahme eines einjährigen Aufenthaltes in Amerika, bis das jüngste von ihnen knapp 20 Monate alt war. Die Aufzeichnungen erstrecken sich von der Geburt des ältesten Kindes bis zur Rückkehr der Familie nach Amerika. Doch sind sie äußerst lückenhaft bis zum dritten Geburtstag des ältesten Kindes und nach dem Umzug nach Amerika.
Bei den drei älteren Kindern sprachen die Eltern fast ausschließlich Englisch mit ihren Kindern. Die Umgebungssprache war jedoch Chinesisch. Diese Kinder fallen demnach unter den Typ 3 nach Romaines (1995:184) Defintion: „Non-dominant home language without community support“.
Bei den fünf jüngeren Kindern benutzten sowohl die Mutter als auch der Vater vermehrt Chinesisch. Smith sieht hierin den Grund für eine schlechtere Sprachdifferenzierung der jüngeren Kinder. Sie betrachtet also Mischung als Fusion.
„while for the latter there was no pure source of English as their parents used either language in speaking to them and there were always one or two children a little older who were still somewhat confused in their use of the two languages. This difference might as well lead to increasing the infant’s difficulty in learning to distinguish English and Chinese.“ (Smith, 1936:20)
Darüber hinaus würden die älteren Kinder die jüngeren in fast allen Kriterien, die Smith zur Messung der Sprachentwicklung ansetzt, übertreffen.
„They use longer sentences, make fewer errors, make greater use of inflections, and use fewer mixed sentences except at three-and-a-half years where very few are used.“ (Smith, 1936:21)
Sie stellt jedoch heraus, daß dieses „handicap of bilingualism“ sich erst etwa ab dem Alter von 18 Monaten bemerkbar macht. In der früheren Phase der Sprachentwicklung, in der sie die ersten Wörter erlernen hätten, wären sie sogar den älteren voraus gewesen.
Leider werden die angelegten Kriterien in dieser Arbeit nicht näher definiert und auch keine beispielhaften Äußerungen genannt, so daß eine kritische Beurteilung der Schlußfolgerungen von Smith nicht möglich ist.
Zudem sind die Basisdaten nicht nur sehr lückenhaft, sondern auch sehr subjektiv festgehalten.
„As there was no consistency in recording sentences other than the interest aroused by the child’s remarks and the mother’s opportunity and leisure to do so, the assumption is that the samples are of the child’s best attempts and the data are not therefore comparabel to other studies where the records have been made more systematically.“ (Smith, 1936:19)
Zudem hat die Mutter es vorgezogen, ihre Aufzeichnungen in Englisch zu verfassen, so daß eventuell chinesische Äußerungen, nicht als solche festgehalten wurden.
Eine Generalisierung der Ergebnisse dieser Beobachtungen kann aufgrund der wissenschaftlichen Ungenauigkeiten also nicht vorgenommen werden. Interessant ist aber auf jeden Fall der Vergleich zwischen den Kinder, die innerhalb einer Familie, jedoch unter sehr unterschiedlichen sprachlichen Konditionen, aufgewachsen sind.
Es bleibt festzuhalten, daß Smith, zu dem Ergebnis kommt, daß die jüngeren Kinder, die dem Typ 6 der vermischten Sprachen zuzuordnen sind, höhere Mischraten aufweisen als die älteren, bei denen die Sprachen in der Umgebung noch strikt getrennt waren. Doch wie weiter oben erläutert ist diese Beobachtung allein kein Beleg für das Vorhandensein nur eines Systems. Diese Untersuchung kann also weder als Beleg für noch gegen eine frühe Sprachdifferenzierung herhalten.
Burling (1971)
Robbins Burling hat die Sprachentwicklung seines Sohnes Stephen analysiert. Im Alter von 1;4 von Stephen ist Burling mit seiner Familie von Amerika in eine Region Indiens, in der Garo gesprochen wird, umgezogen. Die ersten Spracheindrücke Stephens waren also monolingual englisch. Burling selbst mischte vom Zeitpunkt des Wohnortwechsels an Garo und Englisch auch im Gespräch mit seinem Sohn. Zudem kam Stephen in Kontakt mit zahlreichen Sprechern von Garo.
Im Alter von 1;9 mußte seine Mutter, die als einzige noch ausschließlich Englisch mit ihm sprach, für zwei Monate ins Krankenhaus. In dieser für die Sprachentwicklung wichtigen Zeit erfuhr Stephen also hauptsächlich einen gemischten Input. Insofern ist diese Studie mit Einschränkungen ebenfalls dem Typ 6 von Romaine (1995) zuzuordnen.
Burling hat phonologische, morphologische, lexikalische wie auch syntaktische Aspekte der linguistischen Entwicklung seines Sohnes untersucht und kam dabei zu dem Ergebnis, daß Stephen zunächst nur über ein linguistisches System verfügte und dies nach und nach differenzierte. Auch er setzte die sprachlichen Mischungen einer Fusion gleich.
„Later, when he did have two linguistic systems, the two never appeared to interfere with each other. He spoke one language or the other, never a mixture of the two.“ (Burling, 1971:184)
Doch liefert er bei seiner Argumentation für ein einzelnes System zu Beginn des Spracherwerbs zahlreiche Argumente, die ungewollt darauf hindeuten, daß Stephen sehr wohl die Sprachen differenzierte.
Hinsichtlich der Phonologie stellt Burling fest, daß Stephen erst mit fast drei Jahren über getrennte Systeme verfügte.
„By 2;8 and 2;9 I felt that Garo and English were becoming differentiated as phonemic systems.“ (Burling, 1971:176)
Doch auf der anderen Seite stellt er schon klare Unterschiede bei Phonemen im Alter von 2;1 fest.
„/æ/ had become distinct from /e/ and was used in English words only, even though these generally incorporated into Garo sentences.“ (Burling, 1971:175)
Andere Vokale tauchen seinen Beobachtungen zufolge in beiden Sprachen auf. Dies kann aber auch daran liegen, daß sich die Vokalsysteme dort nicht unterscheiden und die Vokale in beiden Zielsprachen auftauchen. Offensichtlich gibt es phonologische Bereiche, in denen sich die beiden Systeme unterscheiden und im Widerspruch zu Burlings Schlußfolgerung scheint Stephen, diese bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt (sieben Monate nach seinem ersten Sprachkontakt mit Garo) differenzieren zu können.
Auf morphosyntaktischer Ebene waren schon seine ersten Äußerungen, die aus mehr als einem Morphem bestanden, differenziert. Im Alter von 1;11 stellte Burling erstmals eindeutig solche einfachen Sätze fest.
„The construction in Garo is much like that in English, but his first sentences were clearly Garo. For one thing, they almost at once included a Garo principal suffix on the verb, so the sentences included three morphemes.“
Seine schon etwas eher produzierten Äußerungen, die aus zwei Morphemen bestanden, waren Konstruktionen aus Verben mit Suffixen. Beide Elemente waren ebenfalls eindeutig Garo.
Auch auf pragmatisch-semantischer Ebene scheint Stephen von Beginn an zu differenzieren. Teilweise nutzte er zwar Lexeme aus einer Sprache in beiden. Dies kann jedoch mit einer Übergeneralisierung begründet werden.
„In other cases, however, he simultaenously learned English and Garo words with approximately the same meanings, as though once his understanding reached the point of being able to grasp a concept he was able to use the appropriate words in both languages.“ (Burling, 1971:180)
Burling liefert in seiner Untersuchungen zum bilingualen Erstspracherwerb unfreiwillig - im Widerspruch zu seiner Schlußfolgerung - zahlreiche Belege (weitere ließen sich nennen) für eine frühe Differenzierung der beiden Sprachsysteme, auch wenn die Quellen des Inputs nicht strikt getrennt sind. Zwar liegt hier kein typischer Fall der „mixed languages“ vor, jedoch mischt zumindest der Vater, der über einen gewissen Zeitraum quasi alleinerziehend war, beide Sprachen.
Tabouret-Keller (1963)
Tabouret-Keller hat 1963 eine Studie veröffentlicht über den Spracherwerb eines französisch- deutsch bilingualen Kindes, Ève. Ihre Eltern sind ebenfalls beide bilingual und sprechen mit ihrer Tochter beide Sprachen, dabei mehr Französich (etwa 2/3) als Deutsch. Der Vater ist zweisprachig aufgewachsen, die Mutter kommt aus Deutschland, hat Französisch im 2. Bildungsweg gelernt und als zweisprachige Stenotypistin gearbeitet. Der Vater kümmert sich in etwa dem gleichen Ausmaß um die Kinder wie die Mutter, wobei er ein wenig mehr französisch spricht als sie. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich über das Alter von 1;8 bis 2;11.
Tabouret-Keller hebt zunächst einmal hervor, daß sich die ungleiche Gewichtung von französisch zu deutsch stark auf den Spracherwerb des Kindes auswirkt, vor allem im Alter zwischen 1;8 und 2;1. Hatte Ève zuvor noch etwa gleich viele Wörter auf Deutsch wie Französisch gelernt, so ist in diesen drei Monaten ein sprunghafter Anstieg des französischen Vokabulars zu verzeichnen, während kaum deutsche Wörter hinzukommen. Bei 2;4 benutzt Ève etwa dreimal so viele französische wie deutsche Wörter.
„L’apprentissage s’écarte donc de cette fréquence ce qui pourrait vraisemblablement s’expliquer par le renforcement plus grand dont bénéfice le vocabulaire français.“ (Tabouret-Keller, 1963:209)
Also kann hier wirklich nicht von „optimalen Voraussetzungen“1 gesprochen werden. Ève hat keine strikt getrennten Quellen des Inputs und ist nicht balanciert bilingual. Auch Meisel (1989a) stellt heraus, daß Kinder, bei denen eine Sprache sehr dominant ist, unter Umständen nicht so früh die Sprachsysteme differenzieren.
Tabouret-Keller beobachtet, daß das bilinguale Kind im selben Rhythmus wie ein monolinguales die Sprachen lerne. Die Anzahl der Wörter, der Satzbau sowie die Länge der Sätze sind in etwa identisch, wobei der Wortschatz stark vom Verhältnis der beiden linguistischen Systeme in der familiären Umgebung abhänge. Er stellt jedoch zwei kritische Phasen im Spracherwerbsprozeß fest, die er als Anzeichen für ein einzelnes linguistisches System interpretiert.
„Du point de vue expérimental, on peut dire que l’enfant se trouve en présence d’un système unique où tous les termes sont doubles. Par hypothèse, on peut avancer également que les différenciations que l’enfant opérera à l’intériereur de ce système double varieront en fonction de la fréquence d’usage du milieu.“ (Tabouret-Keller, 1963:207)
Auffällig ist vor allem eine kurze Phase im Alter von 2;7, in der Ève zahlreiche Doubletten bildet. Sie verbindet deutsche Lexeme mit ihrem französischem Synonym, wie z.B. /dal- gagig/ (sale-dreckig), /bet-li/ (Bett-lit), /do-ici/ (da-ici), /byd-Kase/ (kaputt-cassé) (vgl. S. 210). Aus meiner Sicht kann dies nicht als Fusion, sondern eventuell als eine Art Übersetzung interpretiert werden, was daraufhin deuten würde, daß das Kind über zwei lexikalische Systeme verfügt und sich dieser auch bewußt ist.
Die zweite kritische Phase in Èves sprachlicher Entwicklung sieht Tabouret-Keller ab dem Alter von 2;6, die bis zum Ende der Studie (3;0) anhält. Ève verwendet in dieser Zeit vermehrt gemischte Sätze (56% aller Äußerungen) mit Wörter aus beiden Systemen. Diese lexikalische Mischung deutet Tabouret-Keller als Fusion. Die Verteilung von französischen und deutschen Lexemen sei mehr oder minder zufällig. Dies belegt er mit umfassenden stochastischen Berechnungen.
Jedoch liefert er unfreiwillig Belege, daß das Kind schon in einer frühen Phase, die Sprachen auf syntaktischer Ebene differenzieren kann. Als ein Beispiel für die Verwendung deutscher Wörter in gemischtsprachlichen Äußerungen nennt er /vel/ (will) und begründet, daß Ève in diesem Fall das deutsche Lexem statt des französischen „veux“ verwendet, mit ökonomischen Gründen. Es sei einfacher den letzten Konsonanten /l/ in ein /d/ umzuwandeln als beim französischen „veux“, „je“ oder „tu“ voranzustellen.
„De plus, il suffit d’ajouter « s » /vel’s/ pour obtenir le difficile « je le veux » ou « je la veux » qui n’est pas distinct en dialecte parlé.“ (Tabouret-Keller, 1963:213)
Diese Äußerungen zeigen aber deutlich, daß das Kind nach syntaktischen Regeln - Flektion, Wortstellung (in diesem Fall VO im Deutschen im Gegensatz zu SOV im Französischen) - vorgeht und diese auch unterscheiden kann.
Es geht jedoch nicht aus seiner Studie hervor, ab wann Ève solche Konstruktionen verwendet. Fest steht nur, daß sie sie im Alter 2;7 schon länger benutzt, also genau in der Phase, in der Tabouret-Keller die verstärkte Mischung festgestellt hat.
Dieses Vermischen entspricht jedoch ihrer natürlichen Umgebungssprache und ist somit die angebrachte Sprachwahl und kann nicht als linguistische Unreife gesehen werden. Ève hat wahrscheinlich einfach keinen Anlaß gesehen, warum sie die Sprachen nicht mischen sollte. Dies ist keineswegs ein Zeichen für Fusion oder fehlende pragmatische Kompetenz.
Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß Ève die beiden grammatikalischen Systeme auf jeden Fall ab dem Alter von 2;7, wahrscheinlich jedoch schon eher, differenzierte.
Bentahila & Davies (1994)
In ihrer Studie zum Erstspracherwerb bei bilingualen Kinder haben Abdelâli Bentahila und Eirlys Davies Studien in Marokko durchgeführt. Im Gegensatz zu den meisten anderen bisherigen Untersuchungen haben die Eltern hier keine verschiedene Nationalitäten und sind auch nicht migriert, so daß sie keine exzeptionelle Stellung in der Gesellschaft einnehmen.
In Marokko ist die Muttersprache der meisten Menschen Arabisch. Trotzdem können fast alle Kinder ab dem Alter von etwa vier bis fünf Jahren fließend französisch sprechen, obwohl sie recht wenig Kontakt zu französischen Muttersprachlern hatten.
Dies liegt daran, daß Marokko von 1912 bis 1956 unter französischem Protektorat stand.
Während dieser Zeit wurde Französisch die Sprache der Verwaltung und der Schule und auch nach der Unabhängigkeit behielt die französische Sprache ihre wichtige Rolle in der marokkanischen Gesellschaft bei. So erlangten fast alle, die mehr als das Minimum an schulischer Bildung genießen konnten, eine relativ hohe französische sprachliche Kompetenz.
In der vorliegenden Studie haben die beiden Autoren vier marokkanische Kinder im Alter zwischen vier Jahren, fünf Monaten und fünf Jahren beobachtet, stellen jedoch nur zwei Kinder in ihrer Zusammenfassung näher vor. Während der Audio-Aufzeichnungen wechselte der Gesprächspartner zwischen den beiden Sprachen. Insgesamt wurden nur etwa 1 ½Stunden Material für jedes Kind gesammelt, aufgenommen über einen Zeitraum von mehreren Wochen.
Die Voraussetzung zum Erlangen eines recht hohen Grades an Bilingualität sind bei allen beobachteten Kinder gleich gut. Die Eltern aller vier Kinder gehören dem Mittelstand an, sind gut ausgebildet und gehen alle einem Beruf nach, in dem sie viel Französisch benutzen müssen. Französisch wird genauso wie Arabisch bei allen vier Familien zu Hause benutzt. Zudem sprechen alle Kinder auch Französisch in der Schule.
Trotzdem gibt es große Unterschiede bei ihnen in ihrer französischen Sprachkompetenz.
Während ein Kind dem Anschein nach Französisch gut versteht, jedoch kaum spricht, ein anderes zwar keine Schwierigkeiten hat, eine Konversation fast ausschließlich auf Französisch zu führen, dabei jedoch noch häufig zögert und bei Schwierigkeiten auf das Arabische zurückgreift, sprechen die beiden anderen spontan und fließend französisch. Dennoch ist auch bei ihnen arabisch dominant.
Das Sprachverhalten dieser beiden letztgenannten Kinder namens Miriam und Amine haben Bentahila und Davies näher analysiert. Sie deuten die gmischtsprachlichen Äußerungen der Kinder als Code-Switching und stellen damit heraus, daß sie die Sprachsysteme differenzieren können und über pragmatische Kompetenzen verfügen.
„Both children seem quite aware of the distinction between the two languages, and are able to respond in a particular language when asked to.“ (Bentahila & Davies, 1994:119)
Auffällig ist zunächst einmal, daß sie im Vergleich zu bilingualen Kinder, die nach der Strategie „one person - one language“ erzogen werden, viel zwischen den beiden System hin und her wechseln. Amine produzierte in den 1 ½Stunden 61 code-switches, Miriam sogar 71. Leider ist die Gesamtzahl der Äußerungen nirgendwo vermerkt, so daß ein Vergleich zu den Quoten von Burling und Tabouret-Keller nicht möglich ist.
Hervorzuheben ist ebenfalls, daß die meisten Wechsel innerhalb einer Äußerung stattfinden und meist komplexere Satzstrukturen aus der einen in die andere Sprache übernommen werden. Bei Miriam sind 87,3% aller Code-Switches „Intra-turn switches“, von denen wiederum 82,3% mehrere Wörter umfassen (71,8% sind „Intra-turn, multi-word switches) . Bei Amine sind 70,5% „Intra-turn switches“, 69,8% davon bestehen aus mehr als einem Wort (49,1% intra-turn, multi-word switches).
Andere Studien mit Kindern in einem vergleichbaren Alter zeigen eine deutlich geringeren Anteil an „multi-word switches“ (siehe: Linholm / Padilla (1978), Boeschoten / Verhoeven (1987)). Dort sind die Switches meist Entlehnungen eines einzelnen Lexems.
„Among younger children the tendency to favour single-word switches seems even more pronounced, as is attested by, among others, Redlinger and Park (1980), Arnberg and Arnberg (1985) and De Houwer (1990).“ (Bentahila & Davies, 1994:121)
Als Grund für das häufige Code-Switchen führen die Autoren an erster Stelle die „relief strategy“ (vgl. Meisel 1990:147) an. Sie führen einige Beispiele auf, bei denen die beiden Kinder auf Ausdrücke der jeweils gerade nicht verwandten Sprache zurückgreifen, anscheinend, weil sie das Wort in der andere Sprache nicht kennen oder es nicht so häufig benutzen.
Sie verfügen in jedem Fall über eine metalinguistische Kompetenz. Dies belegen Beispiele wie dieses:
„Miriam (listening what there is in her garden):
On a la balançoire, la balançoire et la maison de Toutou... de arbres et des fleures et... comment s’appelent... comment on appelle... kifa¶ kifa¶ kensimmiw nmilat? ‘We have the swing, the swing and Toutou’s house... trees and flowers and... what are they called... what are they call... what do they call ants?’
Interviewer: Des fourmis ‘Ants’
Miriam: Il y a des fourmis dans le jardin ‘there are ants in the garden’“ (Bentahila & Davies, 1994:124)
Ebenso wechseln sowohl Miriam als auch Amine in die jeweils andere Sprache, um etwas in der Originalsprache zu zitieren. Darüber hinaus nutzen beide Kinder das Code-Switching bereits als rhetorisches Mittel, um bestimmten Äußerungen Nachdruck zu verleihen (Emphase).
Bei diesen beiden bilingualen Kindern kann man also mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, daß sie die Sprachen differenzieren können. Was anhand dieser Studie jedoch nicht beantwortet werden kann, ist die Frage nach einer Sprachdifferenzierung in frühester Kindheit, da im Alter von fast fünf Jahren der Spracherwerb schon sehr weit vorangeschritten ist.
Genesee, Nicoladis & Paradis (1995)
Genesee, Nicoladis und Paradis haben fünf französich-englisch bilinguale Kinder im Alter zwischen 1;10 und 2;2 (MLU 1,23 - 2,08) hinsichtlich ihrer Sprachdifferenzierung untersucht, indem sie ihr Augenmerk auf funktionale Kategorien gerichtet haben. Drei der Familien (Gen, Oli, Wil) behaupteten, sie gingen bei der Erziehung nach der Strategie „one person - one language“ vor. Die Eltern der anderen zwei (Ban, Tan) gaben vor, die Sprachen im Umgang mit ihren Kindern frei zu mischen. Während der Aufnahmen stellte sich jedoch heraus, daß Gens Eltern deutlich am meisten mischten und Bans und Tans auch nicht mehr mischten als Olis Eltern.
Nur Gen war offensichtlich balanciert bilingual, Wils Äußerungen deuteten auf eine leichte Dominaz des Englischen hin, bei Tan und Ban war Englisch eindeutig dominant, genauso wie bei Oli Französisch.
Hinsichtlich der Differenzierung fanden Genesee, Nicoladis und Paradis bei allen fünf Kinder Anzeichen für ein frühe Trennung, unabhängig von der Strategie der Eltern oder der Sprachdominanz.
„Our results indicate that while these children did code mix, they were clearly able to differentiate between their two languages.“ (Genesee, Nicoladis & Paradis, 1995:611)
Dazu haben sie die Gesprächen der Kinder mit ihren Eltern untersucht, die alle eine predominante Sprache hatten, daraufhin untersucht, ob sie entsprechend der Sprachdominanz des jeweiligen Elternteils, mit dem sie sich gerade unterhalten, mehr Französisch oder Englisch sprechen. Dies bestätigte sich und kann folglich als ein Beleg für eine Differenzierung auf pragmatischer Ebene gesehen werden.
Als Ergebnis ihrer Studie halten Genesee, Nicoladis und Paradis fest, daß bilinguale Kinder unabhängig vom Input der Sprachen und der Dominanz die Systeme schon in einem sehr frühen Stadium differenzieren können.
„The present results indicate that bilinguals children between the one- and two- word stage are able to differentiate their languages. Even the most dominant children we observed (Ban and Tan) were able to use the relatively limited skills developed in their non-dominant languages selectively with the appropriate parent.“ (Genesee, Nicoladis & Paradis, 1995:627)
Zwar zeigte Gen nicht diese Differenzierung, aber er war in der linguistischen Entwicklung am weitesten vorangeschritten. Somit stützt diese mangelnde Trennung auch nicht die „onesystem hypothesis“. Jedoch haben die Autoren auch keine andere Erklärung für Gens sprachliches Verhalten.
Neben den Untersuchungen zur Differenzierung zeigen Genesee, Nicoladis & Paradis, daß die Rate der gemischten Äußerungen nicht zwangsläufig auf den elterlichen Input zurückzuführen ist.
„We could find no evidence that their mixing was due to parental input, but there was some evidence that language dominance played a role.“ (Genesee, Nicoladis & Paradis, 1995:611)
Diese Beobachtung widerlegt also zusätzlich die These der Vertreter der „one-system hypothesis“, die wie oben bereits erläutert, bei Kindern, deren Eltern die Sprachen mischen, eine höhere Mischrate ermittelt haben und dies als Fusion interpretierten, bedingt durch die nicht separaten Quellen des Inputs.
Genesee, Nicoladis & Paradis heben aber hervor, daß sie mit dieser Studie nicht implizieren wollen, daß das elterliche Mischen in jedem Fall unwichtig sei. Sie liefern verschiedene Erklärungen, die ihre Beobachtungen bedingt haben könnten und in anderen Fällen nicht zwangsläufig auftauchen müssen.
Auf der anderen Seite fanden die Autoren Evidenz für einen Relation zwischen der Sprachdominanz und der Mischrate
„we also found that the children tended to mix more when using their non-dominant language than when using their dominant language.“ (Genesee, Nicoladis & Paradis, 1995:628)
Diese Auswirkungen der Dominanzen haben die Autoren dahingehend gedeutet, daß bilinguale Kinder von ihren linguistischen Ressourcen genauso Gebrauch machen wie monolinguale.
„- the only difference being that, unlike monolingual children who are limited to the ressources of one language, bilingual children can draw on two.“ (Genesee, Nicoladis & Paradis, 1995:629)
Schlußfolgerung
Die bislang recht wenigen Untersuchungen zu Kindern, deren Eltern zwei Sprachen mischen, bestätigen zwar nicht alle die „two-system hypothesis“, liefern aber ausreichend Belege und damit Evidenz gegen die „one-system hypothesis“. Bilinguale Kinder können offensichtlich die Sprachen schon ab einer sehr frühen Phase der Sprachentwicklung differenzieren, unabhängig vom Input und dem Sprachgebrauch der Eltern.
Die Kinder können je nach Gesprächspartner die angemessene Sprache wählen und tun dies auch, abgesehen von Situationen, in denen ihr Vokabular in der gerade benutzten Sprache nicht ausreicht, um das auszudrücken, was sie sagen wollen. Dann übergeneralisieren sie im Zweifel Wörter von der anderen Sprache und „hoffen“, daß ihr Gegenüber dies auch versteht.
Zudem verwenden sie korrekte syntaktische Regeln und Strukturen den jeweiligen Zielsprachen entsprechend, sobald sie Äußerungen mit zwei oder mehr Wörtern produzieren.
Jüngere Kinder, die sich noch im Ein-Wort-Stadium befinden, wurden bislang noch nicht untersucht, so daß zu einer noch früheren Differenzierung keine Aussage getroffen werden kann. Es liegt, so weit mir bekannt, bis dato nur eine einzige Studie (Bentahila & Davies, 1994) zu bilingualen Kindern in Regionen vor, in denen das Mischen von Sprachen sowohl in der Familie als auch in der Umgebung die Regel ist. Interessant wäre also in jedem Fall eine zukünftige Untersuchung, die sich mit dem Spracherwerb sehr junger Kinder in einer gemischtsprachlichen Umgebung befaßt. Ich vermute, daß dort die These der zwei von Beginn an getrennten Sprachsysteme auch bestätigt werden könnte.
Literatur
Bentahila, Abdelâli & Davies, Eirlys (1994). Two languages, three varieties: code-switching patterns of bilingual children. In: Extra, Guus & Verhoeven, Ludo (Hrsg.). The cross- linguistic study of bilingual development. North-Holland, Amsterdam / Oxford / New York / Tokyo. 113-128.
Burling, Robbins (1971). Language development of a Garo and English speaking child. In: Bar-Adon, A & Leopold, W. F. (Hrsg.). Child Language. Prentice-Hall International, New Jersey. 170-185.
Caroline Koehn & Natascha Müller (1990). Neue Arbeitsergebnisse in der Bilingualismus- forschung. In: Augst, Gerhard (Hrsg.). Der Deutschunterricht V, Spracherwerb. 49-59.
De Houwer, Annick (1990). The acquisition of two languages from birth: a case study. Cambridge University Press, Cambridge.
De Houwer, Annick (1994). The Separate Development Hypothesis: method and implications. In: Extra, Guus & Verhoeven, Ludo (Hrsg.). The cross-linguistic study of bilingual development. North-Holland, Amsterdam / Oxford / New York / Tokyo. 39-50.
Genesee, Fred (1989). Early bilingual development: One language or two? In: Journal of Child Language 16. 161-179.
Genesee, Fred, Nicoladis, Elena & Paradis Johanne (1995). Language differentiation in early bilingual development. In: Journal of Child Language 22. 611-631.
Goodz, Naomi S. (1994). Interactions between parents and children in bilingual families. In: Genesee, Fred (Hrsg.). Educating Second Language Children. Cambridge University Press, Cambridge. 61-81.
Lambeck, Klaus (1984). Kritische Anmerkungen zur Bilingulismusforschung. Gunter Narr Verlag, Tübingen.
Lanza, Elizabeth (1990). Language Mixing in Infant Bilingualism: A Sociolinguistic Perspective. Nicht veröffentlicht, Dissertation, Washington.
Leopold, W. (1978). A child’s learning of two languages. In: Hatch, E. (Hrsg.). Second Language Acquisition: a book of readings. Newbury House, Rowley MA.
McLaughlin, Barry (1994). Retrospective on the study of early bilingualism. In: Extra, Guus & Verhoeven, Ludo (Hrsg.). The cross-linguistic study of bilingual development. NorthHolland, Amsterdam / Oxford / New York / Tokyo. 27-38.
Meisel, Jürgen M. (1986). Word Order and case marking in early child language. Evidence from simultaenous acquisition of two first languages: French and German. Linguistics 24. 123-183.
Meisel, Jürgen M. (1989a). Early differentiation of languages in bilingual children.
Hyltenstam, K. & Obler, L. (Hrsg.). Bilingualism across the Lifespan: Aspects of Acquisition, Maturity, and Loss. Cambridge University Press, Cambridge. 13-40.
Meisel, Jürgen M. (1989b). Code-switching and related phenomena in young bilingual children. Workshop on Concepts, Methodology and Data. ESF Scientific Networks. Basel. 12.-13. Januar 1990.
Meisel, Jürgen M. (Hrsg.) (1990). Two first languages. Early Grammatical Development in Bilingual Children. Foris, Dordrecht.
Redlinger, W. E. & Park, T.-Z. (1980). Language mixing in young bilinguals. In: Journal of Child Language 7. 337-352.
Romaine, Suzanne (1995). Bilingualism. Blackwell, Oxford.
Smith, Madorah E. (1936). A Study of the speech of Eight Bilingual Children of the Same Family. In: Child Development 6. 19-25.
Swain, M. (1972). Bilingualism as a first language. Nicht veröffentlicht, Dissertation, University of California, Irvine.
Swain, M. (1977). Bilingualism, monolingualism and code acquisition. In: Mackey, W. & Andersson T. (Hrsg.). Bilingualism in early childhood. Newbury House, Rowley MA.
Tabouret-Keller, A. (1963). L’acquisition du langage parlé chez un petit enfant en milieu bilingue. In: Ajuruaguera, J. de (Hrsg.). Problèmes de Psycho-Linguistique. Paris. 205-219.
Volterra, V. & Taeschner, T. (1978). The acquisition and development of language by bilingual children. In: Journal of Child Language 5. 311-326.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit zum bilingualen Erstspracherwerb?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob bilinguale Kinder die beiden Sprachsysteme von Beginn an differenzieren können. Es werden verschiedene Hypothesen, insbesondere die "one-system hypothesis" und die "two-system hypothesis", diskutiert und anhand von Studien analysiert.
Was ist die "one-system hypothesis"?
Die "one-system hypothesis" (auch "unitary language system hypothesis" genannt) besagt, dass bilinguale Kinder zunächst nur ein Sprachsystem entwickeln und die beiden Sprachen vermischen, vor allem auf lexikalischer Ebene. Diese Vermischung wird als Fusion interpretiert.
Was ist die "two-system hypothesis"?
Die "two-system hypothesis" (auch "separate development hypothesis" genannt) besagt, dass bilinguale Kinder von Beginn an zwei separate Sprachsysteme aufbauen und die Sprachen differenzieren können, auch wenn sie diese manchmal mischen. Die Mischung wird nicht als Fusion, sondern als Code-Switching oder Code-Mixing interpretiert.
Was ist der Unterschied zwischen Fusion, Code-Switching und Code-Mixing?
Fusion bedeutet, dass das bilinguale Kind die grammatischen Systeme nicht differenzieren kann. Code-Switching ist ein Zeichen vorhandener grammatischer und pragmatischer Kompetenz, wobei das Kind je nach Situation die Sprache wählt. Code-Mixing bedeutet, dass Wörter aus der gerade nicht verwendeten Sprache entliehen werden, weil der Sprecher sie in der aktuellen Sprache nicht kennt oder benutzt.
Welche Studien werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert die Studien von Smith (1936), Tabouret-Keller (1963), Burling (1971), Bentahila & Davies (1994) und Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) hinsichtlich der Sprachendifferenzierung bei bilingualen Kindern, deren Eltern die Sprachen mischen.
Was hat die Studie von Smith (1936) ergeben?
Smith beobachtete, dass jüngere Kinder, die in einer Umgebung aufwuchsen, in der die Sprachen vermischt wurden, höhere Mischraten aufwiesen als ältere Kinder, bei denen die Sprachen strikter getrennt waren. Sie interpretierte dies als Hinweis auf eine schlechtere Sprachdifferenzierung, wobei ihre Beobachtungen jedoch aufgrund wissenschaftlicher Ungenauigkeiten nicht generalisierbar sind.
Was hat die Studie von Burling (1971) ergeben?
Burling analysierte die Sprachentwicklung seines Sohnes und kam zu dem Ergebnis, dass dieser zunächst nur über ein linguistisches System verfügte. Seine Beobachtungen liefern jedoch ungewollt auch Hinweise darauf, dass sein Sohn sehr wohl die Sprachen differenzierte, insbesondere auf phonologischer und morphosyntaktischer Ebene.
Was hat die Studie von Tabouret-Keller (1963) ergeben?
Tabouret-Keller beobachtete ein französisch-deutsch bilinguales Kind und stellte fest, dass die ungleiche Gewichtung der beiden Sprachen den Spracherwerb beeinflusst. Sie sah in einer Phase mit Doubletten und gemischten Sätzen Anzeichen für ein einzelnes System, liefert aber auch Belege, dass das Kind die Sprachen auf syntaktischer Ebene differenzieren kann.
Was hat die Studie von Bentahila & Davies (1994) ergeben?
Bentahila und Davies analysierten Code-Switching-Muster bei marokkanischen Kindern, die sowohl Arabisch als auch Französisch sprechen. Sie interpretierten die gemischtsprachlichen Äußerungen der Kinder als Code-Switching und stellten fest, dass die Kinder die Sprachsysteme differenzieren können und über pragmatische Kompetenzen verfügen.
Was hat die Studie von Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) ergeben?
Genesee, Nicoladis und Paradis fanden bei französisch-englisch bilingualen Kindern Anzeichen für eine frühe Trennung der Sprachen, unabhängig von der Strategie der Eltern oder der Sprachdominanz. Sie stellten fest, dass die Kinder die Sprachen differenzieren können, auch wenn sie diese mischen.
Zu welchem Schluss kommt die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass bilinguale Kinder die Sprachen schon ab einer sehr frühen Phase der Sprachentwicklung differenzieren können, unabhängig vom Input und dem Sprachgebrauch der Eltern. Sie wählen je nach Gesprächspartner die angemessene Sprache und verwenden korrekte syntaktische Regeln.
- Quote paper
- Christian Baars (Author), 1999, Sprachdifferenzierung von fruehester Kindheit bei gemischtsprachlichem Input, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104382