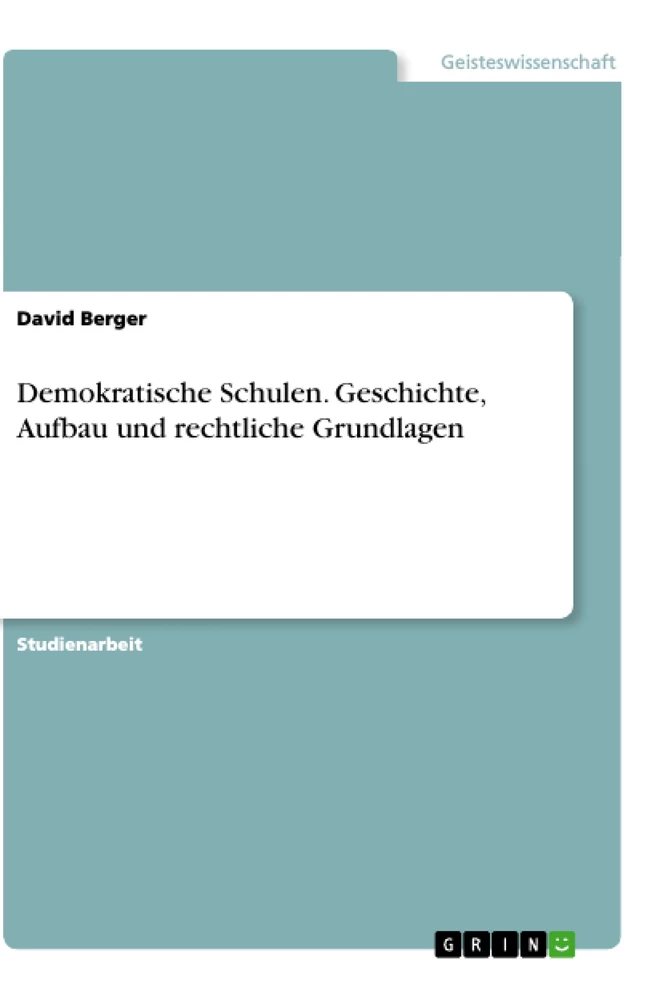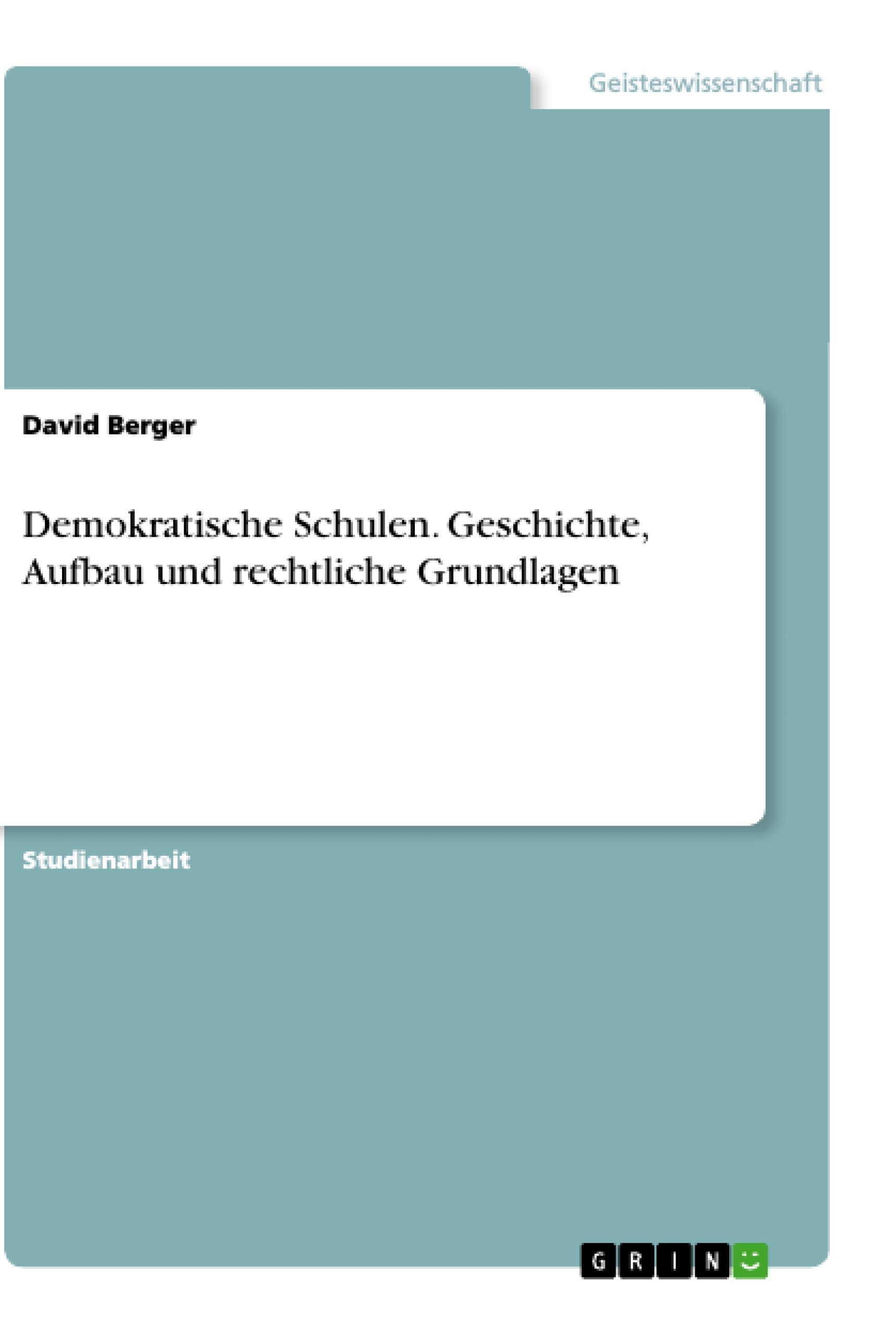Das deutsche Schulsystem gliedert sich in drei Stufen, die Primärstufe, die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Darüber hinaus gibt es allerdings wenig einheitliche Regelungen, denn die Bildungshoheit liegt bei den Ländern. Man findet die unterschiedlichsten Schulformen; jedoch haben alle eines gemeinsam: Es gibt einen Unterrichtsablauf, der von dem oder der Lehrer*in bestimmt wird. Außerdem gibt es fremdbestimmte Leistungsbeurteilungen, wenn auch an manchen Schulen keine Noten (wohl aber Beurteilungen) vergeben werden (z. B. Waldorfschule).
Das Paradigma, dass es Lernvorgaben und Bewertungen für die Jugendlichen geben müsse, scheint genauso tief
verankert zu sein wie die Annahme, dass von alleine - ohne Stundenpläne - nicht viel passiert in der Schule.
An einer Demokratischen Schule verhält es sich anders: dort werden Unterrichtskurse nur als eine von vielen verschiedenen Lernmöglichkeiten gesehen. Schüler*innen einer Demokratischen Schule entscheiden selbst, was und wie sie lernen, und
machen ihre Umgangsregeln selbst nach dem Grundsatz: Ein Mensch - eine Stimme. Über diese Schulen soll die folgende Arbeit handeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte der Demokratischen Schulen
- Merkmale und Struktur
- Pädagogische Überlegungen
- Rechtliche Grundlagen
- Demokratische Schulen und Inklusion
- Evaluationen und Studien
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text bietet eine umfassende Einführung in das Konzept der Demokratischen Schule, erörtert ihre historische Entwicklung, analysiert ihre charakteristischen Merkmale und pädagogischen Grundlagen und beleuchtet ihre rechtliche Einordnung sowie ihre Rolle im Kontext von Inklusion.
- Die historische Entwicklung Demokratischer Schulen
- Die pädagogischen Prinzipien und ihre Auswirkungen auf die Schüler*innen
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen
- Die Bedeutung von Demokratischen Schulen im Kontext von Inklusion
- Bewertung und Forschungsergebnisse im Bereich der Demokratischen Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text stellt das deutsche Schulsystem vor, das durch eine Hierarchie von Bildungsstufen und weitgehend einheitliche Lehrpläne geprägt ist. Im Gegensatz dazu werden Demokratische Schulen vorgestellt, die Schüler*innen mehr Mitspracherecht und Selbstbestimmung ermöglichen.
Geschichte der Demokratischen Schulen
Die Geschichte Demokratischer Schulen wird anhand von wichtigen Persönlichkeiten und ihren pädagogischen Konzepten erläutert. Der Text stellt heraus, wie sich die Idee der Selbstbestimmung im Laufe der Zeit entwickelt hat und welche Schulen als Vorläufer von heutigen Demokratischen Schulen gelten können.
Merkmale und Struktur
Dieser Abschnitt beschreibt die besonderen Merkmale von Demokratischen Schulen, wie zum Beispiel die Schüler*innenvertretung, die demokratische Entscheidungsfindung und die flexible Gestaltung des Unterrichts.
Pädagogische Überlegungen
Dieser Teil beleuchtet die pädagogischen Prinzipien, die Demokratischen Schulen zugrunde liegen. Es wird auf die Bedeutung von Selbstverantwortung, intrinsischer Motivation und Partizipation für den Lernprozess eingegangen.
Rechtliche Grundlagen
Der Text analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für Demokratische Schulen in Deutschland und erläutert mögliche Herausforderungen und Konflikte mit dem traditionellen Schulsystem.
Demokratische Schulen und Inklusion
Dieser Abschnitt untersucht die Rolle von Demokratischen Schulen im Kontext von Inklusion und beleuchtet, wie sie zur Förderung von Diversität und sozialer Gerechtigkeit beitragen können.
Schlüsselwörter
Demokratische Schulen, Selbstbestimmung, Partizipation, Schüler*innenvertretung, Pädagogik, Inklusion, Evaluation, Studien, Rechtliche Grundlagen, Geschichte, Bildung, Selbstverantwortung, Motivation, Lernprozess, Entscheidungsprozess, Schulsystem,
- Quote paper
- David Berger (Author), 2020, Demokratische Schulen. Geschichte, Aufbau und rechtliche Grundlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043948