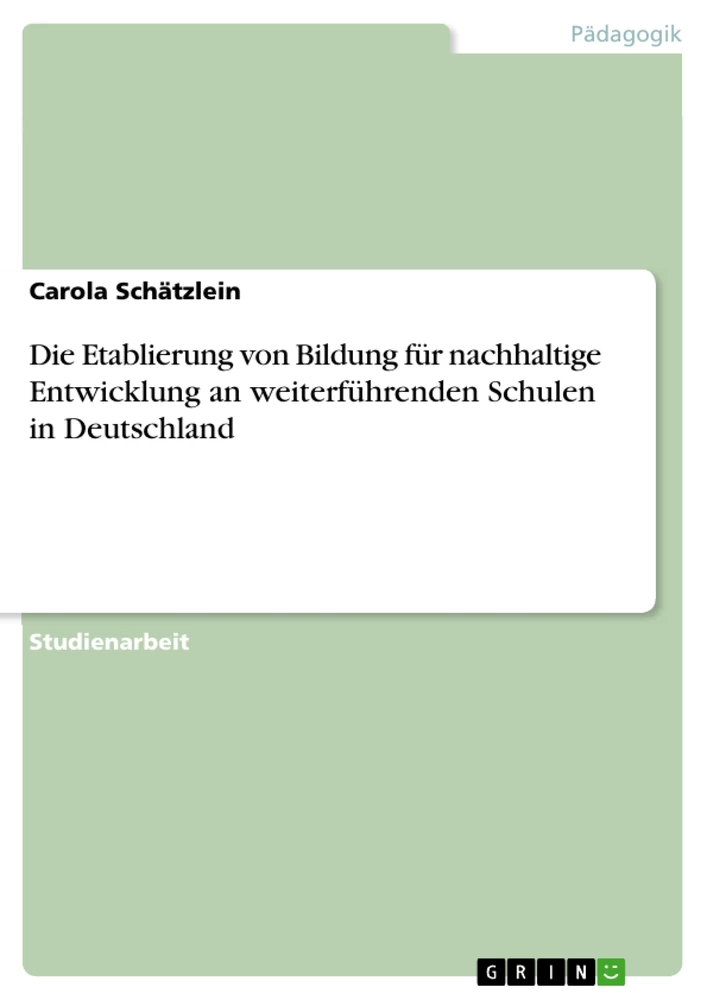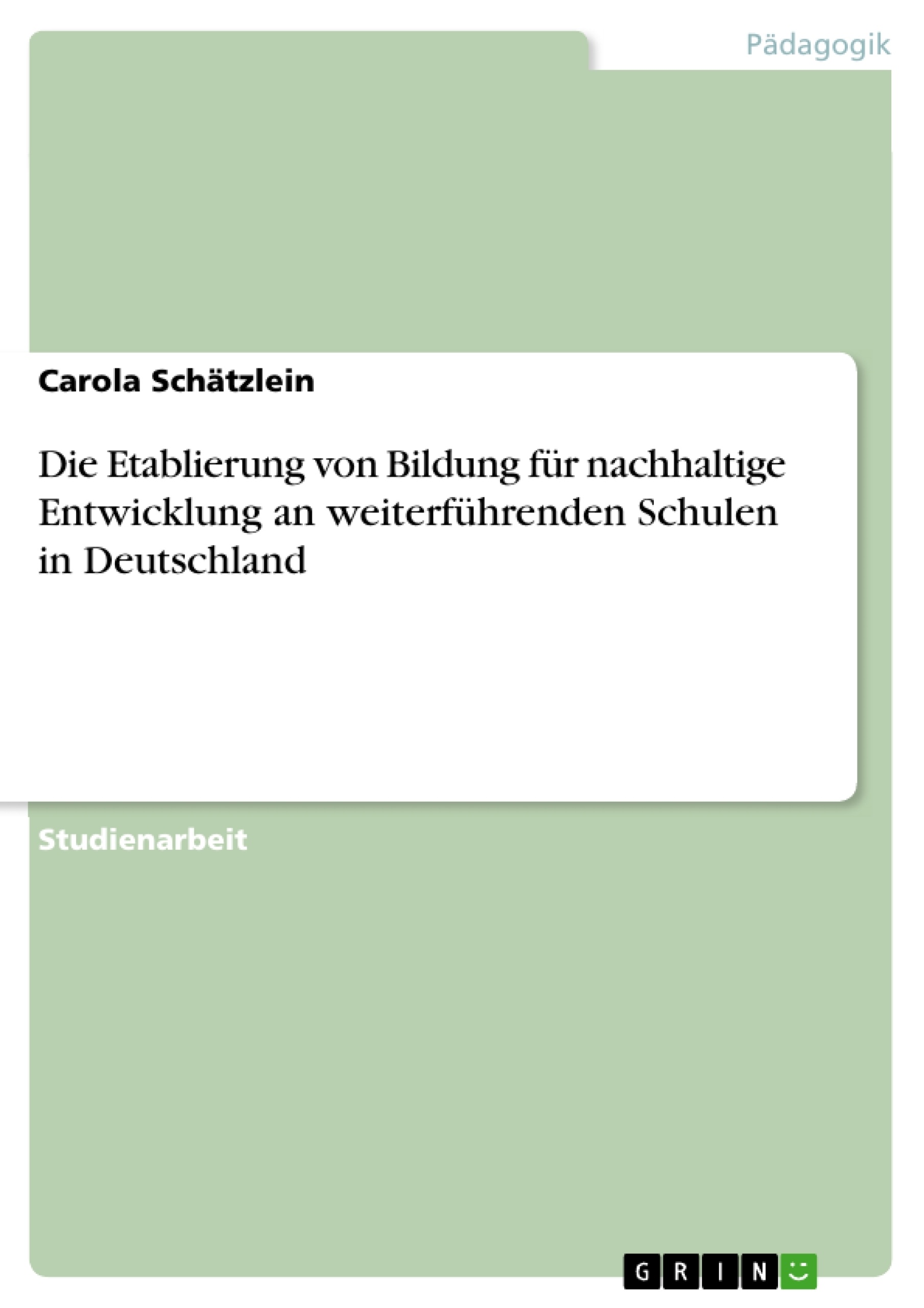Der Ausarbeitung liegt das wissenschaftlich akzeptierte Verständnis für Nachhaltigkeit zugrunde. Maßnahmen sollen die Verantwortung für künftige Generationen und die Gerechtigkeit unter den heute Lebenden berücksichtigen. Nachhaltigkeit bezieht sich zudem auf die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Bei Nachhaltigkeitsmaßnahmen wird eine ausgewogene Berücksichtigung der drei Dimensionen angestrebt.
Von den politischen Vorgaben führt die Arbeit zu der Frage der konkreten Umsetzung. Da das Konzept BNE einen hohen Stellenwert für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele hat, stellt sich die Frage, welche Kompetenzen damit verbunden sind. Es schließt sich eine Veranschaulichung der Prinzipien von Bildung für nachhaltige Entwicklung als theoretische Basis an.
Inhalte und Methoden diesbezüglich haben bereits Eingang an weiterführenden Schulen gefunden. Anschließend ist deshalb von besonderem Interesse, inwieweit es in den vergangenen Jahren bereits gelungen ist, das Bildungsprinzip BNE an weiterführenden Schulen zu verankern. Mit Hilfe von Veröffentlichungen der Deutschen UNESCO-Kommission konnten dazu Erkenntnisse gewonnen werden. Mit der begleitenden Evaluation der Umsetzung des Weltaktionsprogramms BNE in Deutschland ist die Freie Universität Berlin betraut. Auf veröffentlichte Evaluationsergebnisse konnte ebenfalls zugegriffen werden. Auch eine Erhebung zur Implementation von BNE an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen liegt der Ausarbeitung zugrunde.
Aufgrund der Kulturhoheit der Länder gibt es ein breites Schulspektrum in Deutschland. Um diese Spezifizierungen zu umgehen, wurde in der Ausarbeitung der Titel weiterführende Schulen gewählt, da dieser Terminus alle allgemeinbildenden Schularten, die sich an die Grundschulbildung anschließen, umfasst.
Für die Ausführungen stand schließlich die Frage im Zentrum, welche Möglichkeiten es für die Etablierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung an weiterführenden Schulen gibt. Das Kapitel fünf geht daher auf Implementationsmaßnahmen ein. Der Maßnahmenkatalog orientiert sich an den Handlungszielen des Nationalen Aktionsplans. Die aufgeführten Beispiele sind zum Teil in der eigenen Unterrichtspraxis erprobt worden. Es wird die Überlegung einbezogen, inwieweit tatsächlich das Bildungsprinzip BNE auf diesem Wege umgesetzt wird.
Die Zusammenfassung beleuchtet noch einmal die wesentlichen Erkenntnisse, während in der Diskussion auch kritische Überlegungen anklingen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Legitimation von Bildung für nachhaltige Entwicklung
- 2.1 Politische Rahmendokumente für BNE auf internationaler Ebene
- 2.2 Die Umsetzung der politischen Vorgaben auf nationaler Ebene
- 2.3 Erwartungen an Bildung für nachhaltige Entwicklung
- 3. Darstellung des Bildungskonzepts BNE
- 4. Eine Bilanz nach der ersten UN-Dekade BNE in Deutschland
- 5. Maßnahmen für eine erfolgreiche Etablierung von BNE an weiterführenden Schulen
- 5.1 BNE als Aufgabe des Bildungswesens
- 5.2 Die strukturelle Verankerung von BNE in Lehr- und Bildungsplänen
- 5.3 Die Verankerung von BNE in der Lehrerausbildung
- 5.4 Whole System Approach
- 5.5 Die Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen
- 6. Zusammenfassung
- 7. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Etablierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an weiterführenden Schulen in Deutschland. Sie untersucht die Legitimation von BNE, beleuchtet das Bildungskonzept und analysiert die Umsetzung im deutschen Schulsystem. Dabei werden die politischen Rahmenbedingungen, die Erwartungen an BNE und die wichtigsten Maßnahmen für eine erfolgreiche Etablierung betrachtet.
- Legitimation und politische Vorgaben für BNE auf nationaler und internationaler Ebene
- Das Bildungskonzept BNE und seine Prinzipien
- Die Bilanz der ersten UN-Dekade BNE in Deutschland
- Maßnahmen zur erfolgreichen Etablierung von BNE an weiterführenden Schulen
- Die Rolle der Lehrerausbildung und die Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Etablierung von BNE an weiterführenden Schulen ein und beleuchtet die vielfältigen Herausforderungen, denen Lehrer im Bildungsbereich gegenüberstehen. Dabei wird die Legitimation von BNE im Kontext dieser Herausforderungen analysiert und die politischen Vorgaben und Erwartungen in Verbindung mit BNE dargestellt.
Kapitel zwei untersucht die Legitimation von BNE durch die Betrachtung politischer Rahmendokumente auf internationaler Ebene. Die Umsetzung dieser politischen Vorgaben auf nationaler Ebene wird ebenfalls beleuchtet. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung der Erwartungen an Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Kapitel drei widmet sich der Darstellung des Bildungskonzepts BNE und erläutert die Prinzipien, die dieses Konzept zugrunde liegen.
In Kapitel vier wird eine Bilanz der ersten UN-Dekade BNE in Deutschland gezogen und die Erfolge und Herausforderungen der Umsetzung von BNE im deutschen Bildungssystem beleuchtet.
Kapitel fünf fokussiert auf Maßnahmen, die für eine erfolgreiche Etablierung von BNE an weiterführenden Schulen erforderlich sind. Dabei werden die Rolle des Bildungswesens, die strukturelle Verankerung von BNE in Lehr- und Bildungsplänen, die Verankerung von BNE in der Lehrerausbildung, der Whole System Approach und die Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen untersucht.
Schlüsselwörter
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Nachhaltigkeit, politische Vorgaben, Bildungskonzept, UN-Dekade BNE, Lehrerausbildung, Whole System Approach, Partizipation, gesellschaftliche Gruppen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet BNE im schulischen Kontext?
BNE steht für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Es zielt darauf ab, Schülern Kompetenzen zu vermitteln, die ökologische, ökonomische und soziale Gerechtigkeit fördern.
Wie wird BNE an weiterführenden Schulen legitimiert?
Die Legitimation erfolgt über internationale Rahmendokumente (z. B. UNESCO) sowie nationale Aktionspläne, die Nachhaltigkeit als Bildungsziel verankern.
Was ist der „Whole System Approach“?
Dieser Ansatz sieht vor, Nachhaltigkeit nicht nur im Unterricht zu lehren, sondern die gesamte Schule (Bewirtschaftung, Schulkultur, Partizipation) danach auszurichten.
Welche Rolle spielt die Lehrerausbildung bei BNE?
Eine erfolgreiche Etablierung setzt voraus, dass BNE fest in der Lehrerausbildung verankert wird, um Pädagogen die nötigen Methoden und Inhalte zu vermitteln.
Wie ist der Stand der Umsetzung nach der UN-Dekade BNE?
Die Arbeit zieht eine Bilanz und stellt fest, dass BNE zwar Eingang in die Schulen gefunden hat, die strukturelle Verankerung aber weiterhin eine Herausforderung bleibt.
- Arbeit zitieren
- Carola Schätzlein (Autor:in), 2019, Die Etablierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung an weiterführenden Schulen in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1044114