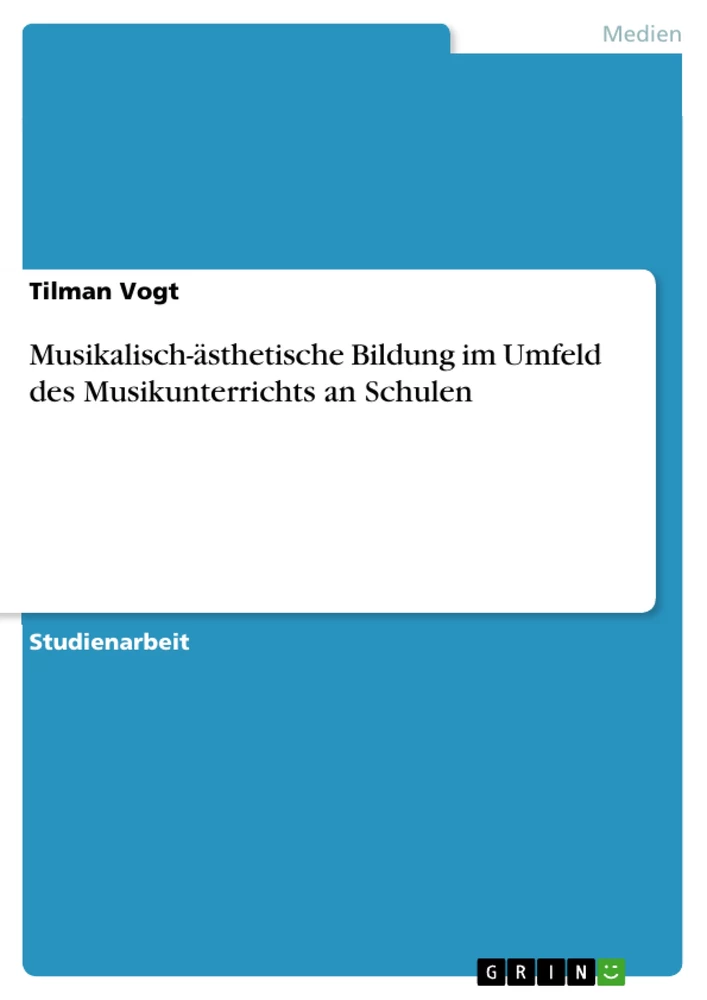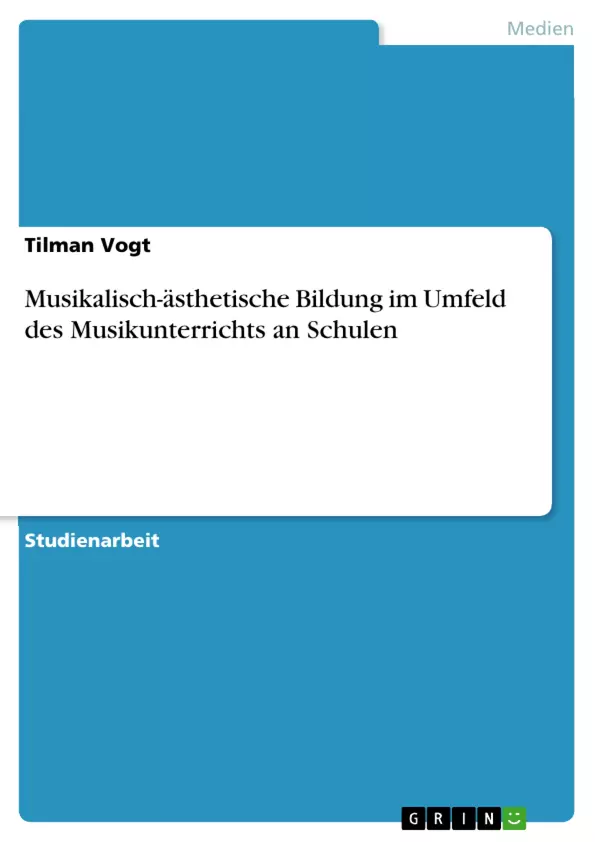Meinungen zur Notwendigkeit einer im weitergedachten Sinne ästhetischen Bildungsidee liegen uns bereits seit der Moralphilosophie des 18. Jahrhunderts vor und wurden beispielweise von Friedrich Schiller in dessen Briefen zur „ästhetischen Erziehung“ verbalisiert. Blicken wir zugleich auf die letzten 40 bis 50 Jahren zurück, kann ein Aufschwung musikdidaktisch-theoretischer Abhandlungen verzeichnet werden, wodurch die ästhetische Bildung vermehrt in den Fokus musikpädagogischer Bemühung rücken konnte.
Neben einer zunehmenden Konkretisierung dessen, was ästhetische Bildung charakterisiere und von anderen Bildungsformen unterscheide, gewann sie zunehmend an Bedeutung, sodass gegenwärtig musikalisch-ästhetische Bildung als eine der vier grundlegenden Argumentationsmuster zur Legitimation des Musikunterrichts im deutschen Schulsystem betitelt wird. Darüber hinaus wurde im Deutschen PISA-Konsortium aus dem Jahr 2001 betont, dass in Verbindung mit ästhetischer Wahrnehmung beziehungsweise Bildung eine von vier unterschiedlichen Modi der Welterfahrung unterstützt werden würde, die neben kognitiver, moralisch-evaluativer und religiös-konstitutiver Rationalität auf einer ästhetisch-expressiven Rationalität basiere.
Die Relevanz ästhetischer Bildung wird auch im saarländischen Lehrplan für das Fach Musik an Gymnasien formuliert. So heißt es, dass die Entwicklung eines ästhetischen Empfindungs- und Urteilsvermögen sowie ästhetische Sensibilisierung eine unverzichtbare Orientierungsgrundlage im Umgang mit einem umfangreichen Musikangebot sei und einen entscheidenden Beitrag zur Allgemeinbildung leiste.
Doch was charakterisiert musikalisch-ästhetische Bildungsprozesse?
Das Inszenieren ästhetischer Erfahrungsräume gilt als ein vielversprechender Ansatz des Musikpädagogen Christian Rolle, weswegen sich diese Arbeit auch dieser Thematik widmen wird. Von einer Stellungnahme zu den vier gegenwärtigen Argumentationsdiskursen wird in dieser Untersuchung bewusst Abstand genommen, da es den Umfang der Arbeit sprengen würde. Als Leitliteratur gelten u.a. eine Dissertation von C. Rolle sowie vorrangig Artikel der Autoren U. Brandstätter und K. Borg.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ästhetik und Aisthesis
- 3. Differenzierung zwischen Bildung und Erziehung
- 4. Ästhetische und nicht-ästhetische musikalische Erfahrung
- 5. Kernmerkmale ästhetischer Erfahrung
- 5.1. Grundlegendes
- 5.2. Sinnlichkeit
- 5.3. Selbstzweck
- 5.4. Selbstbezüglichkeit
- 5.5. Selbst- und Weltbezug
- 5.6. Ästhetische Distanz, Fiktionalität und Potentialität
- 5.7. Differenz
- 5.8. Abschließende Worte
- 6. Der ästhetische Erfahrungspraktiken nach Seel
- 6.1. Ästhetik der Korrespondenz
- 6.2. Ästhetik der Kontemplation
- 6.3. Ästhetik der Imagination
- 7. Ästhetische Handlungsprozesse
- 8. Didaktische Reflexion: Zur Inszenierung ästhetischer Erfahrungsräume
- 9. Ausblick und kritisches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung musikalisch-ästhetischer Bildung im Kontext des Musikunterrichts an Schulen. Sie untersucht die zentralen Merkmale ästhetischer Erfahrung und analysiert die Relevanz von ästhetischen Bildungsprozessen in Bezug auf die Entwicklung eines ästhetischen Empfindungs- und Urteilsvermögens. Die Arbeit beleuchtet zudem die Herausforderungen, die sich im Spannungsfeld zwischen theoretischen Ansätzen und der Praxis der ästhetischen Bildung ergeben.
- Relevanz ästhetischer Bildung im Musikunterricht
- Charakteristika ästhetischer Erfahrung
- Differenzierung zwischen Bildung und Erziehung
- Inszenierung ästhetischer Erfahrungsräume
- Herausforderungen der ästhetischen Bildung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Diskurses um ästhetische Bildung und zeigt die Relevanz dieses Themas im heutigen Kontext. Kapitel 2 definiert die Begriffe „Ästhetik“ und „Aisthesis“ und untersucht die Unterschiede zwischen sinnlicher Wahrnehmung und ästhetischer Wahrnehmung. Kapitel 3 beleuchtet die Unterscheidung zwischen Bildung und Erziehung und ihre Auswirkungen auf die pädagogische Praxis. Kapitel 4 stellt die Bedeutung ästhetischer Erfahrungen in der musikalischen Bildung heraus und zeigt auf, wie ästhetische und nicht-ästhetische musikalische Erfahrungen voneinander abgegrenzt werden können. Kapitel 5 analysiert die Kernmerkmale ästhetischer Erfahrung, inklusive Sinnlichkeit, Selbstzweck, Selbstbezüglichkeit und ästhetische Distanz.
Schlüsselwörter
Ästhetische Bildung, Musikpädagogik, Aisthesis, Erfahrungsräume, Didaktik, ästhetische Wahrnehmung, Bildung, Erziehung, Kompetenzorientierung, Leistungsbewertung.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert musikalisch-ästhetische Bildungsprozesse?
Sie zeichnen sich durch sinnliche Wahrnehmung (Aisthesis), Selbstzweckhaftigkeit und die Entwicklung eines ästhetischen Urteilsvermögens aus, das über rein kognitives Wissen hinausgeht.
Was ist der Unterschied zwischen Bildung und Erziehung im Musikunterricht?
Erziehung zielt oft auf Verhaltensänderung oder Kompetenzerwerb ab, während Bildung die individuelle Auseinandersetzung mit der Welt und die Formung des Selbst durch ästhetische Erfahrung betont.
Was bedeutet "ästhetische Distanz"?
Ästhetische Distanz ermöglicht es dem Lernenden, Kunstwerke nicht nur emotional zu erleben, sondern sie als fiktionale Gebilde wahrzunehmen und reflektiert zu bewerten.
Was sind "ästhetische Erfahrungsräume" nach Christian Rolle?
Dies sind didaktisch inszenierte Situationen im Unterricht, die es Schülern ermöglichen, eigene musikalische Erfahrungen zu machen, ohne sofort einem Leistungsdruck oder einer kognitiven Verwertung unterworfen zu sein.
Wie legitimiert die PISA-Studie ästhetische Bildung?
Das PISA-Konsortium 2001 nannte die ästhetisch-expressive Rationalität als einen von vier Modi der Welterfahrung, der für eine ganzheitliche Allgemeinbildung unverzichtbar ist.
Welche Rolle spielt die Sinnlichkeit (Aisthesis)?
Die Aisthesis ist die Basis der ästhetischen Erfahrung. Sie betont die Bedeutung der körperlichen und sinnlichen Wahrnehmung von Musik als Grundlage für Bildungsprozesse.
- Citar trabajo
- Tilman Vogt (Autor), 2021, Musikalisch-ästhetische Bildung im Umfeld des Musikunterrichts an Schulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1044514