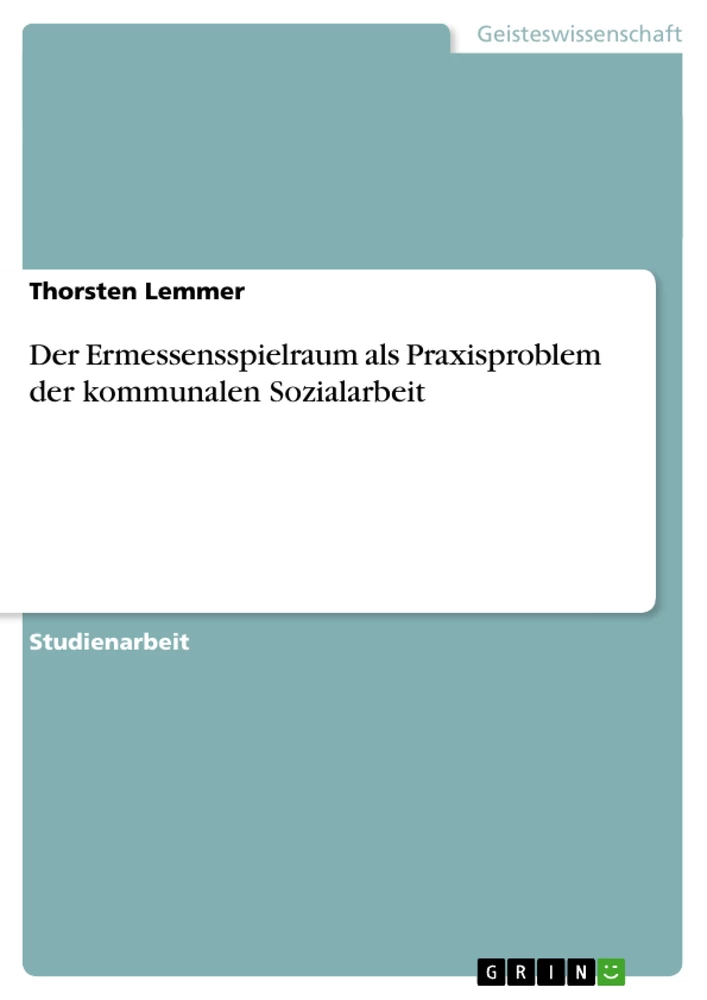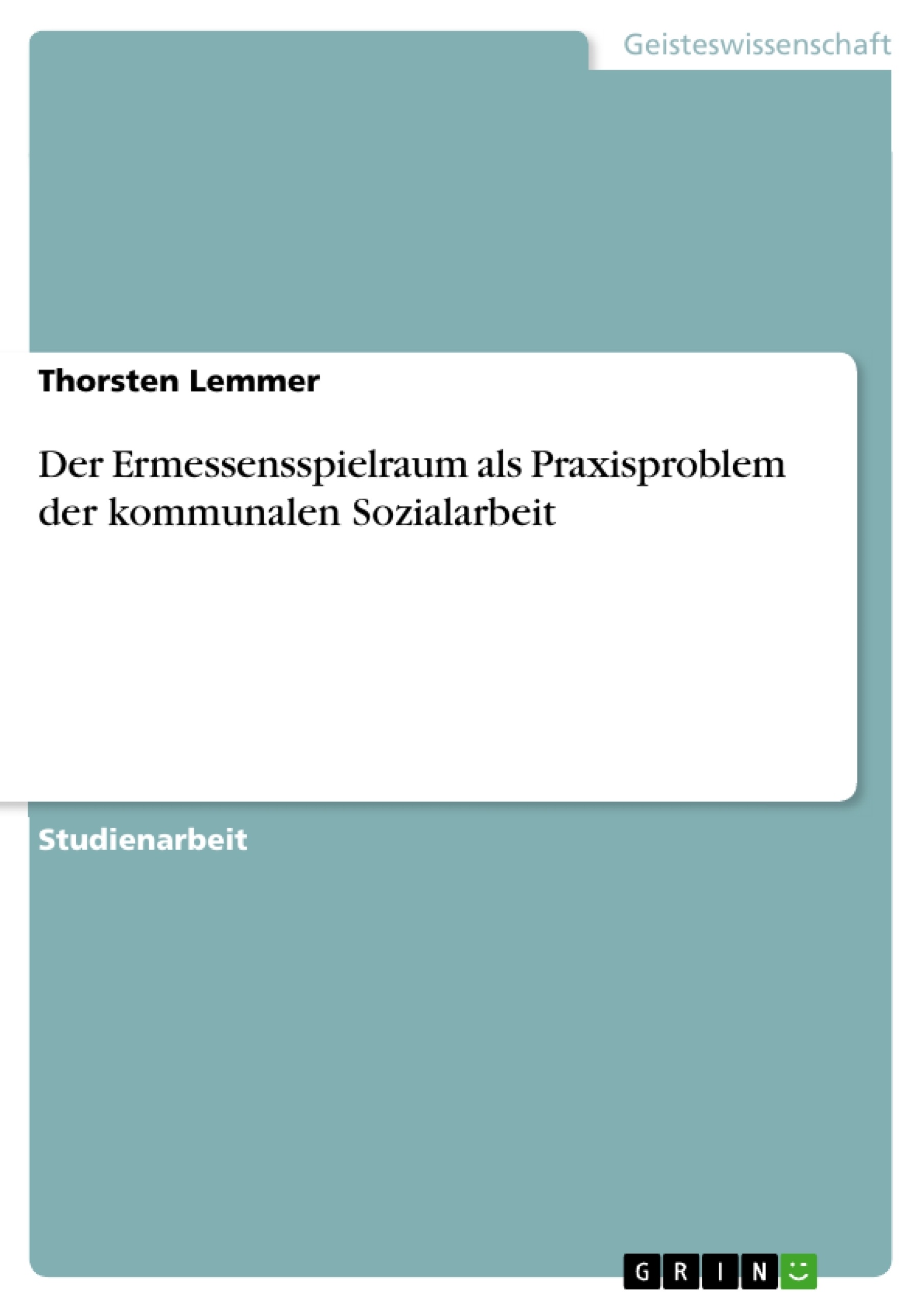Ziel dieser Arbeit ist es, am Beispiel einer typischen Behördenstruktur einer 100.000-Einwohner-
Stadt zu untersuchen, in welcher Form der theoretische Anspruch des Bundessozialhilfegesetzes
(BSHG) in der praktischen Wirklichkeit realisiert wird und inwieweit die Praxis der Sozialarbeit
zu diesbezüglichen Problemen führen kann. Aufgrund der Vielfalt der in diesem Zusammenhang
auftauchenden Fragestellungen habe ich mich bei dieser Arbeit auf eine Maßgabe der
gesetzlichen Rahmenbedingungen konzentriert, die mir als besonders problematisch erscheinen.
Zur Untersuchung habe ich das Sozialamt der Stadt Iserlohn am Rande des Ruhrgebietes
herangezogen. In den Problemgruppen kommunaler Arbeit kann diese hinsichtlich Ausländeranteil,
Arbeitslosenquote und Kriminalitätsrate als im Durchschnitt liegend und damit
repräsentativ angesehen werden.1
Ein immer wieder auftauchendes Problemfeld in der Durchführung kommunaler Sozialarbeit
stellt die Anwendung gesetzgeberischer Regeln dann auf, wenn dabei den handelnden Akteuren
für seine Entscheidung vom Gesetzgeber ein Ermessensspielraum eingeräumt wird.2 Dies ist bei
der Sozialarbeit aufgrund der qua Gesetz geforderten Berücksichtigung der Besonderheiten des
Einzelfalls (§ 3 BSHG, Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles) jedoch
unumgänglich. Ich werde in den folgenden Erläuterungen nach einer kurzen Darstellung der
gesetzlichen Grundlagen anhand von negativen und positiven Beispielen aus den drei Aufgabenfeldern
Verwaltungskooperation, Beihilfegewährung und Persönliche Hilfe exemplarisch
darstellen, wie sich der Ermessensspielraum in der Praxis der Sozialarbeit konkret äußert. Dabei
ist es wichtig zu erwähnen, dass die im folgenden beschriebenen Fallbeispiele von mir
ausgewählte Fallbeispiele sind, die wegen ihrer Deutlichkeit hohen Erklärungscharakter besitzen
und dabei gleichzeitig repräsentativ für viele andere stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen
- 2.1. Die Institution Sozialamt in der Kommune
- 2.2. Allgemeine gesetzliche Grundlagen
- 2.3. Die Definition des "pflichtmäßigen Ermessens"
- 3. Exemplarische Ermessensentscheidungen in der praktischen Sozialarbeit
- 3.1. Das Problem der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen
- 3.2. Das Problem der Gewährungspraxis: Einzelfallentscheidung oder Pauschalisierung?
- 3.2.1. Das Misstrauen gegenüber dem Sozialhilfeempfänger als Problem der Einzelfallentscheidung
- 3.2.2. Die Richtlinienvorgabe als Problem der Pauschalisierung
- 3.3. Der Ermessenspielraum bei der persönlichen Hilfe
- 3.3.1. Die Definition der persönlichen Hilfe
- 3.3.2. Die Praxis der persönlichen Hilfe
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie der theoretische Anspruch des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) in der Praxis kommunaler Sozialarbeit in einer 100.000-Einwohner-Stadt umgesetzt wird und welche Probleme dabei auftreten können. Der Fokus liegt auf dem Ermessensspielraum der Sozialarbeiter und seinen Auswirkungen.
- Die Umsetzung des BSHG in der Praxis
- Der Ermessensspielraum in der Sozialarbeit
- Probleme der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen eines Sozialamtes
- Die Gewährungspraxis von Sozialhilfe: Einzelfallentscheidung vs. Pauschalisierung
- Der Ermessensspielraum bei der persönlichen Hilfe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Umsetzung des BSHG in der Praxis eines Sozialamtes und der damit verbundenen Probleme, insbesondere im Hinblick auf den Ermessensspielraum. Die Stadt Iserlohn wird als Fallbeispiel gewählt, da sie in Bezug auf verschiedene sozioökonomische Faktoren als repräsentativ angesehen wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und deren praktische Anwendung anhand von Beispielen aus den Bereichen Verwaltungskooperation, Beihilfegewährung und persönliche Hilfe.
2. Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der kommunalen Sozialarbeit. Es beschreibt die Institution Sozialamt in der Kommune, seine Organisation in Iserlohn und die allgemeine gesetzliche Grundlage im Bundessozialhilfegesetz (BSHG). Das Kapitel erläutert die historische Entwicklung der Sozialhilfe und die Prinzipien des BSHG, wie z.B. die familienbezogene Hilfe, die Hilfe durch Fachkräfte und das Subsidiaritätsprinzip. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Prinzip der Individualisierung der Hilfe und der Definition des "pflichtmäßigen Ermessens" im Rahmen des BSHGs, welches die Handlungsfreiheit der Sozialarbeiter bei der Einzelfallentscheidung beschreibt. Das Kapitel behandelt auch die Bedeutung der sozialen Verschwiegenheit und der Loyalitätspflicht der Sozialarbeiter.
3. Exemplarische Ermessensentscheidungen in der praktischen Sozialarbeit: Dieses Kapitel präsentiert Fallbeispiele, um zu zeigen, wie sich der Ermessensspielraum in der Praxis der Sozialarbeit konkret auswirkt. Es analysiert Probleme der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen des Sozialamtes und die Herausforderungen bei der Gewährung von Sozialhilfe. Die Diskussion umfasst die Frage, ob Einzelfallentscheidungen oder Pauschalisierungen vorteilhafter sind und welche Probleme dabei entstehen können (z.B. Misstrauen gegenüber den Hilfeempfängern, starre Richtlinienvorgaben). Das Kapitel untersucht auch den Ermessensspielraum bei der persönlichen Hilfe, ihre Definition und praktische Umsetzung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Umsetzung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) in der Praxis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die praktische Umsetzung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) in einer 100.000-Einwohner-Stadt, fokussiert auf den Ermessensspielraum der Sozialarbeiter und die damit verbundenen Probleme. Die Stadt Iserlohn dient als Fallbeispiel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen der kommunalen Sozialarbeit, die Institution Sozialamt, die Definition des pflichtmäßigen Ermessens im BSHG, die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen eines Sozialamtes, die Gewährungspraxis von Sozialhilfe (Einzelfallentscheidung vs. Pauschalisierung), und den Ermessensspielraum bei der persönlichen Hilfe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, ein Kapitel zu exemplarischen Ermessensentscheidungen in der praktischen Sozialarbeit und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der BSHG-Umsetzung und der damit verbundenen Herausforderungen.
Wie wird der Ermessensspielraum der Sozialarbeiter behandelt?
Die Arbeit analysiert den Ermessensspielraum der Sozialarbeiter ausführlich. Es werden konkrete Fallbeispiele aus der Praxis präsentiert, um zu zeigen, wie sich dieser Spielraum in der täglichen Arbeit auswirkt. Besonders werden die Problematiken bei der Einzelfallentscheidung im Vergleich zu Pauschalisierungen sowie der Ermessensspielraum bei der persönlichen Hilfe untersucht.
Welche Probleme werden im Zusammenhang mit der BSHG-Umsetzung aufgezeigt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Probleme, darunter die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen des Sozialamtes, das Misstrauen gegenüber Sozialhilfeempfängern, starre Richtlinienvorgaben bei der Pauschalisierung und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der persönlichen Hilfe.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit stützt sich auf das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und erläutert dessen Prinzipien, wie die familienbezogene Hilfe, die Hilfe durch Fachkräfte und das Subsidiaritätsprinzip. Besonders relevant ist die Definition des "pflichtmäßigen Ermessens" im BSHG.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit nutzt eine Fallstudienmethode, wobei die Stadt Iserlohn als Fallbeispiel dient, um die theoretischen Aspekte des BSHG mit der praktischen Umsetzung zu vergleichen und auftretende Probleme aufzuzeigen.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Fachkräfte im Sozialwesen, Studierende der Sozialarbeit und alle, die sich für die praktische Umsetzung des BSHG und die damit verbundenen Herausforderungen interessieren.
- Quote paper
- Thorsten Lemmer (Author), 2003, Der Ermessensspielraum als Praxisproblem der kommunalen Sozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10450