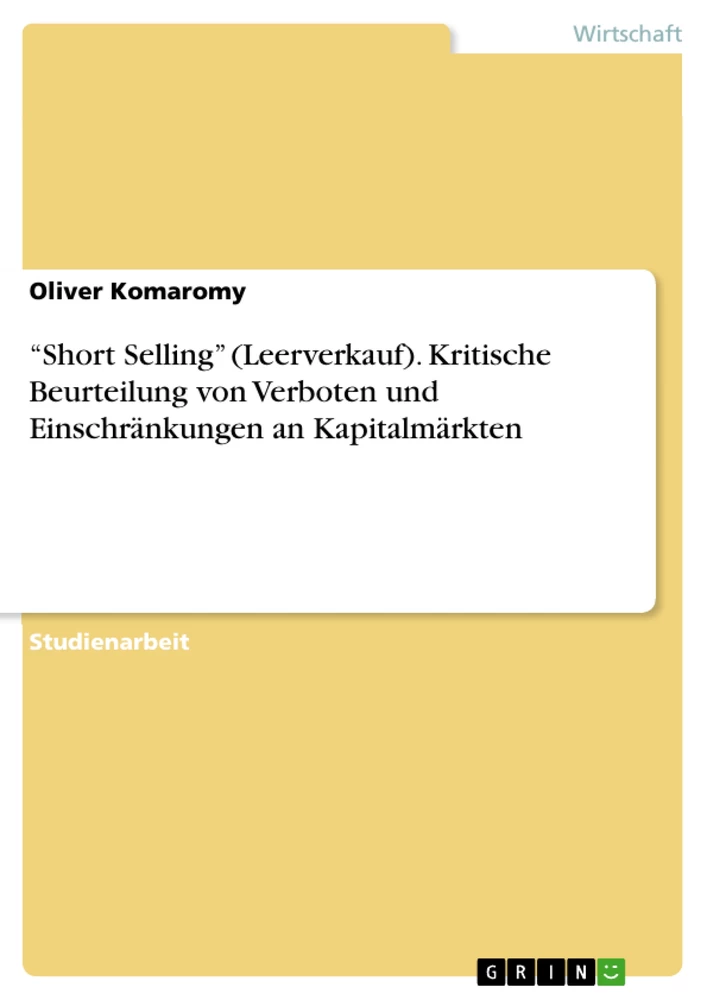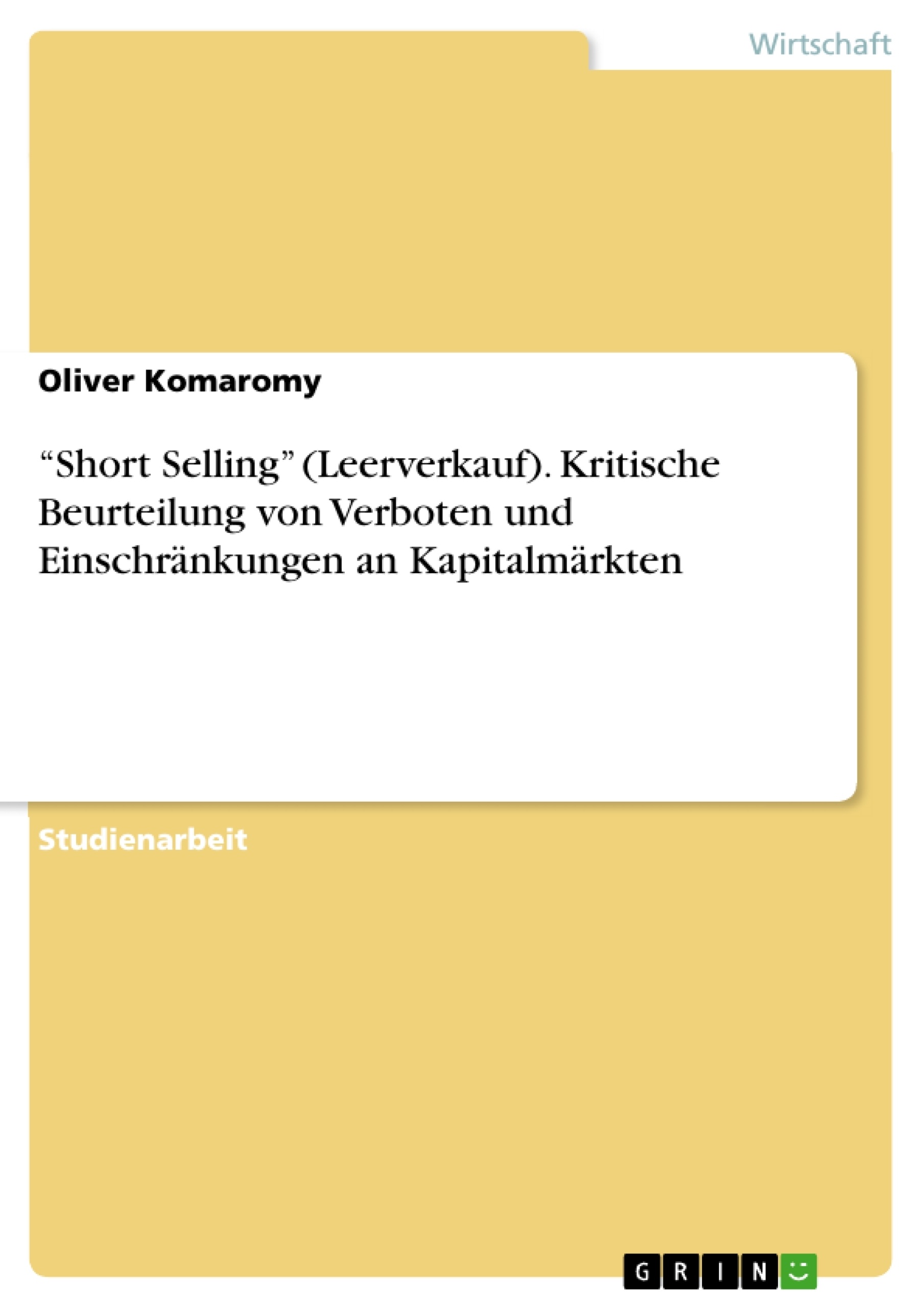Die ersten dokumentierten Leerverkäufe fanden Anfang des 17. Jahrhunderts statt, als der holländische Kaufmann Isaac Le Maire bereits 1609 erste Leerverkäufe mit Anteilspapieren (welche den heutigen Aktien ähneln) der damaligen „Niederländischen Ostindien-Kompanie“ durchführte. Höchstwahrscheinlich wurden schon früher ähnlich geartete Leerverkäufe durchgeführt, nur ist das oben beschriebene Ereignis deshalb von besonderer Bedeutung, da dieses, wie bereits erwähnt, den ersten dokumentierten Fall darstellt und sogleich den Startschuss für Regulierungen ebendieser Geschäfte darstellt. Bereits im Folgejahr wurden regierungsseitig erste Edikte erlassen, um Leerverkäufe zu regulieren – und weitere sollten in den darauffolgenden Jahrhunderten folgen. Short Selling ist also keineswegs ein Phänomen jüngerer Vergangenheit bzw. „modern“.
Inhaltsverzeichnis
- Begriffsbestimmung von „Short Selling“
- Definition und Entstehungsgeschichte
- Einsatzmöglichkeiten des Short Selling
- Relevanz von Leerverkäufen für die Kapitalmärkte
- Die Rolle des Short Selling im Rahmen von Überbewertungen
- Beitrag zur von Leerverkäufen zur Volatilität an den Kapitalmärkten
- Risiken des Short Sellings
- Die Rolle von Leerverkaufsverboten und deren Berechtigung
- Ursachen und erhoffte Auswirkungen von Verboten
- Verbote in der jüngeren Vergangenheit und Begründung für ebenjene
- Wirksamkeit von Leerverkaufsverboten
- Abschließende Beurteilung der Regulierungen und Verbote
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit analysiert das "Short Selling" (Leerverkauf) und dessen Regulierung an den Kapitalmärkten. Sie untersucht die Mechanismen des Short Selling, seine Bedeutung für die Marktbewertung und -volatilität, sowie die Wirksamkeit und Berechtigung von Leerverkaufsverboten.
- Definition und historische Entwicklung von Short Selling
- Einsatzmöglichkeiten von Short Selling als Spekulations- und Absicherungsinstrument
- Der Einfluss von Short Selling auf die Kursentwicklung und Marktstabilität
- Analyse der Gründe für und die Auswirkungen von Leerverkaufsverboten
- Bewertung der Effektivität von Regulierungsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Begriffsbestimmung von „Short Selling“: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Short Selling" als den Verkauf von Wertpapieren, die der Verkäufer zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht besitzt. Es erläutert die Unterscheidung zwischen gedeckten und ungedeckten Leerverkäufen und beschreibt die historische Entwicklung, beginnend mit den ersten dokumentierten Leerverkäufen im 17. Jahrhundert durch Isaac Le Maire mit Anteilspapieren der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Die frühen Regulierungsversuche werden erwähnt, um zu betonen, dass Short Selling kein rein modernes Phänomen ist. Der Fokus liegt auf der Erklärung des Mechanismus und der historischen Einordnung des Konzepts.
Relevanz von Leerverkäufen für die Kapitalmärkte: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Leerverkäufen für die Kapitalmärkte. Es untersucht die Rolle des Short Selling bei der Korrektur von Überbewertungen und dessen Einfluss auf die Marktvolatilität. Zusätzlich werden die Risiken des Short Selling für Anleger detailliert dargestellt und analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf der ambivalenten Rolle des Short Selling: Einerseits kann es zu einer effizienteren Preisfindung beitragen, andererseits birgt es auch das Risiko von starken Kursschwankungen und potenziellen Marktmanipulationen.
Die Rolle von Leerverkaufsverboten und deren Berechtigung: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen und die angestrebten Auswirkungen von Leerverkaufsverboten. Es untersucht konkrete Beispiele für Verbote in der jüngeren Vergangenheit und deren jeweilige Begründungen. Ein wichtiger Aspekt ist die kritische Auseinandersetzung mit der Wirksamkeit solcher Verbote. Die Zusammenfassung würde die unterschiedlichen Argumente für und gegen Verbote gegenüberstellen und eine abschließende Bewertung der Regulierungsansätze liefern, ohne jedoch eine endgültige Schlussfolgerung zu präsentieren.
Schlüsselwörter
Short Selling, Leerverkauf, Kapitalmärkte, Marktvolatilität, Überbewertung, Hedging, Regulierung, Leerverkaufsverbote, Marktstabilität, Risikomanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Short Selling und dessen Regulierung an den Kapitalmärkten
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit analysiert das "Short Selling" (Leerverkauf) und dessen Regulierung an den Kapitalmärkten. Sie untersucht die Mechanismen des Short Selling, seine Bedeutung für die Marktbewertung und -volatilität, sowie die Wirksamkeit und Berechtigung von Leerverkaufsverboten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und historische Entwicklung von Short Selling, seine Einsatzmöglichkeiten als Spekulations- und Absicherungsinstrument, den Einfluss auf die Kursentwicklung und Marktstabilität, die Gründe für und Auswirkungen von Leerverkaufsverboten sowie eine Bewertung der Effektivität von Regulierungsmaßnahmen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: 1. Begriffsbestimmung von „Short Selling“, 2. Relevanz von Leerverkäufen für die Kapitalmärkte, und 3. Die Rolle von Leerverkaufsverboten und deren Berechtigung. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten und endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Was wird im Kapitel „Begriffsbestimmung von „Short Selling““ erläutert?
Dieses Kapitel definiert "Short Selling", beschreibt die Unterscheidung zwischen gedeckten und ungedeckten Leerverkäufen, erläutert die historische Entwicklung (beginnend mit Beispielen aus dem 17. Jahrhundert) und die frühen Regulierungsversuche. Der Fokus liegt auf der Erklärung des Mechanismus und der historischen Einordnung.
Welche Rolle spielt Short Selling laut der Arbeit für die Kapitalmärkte?
Das Kapitel "Relevanz von Leerverkäufen für die Kapitalmärkte" untersucht die Bedeutung von Short Selling bei der Korrektur von Überbewertungen und dessen Einfluss auf die Marktvolatilität. Es werden auch die Risiken für Anleger detailliert dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der ambivalenten Rolle: effizientere Preisfindung versus Risiko von starken Kursschwankungen und Marktmanipulationen.
Was wird im Kapitel über Leerverkaufsverbote analysiert?
Das Kapitel "Die Rolle von Leerverkaufsverboten und deren Berechtigung" analysiert die Ursachen und angestrebten Auswirkungen von Leerverkaufsverboten. Es untersucht konkrete Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, deren Begründungen und die Wirksamkeit solcher Verbote. Es werden Argumente für und gegen Verbote gegenübergestellt und eine Bewertung der Regulierungsansätze gegeben, ohne eine endgültige Schlussfolgerung zu präsentieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Short Selling, Leerverkauf, Kapitalmärkte, Marktvolatilität, Überbewertung, Hedging, Regulierung, Leerverkaufsverbote, Marktstabilität, Risikomanagement.
Wo finde ich weitere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die detaillierten Informationen zu jedem Kapitel finden sich im Hauptteil der Studienarbeit, die ein Inhaltsverzeichnis mit Unterpunkten zu jedem Kapitel enthält.
- Quote paper
- Oliver Komaromy (Author), 2021, “Short Selling” (Leerverkauf). Kritische Beurteilung von Verboten und Einschränkungen an Kapitalmärkten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1045124