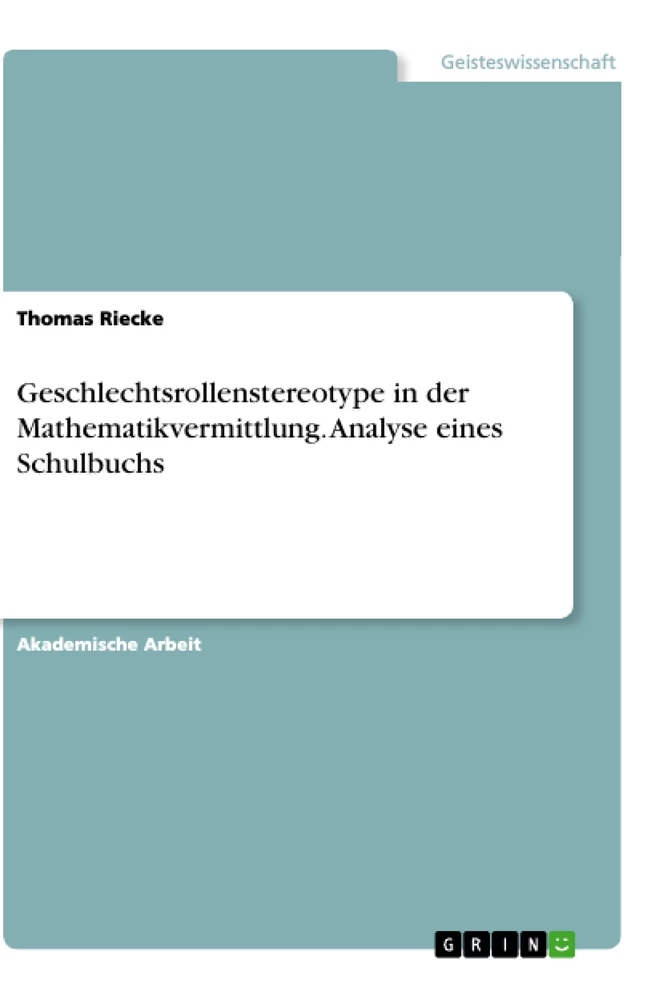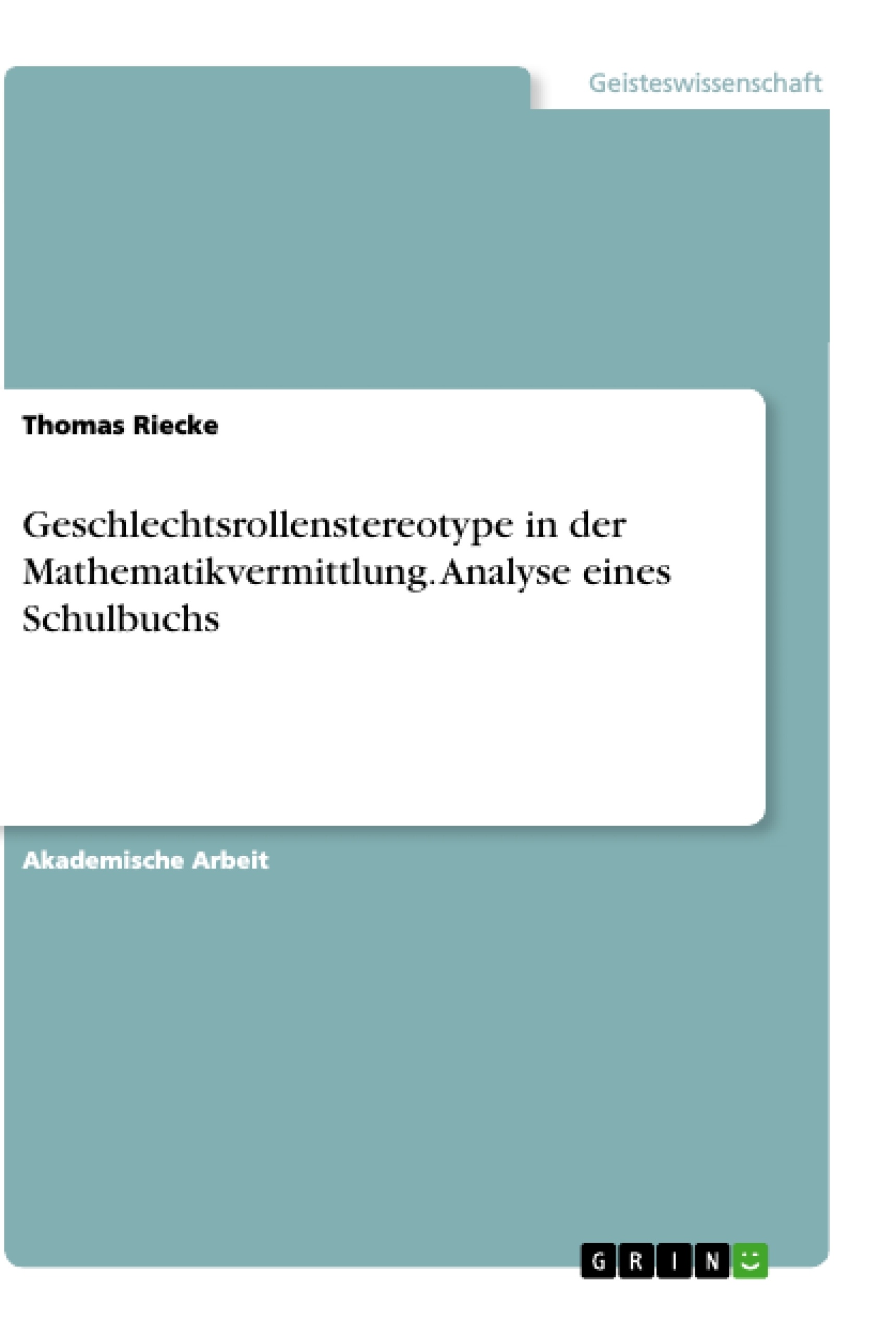So wichtig es auch sein mag, Kinder durch ansprechende Bilder und Texte zu motivieren und auf diesem Weg für die Mathematik zu begeistern, liegt wohl gerade darin die Ursache für Rollenstereotype, von denen sich auch ein
Mathematikschulbuch nicht lossagen kann.
Aus diesem Grund soll im Folgenden das Mathematikschulbuch „Nussknacker 4“des Oldenburg Verlags untersucht werden. Geprüft wird, ob es sich bei dem Mathematikschulbuch um einen sozial freien Raum handelt. Bereits die Thematisierung dieser Problematik evoziert ein aktives Konstruieren von Unterschieden. An die Geschlechtsforschung wird häufig der Vorwurf herangetragen, dass sie bereits bei der Datenerhebung Geschlechtsstereotype impliziere, die sich dann logischerweise auch in den Ergebnissen wiederfänden. Forschung selbst reifiziert Zuschreibungen und Kategorien, auch wenn es ihr eigentliches Anliegen ist, genau diese zu überwinden. Gadamer weist auf eine
weitere Problematik hin, nämlich dass die moderne Wissenschaft der Aufklärung alles umfassend, vernünftig und vorurteilsfrei verstehen will.
Somit ist nicht die Überlieferung, sondern die Vernunft letzte Quelle der Autorität. Ihr werden andere Autoritäten untergeordnet. Doch absolute Vernunft ist unmöglich, da auch der freieste Geist begrenzt ist und von Vorurteilen geprägt
wird. Ein menschlicher Geist kann niemals eine allumfassende Wahrheit erfahren oder begreifen.
Zur Vermeidung der eben genannten Problematik sollen in dieser Arbeit zunächst die objektiven Sachverhalte durch quantitative Messverfahren dargestellt und anschließend ausgewertet werden. Hierfür soll im ersten Teil der Arbeit zunächst eine Begriffsbestimmung und Fundierung des Sachverhalts vorgenommen werden. In einem weiteren Schritt soll das entwickelte Erhebungsinstrument genauer vorgestellt werden.
Es folgt die Darstellung, die Analyse und die Interpretation der Untersuchung. Hierbei werden zunächst die Texte und anschließend die Bilder des vorliegenden Schulbuchs nach einer quantitativen Methode untersucht. Im dritten Teil sollen
schließlich die Erkenntnisse der Untersuchung zusammengetragen werden und mit bereits bestehenden Studien verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Überblick
- Begriffsbestimmung
- Konstrukt der Stereotype
- Konstrukt der Geschlechtsrollen
- Konstrukt der Geschlechtsrollenstereotype
- Funktion und Folgen von Geschlechtsrollenstereotypen
- Stand der Forschung
- Inhaltliche Bedeutung der Geschlechtsrollenstereotype
- Beständigkeit bestehender Stereotype
- Analyse des Archivals
- Entwicklung eines inhaltsanalytischen Kategorienschemas
- Aufgaben in Textform
- Darlegung und Analyse der Texte
- Verdichtung und Interpretation der Ergebnisse
- Abbildungen
- Darlegung und Analyse der Abbildungen
- Verdichtung und Interpretation der Ergebnisse
- Erkenntnisgewinn aus den Analysen und Interpretationen
- Verortung der Ergebnisse bei Eagly
- Methodologisch- kritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Mathematikbuch „Nussknacker 4“ des Oldenburg Verlags und beleuchtet die Frage, ob dieses Schulbuch frei von Geschlechtsrollenstereotypen ist. Dabei wird ein sozialisationstheoretischer Ansatz verfolgt, der die Frage nach dem Einfluss von Schulbüchern auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Kindern in den Vordergrund stellt.
- Die zahlenmäßige Repräsentation von männlichen und weiblichen Handlungsträgern im Schulbuch
- Die Art und Weise, wie die Handlungsträger in Texten und Bildern dargestellt werden
- Die Auswirkungen von Rollenstereotypen auf die Sozialisation von Kindern
- Der Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden Studien zur Schulbuchanalyse
- Die Anwendung der sozialen Rollentheorie von Eagly auf das Schulbuch „Nussknacker 4“
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Problemstellung der Geschlechtsrollenstereotype in der heutigen Gesellschaft aufgezeigt. Es werden aktuelle Studien und Statistiken, wie die Ergebnisse der PISA-Studie, herangezogen, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen. Im zweiten Kapitel erfolgt eine Begriffsbestimmung von zentralen Begriffen wie Stereotypen, Vorurteilen und Geschlechtsrollen. Dabei werden verschiedene Definitionsansätze aus der Sozialpsychologie und der Soziologie betrachtet und eine Arbeitsdefinition für die vorliegende Arbeit erarbeitet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse des Schulbuchs „Nussknacker 4“ anhand eines entwickelten Kategorienschemas. Die Ergebnisse der quantitativen Analyse werden anhand von Tabellen und Grafiken dargestellt und mit den Ergebnissen bisheriger Schulbuchanalysen verglichen. Im vierten Kapitel wird das Bildmaterial des Schulbuchs untersucht. Hierbei werden die Anzahl und Art der Abbildungen, die zahlenmäßige Repräsentation der Handlungsträger, die Darstellung von Kleidung und Frisur sowie die verbalen Äußerungen der Handlungsträger analysiert.
Das fünfte Kapitel fasst die Erkenntnisse aus den Analysen zusammen und verortet die Ergebnisse in der sozialen Rollentheorie von Eagly. Es wird diskutiert, inwieweit das Schulbuch „Nussknacker 4“ traditionelle Rollenstereotype fördert oder diese durchbricht. Das sechste Kapitel bietet eine methodologisch- kritische Reflexion der Untersuchung. Es werden die Stärken und Schwächen der gewählten Methode diskutiert und die Relevanz der Untersuchungsergebnisse für die Gleichstellung von Mann und Frau in der Bildungspraxis beleuchtet.
Schlüsselwörter
Geschlechtsrollenstereotype, Schulbuchanalyse, Sozialisation, Geschlechtsidentität, soziale Rollentheorie, Eagly, quantitative Analyse, Genderthematik, Gleichstellung, Bildungspraxis, PISA-Studie, Mathematikbuch.
Welches Schulbuch wird in der Arbeit analysiert?
Untersucht wird das Mathematikschulbuch „Nussknacker 4“ des Oldenburg Verlags.
Was ist das Ziel der Untersuchung?
Es soll geprüft werden, ob das Schulbuch frei von Geschlechtsrollenstereotypen ist oder ob es traditionelle Rollenbilder reifiziert.
Welche Methode wurde für die Analyse gewählt?
Es wurde eine quantitative Inhaltsanalyse für Texte und Bilder sowie ein qualitativer Vergleich mit bestehenden Studien durchgeführt.
Was besagt die soziale Rollentheorie von Eagly?
Die Theorie besagt, dass Geschlechterunterschiede aus den sozialen Rollen resultieren, die Männern und Frauen in der Gesellschaft zugewiesen werden.
Warum ist die Darstellung in Schulbüchern für Kinder wichtig?
Schulbücher sind Teil des Sozialisationsprozesses und beeinflussen die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Kindern maßgeblich.
- Citar trabajo
- Thomas Riecke (Autor), 2014, Geschlechtsrollenstereotype in der Mathematikvermittlung. Analyse eines Schulbuchs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1045493