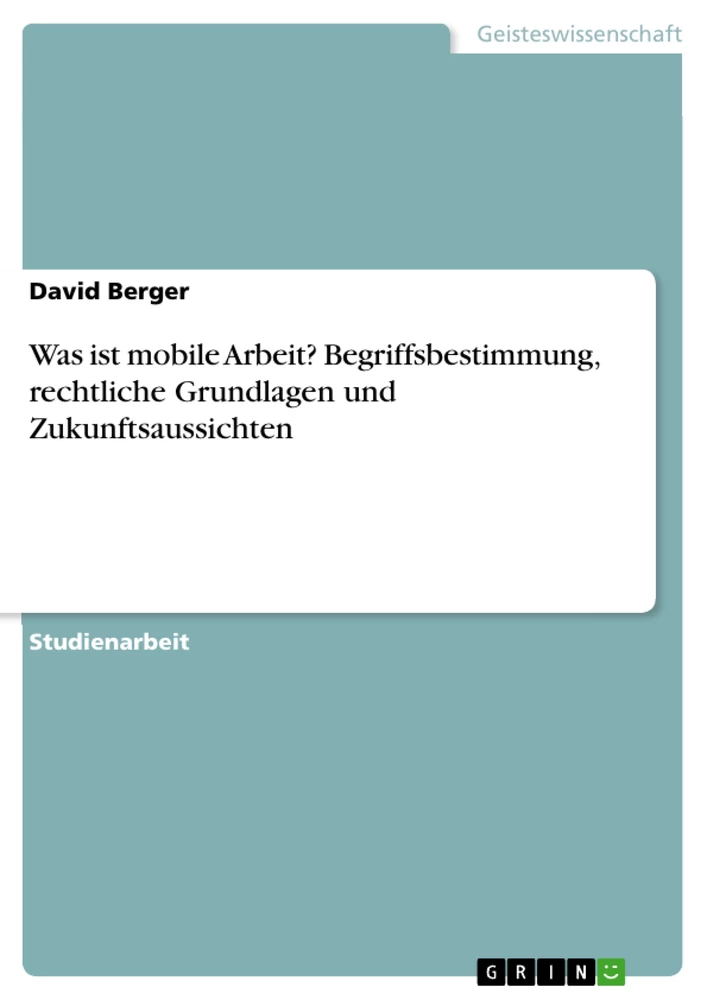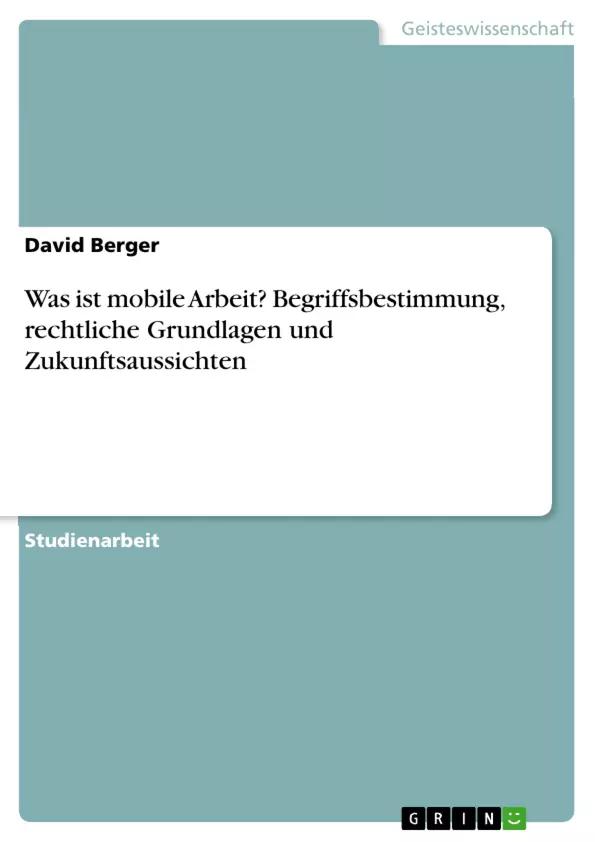Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der neuen Form der mobilen Arbeit. Nach einer einführende historischen Herleitung des Begriffs erfolgt im nächsten Teil der Versuch einer Definition sowie eine Erläuterung der rechtlichen Grundlagen der sozialen Arbeit. Ebenso werden anschließend mögliche gesundheitliche Folgen beleuchtet, bevor abschließend eine Prognose über die Zukunft der mobilen Arbeit abgegeben wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mobilitätsbegriffe der empirischen Arbeitsmarktforschung
- Versuch einer Definition des Begriffs Mobile Arbeit
- Rechtliche Grundlagen für mobile Arbeit
- Gesundheitliche Auswirkungen von mobiler Arbeit
- Mobile Arbeit in der Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Begriff der Mobilen Arbeit und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Zunahme ortsunabhängiger Arbeitsformen verbunden sind. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung von der Telearbeit zum Homeoffice hin zu modernen Konzepten wie dem »Digitalen Nomaden«.
- Entwicklung und Definition des Begriffs "Mobile Arbeit"
- Rechtliche und gesundheitliche Aspekte der Mobilen Arbeit
- Die Rolle der Digitalisierung und neuer Technologien
- Zusammenhänge zwischen Mobilität und Flexibilität im Arbeitsmarkt
- Zukunftsperspektiven und Herausforderungen der Mobilen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die historische Entwicklung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsformen dar, beginnend mit den »gelernte[n] Jägern und Sammler[n]« unserer Vorfahren bis hin zur Entstehung des modernen Arbeitswegs im Zuge der Industrialisierung. Die Bedeutung des Pendelns und seine negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität werden beleuchtet. Die Entstehung der Telearbeit und des Homeoffice sowie die zunehmende Relevanz des Begriffs »Mobile Arbeit« werden im Kontext der wachsenden Digitalisierung dargestellt.
Mobilitätsbegriffe der empirischen Arbeitsmarktforschung
Das Kapitel erläutert verschiedene Mobilitätsbegriffe der empirischen Arbeitsmarktforschung, wie z. B. »Flexibilität«, »Pendelmobilität« und »Wandermobilität«. Es wird dargestellt, wie sich der Begriff »Mobile Arbeit« von diesen Begriffen unterscheidet und in der Literatur vielfältig interpretiert wird.
Versuch einer Definition des Begriffs Mobile Arbeit
Das Kapitel geht der Frage nach, wie der Begriff »Mobile Arbeit« definiert werden kann. Es werden verschiedene Definitionen aus der Literatur vorgestellt, darunter die Definition der ECATT (Electronic Commerce and Telwork Trends) und die Einteilung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Die Studie der Hans Böckler Stiftung und der Forschungsbericht »Mobiles und Entgrenztes Arbeiten« der Bundesregierung werden ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Hausarbeit umfassen Mobile Arbeit, Telearbeit, Homeoffice, Digitaler Nomade, Flexibilität, Mobilität, Arbeitsmarkt, Rechtliche Grundlagen, Gesundheitliche Auswirkungen, Zukunftsperspektiven, Digitalisierung, Technologie, Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarktforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was genau ist „Mobile Arbeit“?
Mobile Arbeit bezeichnet eine ortsunabhängige Arbeitsform, die durch digitale Technologien ermöglicht wird. Sie geht über das klassische Homeoffice hinaus und umfasst auch das Arbeiten unterwegs oder an wechselnden Orten.
Was unterscheidet einen „Digitalen Nomaden“ von normaler Telearbeit?
Digitale Nomaden nutzen die totale Ortsunabhängigkeit oft weltweit, während Telearbeit meist an einen festen häuslichen Arbeitsplatz gebunden ist.
Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat mobile Arbeit?
Sie bietet Flexibilität, kann aber auch zu einer Entgrenzung von Arbeit und Privatleben führen, was Stress und psychische Belastungen begünstigen kann.
Welche rechtlichen Grundlagen sind für mobile Arbeit wichtig?
Wichtige Aspekte sind das Arbeitszeitgesetz, der Datenschutz sowie Regelungen zur Unfallversicherung und Arbeitssicherheit außerhalb des Betriebs.
Wie sieht die Zukunft der mobilen Arbeit aus?
Es wird eine weitere Zunahme flexibler Arbeitsmodelle prognostiziert, wobei die Herausforderung in der rechtlichen Ausgestaltung und dem Gesundheitsschutz liegt.
- Arbeit zitieren
- David Berger (Autor:in), 2019, Was ist mobile Arbeit? Begriffsbestimmung, rechtliche Grundlagen und Zukunftsaussichten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1046082