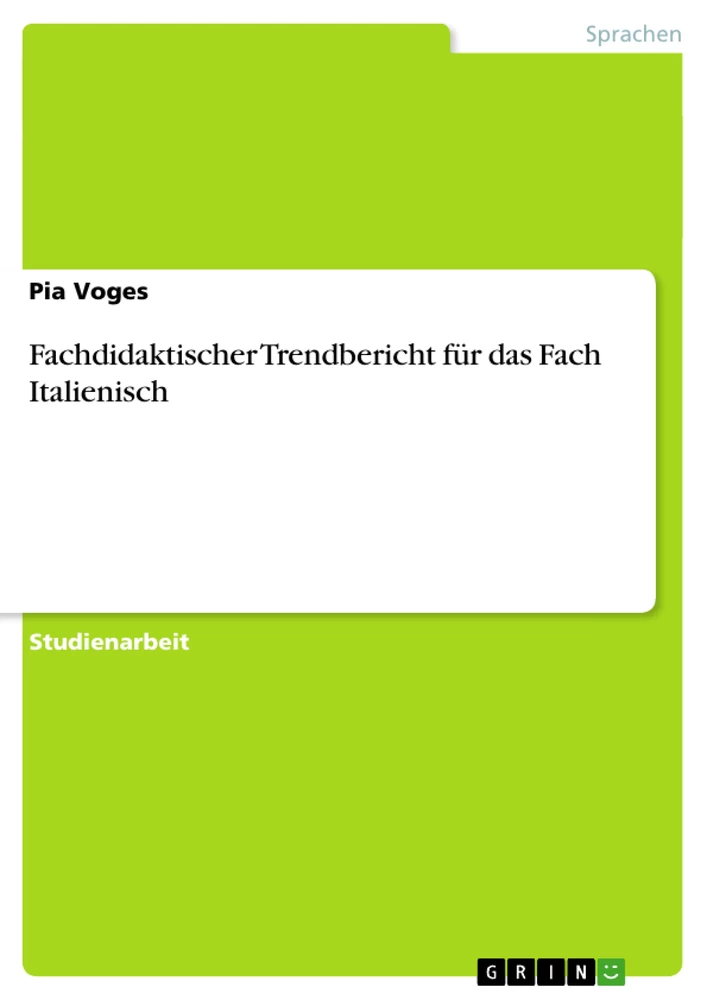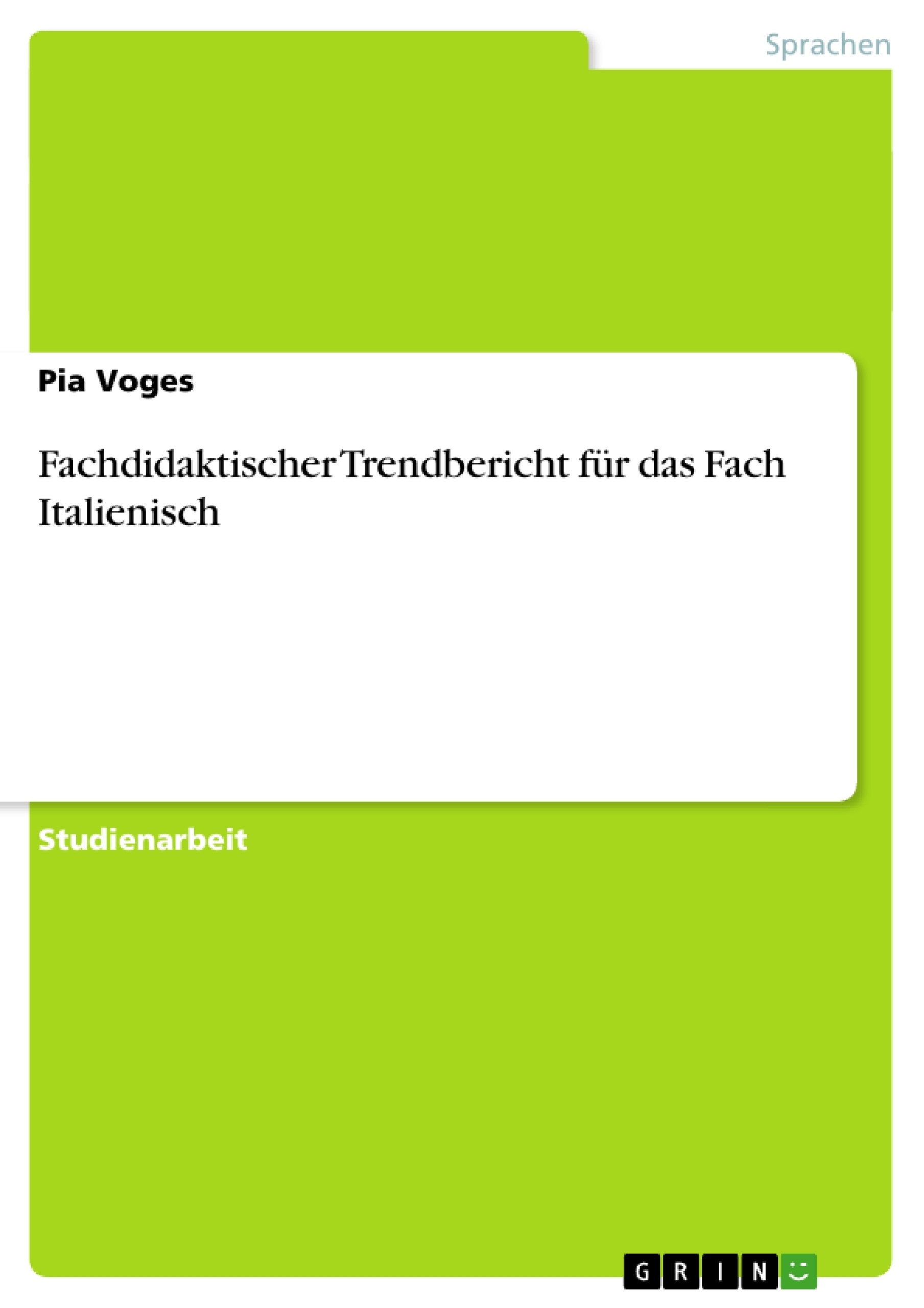Vorwort
Ich wollte mich in meiner Hausarbeit mit den fachdidaktischen Tendenzen im Fach Italienisch beschäftigen, aber das war gar nicht so einfach, wie ich anfangs dachte. Denn erstens gibt es keine spezielle Fachdidaktik für das Fach Italienisch, sondern nur eine allgemein gehaltene Fremdsprachendidaktik, und zum anderen gab es sehr wenige Veröffentlichungen in den großen Fachzeitschriften zu speziell meiner Themenstellung.
Daher war ich froh, daß ich dann doch noch auf zwei - auch noch relativ neue - Artikel gestoßen bin, die sich zumindest indirekt mit meinem Thema beschäftigen.
Zum einen handelt es sich da um einen Artikel von Volker Scherf, erschienen in den „Neusprachlichen Mitteilungen“, der ein Konzept erdacht hat, mit dem man den Rückgang der Ausbildung in den südeuropäischen Sprachen bremsen, wenn schon nicht aufhalten kann, da Italienisch und Spanisch gegenüber Französisch und Englisch in den weiterführenden Schulen kaum Gewicht hat und noch weiter verliert.
Und zum anderen fand ich einen Aufsatz von Andreas Beilmann in der „Praxis des neusprachlichen Unterrichts“, der sich mit der Projektmethode auf einer Studienfahrt beschäftigt hat, zwar im Fach Englisch, aber ich habe mir die Freiheit genommen, dieses Beispiel auf mein Fach passend umzuarbeiten und für den fächerübergreifenden Aspekt um einen zweiten Kurs, der mitfährt, zu erweitern.
1 Ein Sprachentandem „Italienisch plus Spanisch“ als zweite oder dritte Fremdsprache
1. 1 Die momentane Situation
Aufgrund der Tatsache, daß in den Gymnasien der Bundesrepublik im Schuljahr 1985/86 zwar 1,8 Millionen Schüler Englisch und mehr als 850 000 Französisch lernten, aber nur ca. 31 000 Spanisch und 13 000 Italienisch, müssen zur Verbreitung des Angebots durchaus neue Wege beschritten werden. Das Argument zugunsten von Französisch, mehr Lerner brächten auch mehr Völkerverständigung mit den südeuropäischen Ländern, ist ein Schlag ins Gesicht von 94 Millionen Italienern und Spaniern, ganz abgesehen von den übrigen südeuropäischen Ländern wie Portugal und Griechenland.
Es besteht zwar die Möglichkeit, auf Antrag beim Kultusministerium Italienisch und/oder Spanisch bereits ab Klasse 9 unterrichten zu dürfen (bisher waren beides neu einsetzende Sprachen ab Klasse 11), was aber eher eine Alibifunktion erfüllt als ein echter Ansatz ist, wobei es sowieso meistens an einer Schule nur eine der beiden Sprachen als Unterrichtsfach gibt, da die Schüler in der Oberstufe nur eine neue Sprache anwählen können, sich also sowieso entscheiden müßten (Bei mir an der schule war es zwar möglich , sich zwischen vier Sprachen zu entscheiden, die ab Klasse 11 neu einsetzen, aber auch nur, weil wir in meiner Heimatstadt vier Innenstadtgymnasien hatten, die miteinander kooperierten und auf diese Weise das Fächerangebot vervielfachten, nicht nur im sprachlichen Bereich.).
Denn mittlerweile befinden sich die geburtenschwachen Jahrgänge in der Mittel- und Oberstufe, was dazu führt, daß das Interesse an Italienisch oder Spanisch eher noch geringer wird, auf jeden Fall aber nicht relevant zunimmt. Das wiederum wird dazu führen, daß die beiden Sprachen nicht mehr durchgängig in jedem Jahrgang angeboten werden und gar nicht mehr werden können, zumal die Gefahr besteht, daß sie ganz aus dem Lehrplan herausfallen, wenn die Schulzeit auf 12 Jahre verkürzt wird.
Um das Anwählen dieser Sprachen dennoch attraktiv zu gestalten und dem immer kleiner werdenden Markt an Sprachschülern einen größeren Teil abzuringen, schlägt Volker Scherf vor, aus den beiden Sprachen ein Sprachentandem „Italienisch plus Spanisch“ zu gestalten, um sie schon rein von der „Masse“, also vom Umfang her Französisch anzugleichen und sie so attraktiv zu präsentieren, daß kein Schüler und keine Schule ein schlechtes Gewissen haben muß, wenn er/sie sich für dieses Tandem anstatt für Französisch als Zweitoder Drittsprache entscheidet.
Er ist zudem der Überzeugung, beide Sprachen könnten vom positiven Image der Jeweils anderen profitieren; so gilt Italienisch im Allgemeinen ja als die schönere und bildungsintensivere Sprache, während Spanisch immer den Anklang der drittgrößten Weltsprache mitbringt und durch Lateinamerika einen Exotikbonus hat. So wäre die direkte „Konkurrenz“ beider um die Gunst der Lerner außer Kraft gesetzt und sie würden eine „Interessengemeinschaft“ bilden.
1.2 Die geplante Umsetzung
Es würde keinesfalls so aussehen, daß aus beiden Sprachen eine Mischsprache konstruiert würde, sondern eine wäre Grundlagensprache, die andere dann die aufgesetzte Sprache.
Zunächst soll der Unterricht in der Grundlagensprache normal geführt werden, nur werden in die üblichen kommunikativen Situationen möglichst viele Worte hineingemischt, die in beiden Sprachen ähnlich oder identisch sind. Nach einer Festigungsphase in der Grundlagensprache dann werden die Pendants der aufgesetzten Sprache verwendet, um die bereits bekannten kommunikativen Situationen ein zweites Mal in Teilaspekten zu formulieren. Hierzu eignet sich der in jeder neueinsetzenden Sprache auftauchende Text „Al ristorante“ vorzüglich, denn hier findet man eine Fülle von Homophonen, Homonymen und Homographen in den verschiedenen Sprachen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Und so weiter und so weiter.
Auf diese Weise sollen dann auch das Formensystem und die Wortbildung analog erschlossen werden und der Lerner ein Gefühl für Ähnlichkeiten und Unterschiede der beiden Schwesternsprachen aufbauen.
Die zweite Stufe dann schließt die in der aufgesetzten Sprache naturgemäß durch langsameren Lernfortschritt entstandenen Lücken (Wortschatz, Verbformen) und baut sie durch Vergleich und Kontrastierung soweit auf, daß beide Sprachen ein nahezu gleiches Niveau erreichen und dann die Lerner in einer dritten Stufe komplexere grammatikalische Erscheinungen gleichzeitig erlernen könnten.
Probleme könnten bei diesem Modell möglicherweise in einer Überforderung der Schüler begründet liegen; aber da das Ziel einer solchen Unterrichtsweise nicht die kommunikative Perfektion ist, sondern eher die Befähigung, sich durch die gelegten Grundsteine später jede der beiden Sprachen perfekt anzueignen, ist die übliche Leistungsbeurteilung sowieso zu modifizieren.
Scherf nennt sein neu gestaltetes Unterrichtsfach „Romanisch“.
Er hält es besonders in der Kombination mit Latein als vorher gelernter Erst- oder Zweitsprache für geeignet, da erstens so das langsam aussterbende Latein wieder erstarken könnte und gleichzeitig die vielgerühmten Strukturen des Latein den beiden modernen romanischen Sprachen von großem Nutzen sein könnte (Grammatikstrukturen, die Etymologie). Zusätzlich müßte für das so neu geschaffene Fach Romanisch eine neue Didaktik geschaffen werden, was aber die alten der reinen Einzelfächer nicht bedrohen würde, da es keine allgemeingültigen Festlegungen für die Didaktik und Methodik der einzelnen Fächer gibt, sondern nur eine unspezifische „Fremdsprachendidaktik“.
Im Anschluß an die Veröffentlichung dieses Ansatzes gab es natürlich eine Flut von Reaktionen, die aber meist negativer Natur waren, aber wohl offensichtlich eher aus dem Grund, daß das Modell ja nur längerfristig funktionieren könne und eine Menge Mehrarbeit bedeute. Aber ich möchte auf diese Reaktionen an dieser Stelle nicht eingehen, weil mir persönlich dieses Modell eigentlich sehr gut gefällt und dieser Ansatz auch der einzige kreative im Sinne von Projektunterricht, Projektarbeit und fächerübergreifendem Unterrichten ist, den es innerhalb der letzten zehn bis fünfzehn Jahre gab. Ich finde das sehr mutig und visionär von Volker Scherf, sich mit Absicht mit einem solchen Vorschlag, der nur für engagierte Pädagogen geeignet ist, an die Öffentlichkeit zu wagen und sich gegen die erwarteten und auch eingetroffenen Reaktionen zu stellen.1
2 Studienfahrt und Projektarbeit
Vorschlag für eine erlebnispädagogische Alternative
2.1 Allgemein
Ich habe in der „Praxis des neusprachlichen Unterrichts“ 1/92 den Beitrag eines Lehrers gefunden, der eine Alternative zur üblichen normalen Studienfahrt in der Stufe 12 gefunden hat. Zwar ist sein Ansatz nicht für Italienisch, sondern für Englisch und auch nicht fächerübergreifend, aber ich habe mir für diese Hausarbeit die Freiheit genommen, seinen Vorschlag für das Fach Italienisch umzuarbeiten, also anstatt nach Dublin nach Rom zu fahren und als fächerübergreifenden Aspekt noch die Begleitung durch einen Geschichtskurs einfließen zu lassen, die sich bei einem derart geschichtsträchtigen Ort ja auch durchaus anbietet.
Andreas Beilmann gliedert seine sinnvolle Verlaufsstruktur zur Realisierung in folgende 6 Phasen:
1) Animation und Ideenfindung
2) Diskussion und Entscheidung
3) Vorbereitung und Organisation
4) Durchführung
5) Dokumentation
6) Reflexion
Diese Gliederung entnahm er Konzeptionen und eigenen Erfahrungen mit der Projektmethode, gewonnen in außerschulischer Jugendarbeit.
Der nun folgende Text ist die Beilmann-Version, umgearbeitet von mir auf einen Italienisch-LK und einen begleitenden Geschichtskurs.
Die Schüler sollten an einem Wochenende die ersten beiden Phasen abschließen; den Abschluß der Entscheidungsphase würde die Aufteilung der beiden Kurse, im folgenden nur als Schülerschaft oder Kurs bezeichnet, in mehrere Kleingruppen zur Folge haben, die an 4 der 7 zur Verfügung stehenden Tagen an bestimmten Aspekten zu arbeiten hätten. In abendlichen Plenumsrunden sollten die Schüler dann ihre Erfahrungen austauschen, sich gegenseitig beraten und Schwierigkeiten beseitigen.
Die restlichen Tage dürfen die Schüler dann individuell nutzen oder auch gemeinsam gestalten
2.2 Animation und Ideenfindung
Animation kann stattfinden im Rahmen eines gemeinsamen italienischen Frühstücks, welches von einer Diashow begleitet werden kann und von bereitgestelltem Karten- und Informationsmaterial.
Dann findet eine Ideenbörse statt, bei der jede, aber auch wirklich jede Idee zunächst geäußert werden darf und auch soll, sei sie noch so abwegig, um das gesamte kreative Potential der Schülerschaft auszunutzen. Als Beispiele für die Ideenfindung sollen genannt sein
- Erkundung der römischen Spuren innerhalb Roms
- Wie leben die Römer? Und wovon?
- Auf den Spuren einer berühmten römischen Persönlichkeit (Schriftsteller)?
- Das Verhältnis zur Kirche, insbesondere unter Berücksichtigung des Vatikans
- Erfahrungen mit der Mafia
- Verhältnis von Rom zu Südtirol
- Süden gegen Norden, wirtschaftlich gesehen
- Die Bedeutung des Sports für Italiener (Ferrari und die Formel 1, Fußball)
- Traditionspflege in Italien, religiös und sozial gesehen
- Die Rolle der typisch italienischen canzone
Es gäbe sicherlich von seiten der Schüler noch eine Menge mehr Ideen, zumal Italien lange Jahre, eigentlich bis Ende der Neunziger, das beliebteste Urlaubsland der Deutschen war und erst in den letzten 2 Jahren von Spanien abgelöst worden ist und die Schüler dementsprechend viele eigene Erfahrungen mit einbringen können.
2.3 Diskussion und Entscheidung
Um diese gruppendynamisch schwierigste Phase zu erleichtern, kann man Kriterien vorgeben, nach denen die Ideen überprüft werden, wie
- Haben einige der Ideen Parallelen oder Gemeinsamkeiten?
- Lohnen die Idee und deren mögliche Ergebnisse den Aufwand?
- Ist die Idee durchführbar? Im Hinblick auf Zeit, Geld,
Verkehrsmöglichkeiten, eventuelle Ansprechpartner?
- Kann die Idee 4-5 Tage Projektarbeit füllen?
In einem Plenumsgespräch werden dann die Projekte festgelegt, die auf der Studienfahrt bearbeitet werden sollen, wobei der Projektleiter wahrscheinlich vermittelnd eingreifen muß, wenn konträre Interessen innerhalb der Schülerschaft entstehen und sich behaupten wollen.
Je nach Schülerzahl entscheidet man sich dann für 5-8 Einzelthemen, denen dann die Schüler zugeteilt werden, denn wenn sie sich selbst ihre Gruppe suchen dürfen, besteht die Gefahr, daß sie sich nach freundschaftlichen Gesichtspunkten entscheiden und nicht nach Interesse für die Themen. Außerdem besteht dabei die Gefahr, daß Außenseiter in der Kurssituation hier noch stärker ausgegrenzt werden. Jedoch muß jeder Projektleiter neu entscheiden, wie er die Gruppen bildet bzw. bilden läßt, denn jeder Kurs hat eine andere Sozialstruktur, die es zu berücksichtigen gilt.
Möglicherweise entscheiden sich meine beiden fiktiven Kurse für die Themen
- Rom - von der Entstehung bis zur Gegenwart
- Das Verhältnis von Jugend und Kirche
- Einstellungen und Erfahrungen der Bevölkerung mit der Mafia
- Die Rolle des Sports in Italien
- Der häufige Regierungswechsel in Italien seit dem zweiten Weltkrieg
- Die Rolle des Vatikan
2.4 Vorbereitung und Organisation
In der letzten Phase des Vorbereitungstreffens werden grundsätzliche Aufgaben formuliert und den Schülern übertragen, wie
- Inhalte und Ziele der Arbeit am Projekt formulieren
- Inhalte und Ziele sinnvoll strukturieren
- Wer sind die Ansprechpartner in Rom?
- Was benötigt man an Informationen, Adressen, Dokumentationsmaterial...
- Rollenverteilung: Wer in der Gruppe schreibt, wer fotografiert usw.
Die grundlegenden Informationen sollen sich die Schüler dann über öffentlich zugängliche Reiseliteratur beschaffen, zum Beispiel in den öffentlichen Bibliotheken oder über Websites im Internet, über kompetente Reisebüros, über möglicherweise bekannte aus Rom oder Umgebung stammende Personen oder über das Fremdenverkehrsamt in Rom. In Rom angekommen nutzen die Schüler dann ihre bereits gewonnenen Kenntnisse zum Einstieg in die Projektarbeit vor Ort, z.B. über Adressen von Einrichtungen oder Museen (im Falle des Geschichtskurses bzw. der Schüler, die sich mit einem geschichtlichen Thema befassen).
2.5 Durchführung
Die Studienfahrt kann mit einer Bus- oder Zugfahrt durch Italien beginnen, auf der die Schüler bereits Italiener kennenlernen können und einen ersten Eindruck von italienischer Lebensart und der Sprache bekommen.
In Rom angekommen kann man den Tag mit einer Stadtrundfahrt zur allgemeinen Orientierung beginnen, auf der die Schüler erste Stationen ihrer Projektarbeit besichtigen können, wie zum Beispiel
- das Verkehrsbüro, in dem alle Gruppen weitergehende Informationen einholen und sich beraten lassen können
- das Kolosseum, wo sich die Gruppe „Rom - von der Entstehung bis zur Gegenwart“ über die Römerzeit informieren kann
- örtliche kirchliche Jugendgruppen, bei denen sich die Gruppe „Kirche und Jugend“ über Aktivitäten und Interessen informieren kann
- ein Fußballstadion, in dem hautnah die „Rolle des Sports“ überprüft werden kann, vielleicht bei einem Heimspiel von Lazio Roma oder AS Roma, wenn die Eintrittskarten im Budget liegen
- den Regierungssitz, in dem sich die Gruppe „Regierungswechsel“ über Gründe, Regierungsparteien und Koalitionen beschaffen kann, beispielsweise wenn sie einen Abgeordneten kontaktiert.
Am Abend kann dann innerhalb der Gruppen eine erste Ergebnissammlung stattfinden. Am nächsten Tag arbeiten die Gruppen weiter an ihren am Vortag begonnenen Informationen, damit der Zusammenhang gewährleistet wird. Der dritte Tag sollte zur freien Verfügung stehen, das heißt, es sollte zwar nicht an den Themen gearbeitet werden, aber der Projektleiter könnte zwecks gemeinsamer Freizeitgestaltung einige Angebote offerieren, wie einen Tagesausflug nach Ostia oder einen Museumsbesuch; die Schüler können aber auch einfach durch die Stadt bummeln und sie für sich entdecken. Am vierten und fünften Tag wird weiter an den Einzelthemen gearbeitet, und der sechste Tag kann noch zur Hälfte zum Abschluß und zur Organisation der Projektteile genutzt werden; vielleicht werden am Abend bereits im Plenum den anderen Gruppen erste Ergebnisse vorgestellt, um einen ersten Überblick zu vermitteln.
Der siebte Tag dann dient für die Kurse noch einmal zur freien Entfaltung in der Stadt und zum Abschiednehmen von der ereignisreichen Woche, zum Shopping und Mitbringselkauf etc.
2.6 Dokumentation
Das Ziel der Dokumentation der arbeitsteilig erzielten Ergebnisse wird sein, Einsichten und Ergebnisse zu bündeln und den anderen Kleingruppen darzulegen, um mögliche inhaltliche Zusammenhänge zu verdeutlichen. Das kann auf vielerlei Arten geschehen, zum Beispiel über Diashows, Tapetenwände, karten oder selbstgeschriebene Songs.
Diese Beiträge werden im Plenum diskutiert, hinterfragt und zum Schließen von Wissenslücken verwendet, so daß am Ende alle Schüler und Betreuer auf einem Wissensstand sind.
Diese Diskussion führt auch dazu, daß die Schüler Applaus und Zustimmung für ihr Werk bekommen, was nachhaltig das Erfolgserlebnis stärkt und zu einem erhöhten Selbstbewußtsein und einem erhöhten Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten führt.
2.7 Reflexion
Um ein Feedback zur Studienfahrt zu erhalten, kann man Reflexionsbögen verteilen, die man vor der fahrt vorbereitet hat und die Schüler bitten, diese anonym auszufüllen und sie dann bei den Betreuungslehrern abzugeben. In diesem Fragebogen sollen die Schüler das Projekt als Methode zur Gestaltung der Studienfahrt bewerten und außerdem reflektieren über
- Erwartungen vor der Studienfahrt
- Inhalte, formen und Methoden der Projektvorbereitung
- Aktivitäten im Anschluß an das Projekt
- Unterkunft, Verpflegung, Organisation
- Die Gesamtwertung der Studienfahrt
Dabei sollen sie beachten, daß Reflexion
- den persönlichen Eindruck wiedergeben soll; dieser kann aber weder richtig noch falsch sein
- ihr ziel verfehlt, wenn eindrücke und Erfahrungen beschönigt oder negativ verzerrt werden. Das Kriterium „Ehrlichkeit von sich selbst“ sollte ernst genommen werden.
Das Projekt als Studienfahrtskonzept halte ich für sehr gelungen, da die Schüler sehr autonom handeln können und auch müssen. Erstens mußten sie sich für ein Thema entscheiden und dann bekamen sie auch noch die Ergebnisse nicht aus irgendwelchen texten geliefert, sondern unmittelbar durch ihre eigenen Mitschüler.
Und sie bekommen die Informationen vor Ort aus erster Hand, nicht aus Reiseführern oder ähnlichen Büchern; die Einwohner geben ihre eigenen eindrücke wieder, die oft nicht mit den „offiziellen“ Verhältnissen übereinstimmen.
Die Schüler können sich zudem infolge der vielen unterschiedlichen Meinungen ein sehr differenziertes Bild machen und müssen nicht ein vorgefertigtes übernehmen.
Die Reiseerfahrungen werden zudem quasi „zu Fuß“ erlaufen und sind somit viel unmittelbarer, als wenn sie von einem Reiseleiter dargebracht würden. Und die Italiener sind bestimmt begeistert, einer Gruppe junger Leute zu begegnen, die ihre Erfahrungen nicht auf ausgetretenen Touristenpfaden machen will, sondern eigene, authentische sammeln möchte. Sie werden sicherlich viel offener reagieren und Dinge verraten, die der Normaltourist nicht erfahren würde.
Und die Schüler erhalten erstmals eine Rückmeldung über ihr eigenes wissen, da sie in einem fremden Land in einer fremden Sprache Aufgaben zu lösen haben und so ihre fortschritte beobachten können. Zudem werden Hemmungen abgebaut, mit fremden in Kontakt zu treten, was ja unabdingbar ist, und sie erhalten Einblicke in den Lebensalltag der Römer, die unbezahlbar sind.
Sie erhalten eine Innenperspektive auf Land und Leute, die durch bloßes Zuhören und Beobachten sicherlich nicht erreichbar ist und die möglicherweise überraschend ist.2
2.8 Fazit
Projektarbeit fordert mit Sicherheit mehr soziale Kompetenz als eine normale Studienfahrt, bringt aber, wenn sie gut geplant ist und gelungen ist, eine menge mehr an Information und an Freude mit sich, oft sogar für die Betreuer, die ja sonst nur als Animateure fungieren und die Schüler wie Dompteure durch die Fahrt navigieren.
Hier sind sie vielmehr nur Vermittler, die selbst von der Projektarbeit profitieren können, nicht nur durch mehr Wissen, sondern auch durch neue Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich Gesamt gesehen bringt ein gelungenes Projekt in einem fremden Land sprachlich- kognitive und sozial-affektive Lerneffekte für alle Beteiligten.. Man erhält einen anderen Blick auf die Bewohner des Nachbarlandes, sieht teilweise sogar alte (liebgewonnene?) Klischees sich in Luft auflösen und kann sie durch echte Eindrücke ersetzen.
Ich hätte , nachdem ich jetzt einen solchen Vorschlag kenne, damals gern eine solche Studienfahrt unternommen.
Ich war mit meinem Pädagogik-LK und einem parallel liegenden Deutsch-LK in Straßburg, was auch nett war und mit Programm ausgefüllt; wir besichtigten
- die Maginot-Linie
- einige Weindörfer zwecks Weinprobe
- das Europaparlament
- die Innenstadt
- Straßburgs
- Einige Museen
und einiges mehr, was mir jetzt nach 6 Jahren nicht mehr so präsent ist. Aber eigentlich haben wir alle nur auf den Abend gewartet, den man getrennt nach Schülern und Lehrern mit seinen Freunden verbringen konnte. Uns hätte Projektarbeit sicherlich gut getan und wäre interessant gewesen.
Literatur
Beilmann, Andreas, Studienfahrt und Projektarbeit. Ein Vorschlag für eine erlebnispädagogische Alternative, in: Praxis des neusprachlichen Unterrichts, Heft 1/1992
Scherf, Volker, Ein Sprachentandem Italienisch plus Spanisch als zweite oder dritte Fremdsprache, in: Neusprachliche Mitteilungen in Wissenschaft und Praxis, Heft 43/1990
[...]
1 Entnommen aus: Scherf, Volker, „Ein Sprachentandem Italienisch plus Spanisch als zweite oder dritte Fremdsprache, in: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis“, Heft 43/1990
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit fachdidaktischen Tendenzen im Fach Italienisch, wobei die Schwierigkeit darin besteht, dass es keine spezifische Fachdidaktik für Italienisch gibt, sondern nur eine allgemeine Fremdsprachendidaktik. Der Fokus liegt auf zwei Artikeln, die indirekt mit dem Thema in Verbindung stehen.
Welche Artikel werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit bezieht sich auf einen Artikel von Volker Scherf, der ein Konzept zur Förderung südeuropäischer Sprachen vorschlägt, und einen Aufsatz von Andreas Beilmann zur Projektmethode auf einer Studienfahrt, der vom Fach Englisch auf das Fach Italienisch übertragen wird.
Was schlägt Volker Scherf zur Förderung von Italienisch und Spanisch vor?
Volker Scherf schlägt ein Sprachentandem "Italienisch plus Spanisch" vor, um die Attraktivität dieser Sprachen gegenüber Französisch und Englisch zu steigern. Er argumentiert, dass beide Sprachen vom positiven Image der jeweils anderen profitieren könnten.
Wie soll das Sprachentandem "Italienisch plus Spanisch" umgesetzt werden?
Es soll keine Mischsprache entstehen, sondern eine Sprache als Grundlage dienen, in die viele ähnliche Wörter der anderen Sprache integriert werden. Nach einer Festigungsphase werden die Pendants der aufgesetzten Sprache verwendet, um bereits bekannte kommunikative Situationen zu formulieren. Später sollen grammatikalische Erscheinungen gleichzeitig erlernt werden.
Welche Probleme könnten bei diesem Modell auftreten?
Es könnte eine Überforderung der Schüler auftreten. Da das Ziel nicht die kommunikative Perfektion ist, sondern die Befähigung, sich später beide Sprachen perfekt anzueignen, muss die Leistungsbeurteilung angepasst werden.
Was ist der Inhalt des zweiten Teils der Hausarbeit?
Der zweite Teil der Hausarbeit beschäftigt sich mit einer erlebnispädagogischen Alternative zur üblichen Studienfahrt, basierend auf einem Artikel von Andreas Beilmann. Der Vorschlag wird vom Fach Englisch auf eine Studienfahrt nach Rom im Fach Italienisch übertragen, begleitet von einem Geschichtskurs.
Welche Phasen beinhaltet die Verlaufsstruktur zur Realisierung der Projektarbeit?
Die Verlaufsstruktur umfasst die Phasen: 1) Animation und Ideenfindung, 2) Diskussion und Entscheidung, 3) Vorbereitung und Organisation, 4) Durchführung, 5) Dokumentation, 6) Reflexion.
Welche Themen könnten im Rahmen der Projektarbeit bearbeitet werden?
Beispiele für mögliche Themen sind: Erkundung der römischen Spuren innerhalb Roms, das Leben der Römer, Spuren einer berühmten römischen Persönlichkeit, das Verhältnis zur Kirche (insbesondere der Vatikan), Erfahrungen mit der Mafia, das Verhältnis von Rom zu Südtirol, die Bedeutung des Sports, Traditionspflege und die Rolle der italienischen canzone.
Wie werden die Ergebnisse der Projektarbeit dokumentiert?
Die Ergebnisse können über Diashows, Tapetenwände, Karten oder selbstgeschriebene Songs dokumentiert und im Plenum diskutiert werden.
Was ist das Ziel der Reflexionsphase?
Ziel der Reflexionsphase ist es, ein Feedback zur Studienfahrt zu erhalten. Die Schüler bewerten das Projekt als Methode und reflektieren über Erwartungen, Inhalte, Formen, Methoden der Vorbereitung, Aktivitäten im Anschluss, Unterkunft, Verpflegung, Organisation und die Gesamtwertung der Studienfahrt.
- Quote paper
- Pia Voges (Author), 2001, Fachdidaktischer Trendbericht für das Fach Italienisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104906