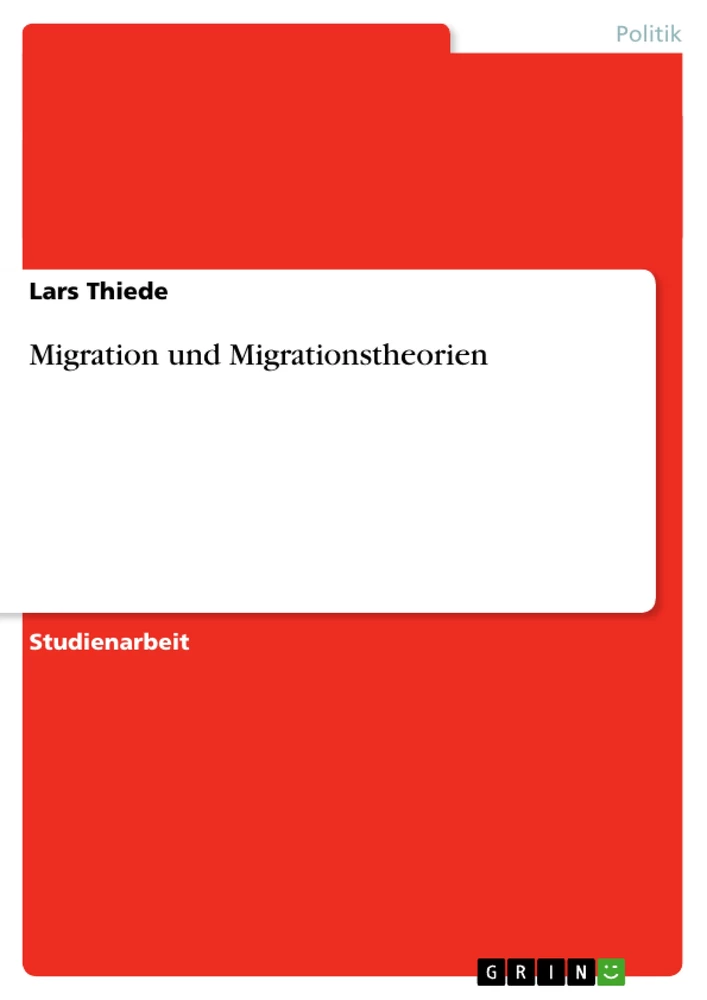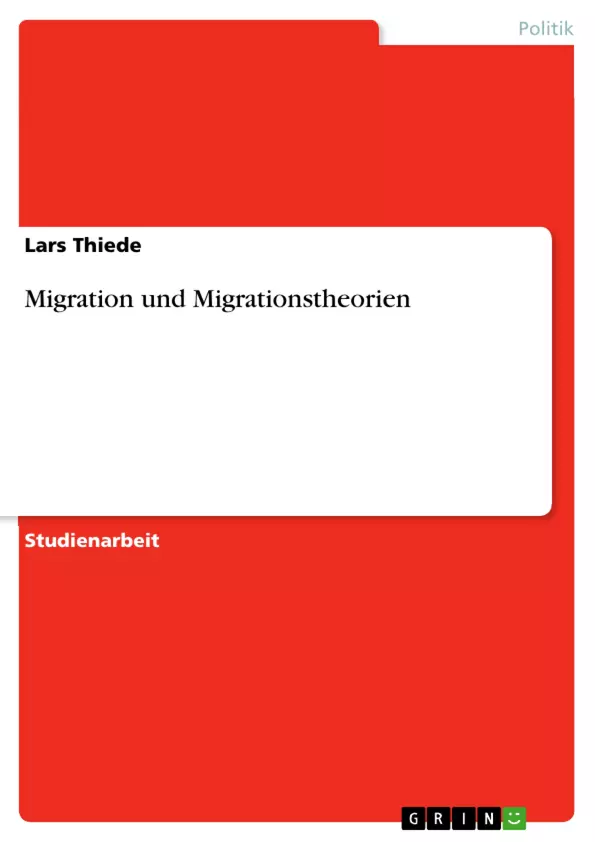Was treibt Millionen von Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen, alles aufzugeben und sich auf eine ungewisse Reise in eine fremde Zukunft zu begeben? Diese Frage steht im Zentrum dieser tiefgreifenden Analyse der komplexen Welt der Migration und Flucht. Jenseits von Schlagzeilen und politischen Debatten enthüllt dieses Werk die vielschichtigen Ursachen, von Armut und Umweltzerstörung bis hin zu Krieg und politischer Verfolgung, die Menschen zur Migration zwingen. Es werden die quantitativen und qualitativen Veränderungen in den Migrationsbewegungen beleuchtet, die Rolle des globalen Kapitalismus und die sich verändernden politischen Rahmenbedingungen untersucht. Dabei werden die wichtigsten Migrationstheorien vorgestellt, von der neoklassischen Ökonomie bis hin zu neueren Ansätzen wie der Theorie des sozialen Kapitals, der Weltsystemtheorie und den Gendertheorien, um ein umfassendes Verständnis der zugrundeliegenden Dynamiken zu ermöglichen. Ein besonderer Fokus liegt auf den transnationalen Räumen, die durch Migrationsnetzwerke entstehen, und den vielschichtigen Auswirkungen auf Herkunfts- und Zielländer. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich fundiert mit dem Thema Migration auseinandersetzen möchten, um die Realitäten hinter den Zahlen zu verstehen und Lösungsansätze zu entwickeln, die über kurzsichtige politische Maßnahmen hinausgehen. Es werden auch die ethischen Fragen der Migrationspolitik aufgeworfen und betont, dass Migration nicht primär als sicherheitspolitisches Problem, sondern als humanitäre Herausforderung betrachtet werden sollte. Abschließend werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Bekämpfung von Armut und Umweltzerstörung bis hin zur Förderung von Menschenrechten und einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung, um eine Zukunft zu gestalten, in der Migration eine Wahl und keine Notwendigkeit ist. Die Analyse der Flüchtlingsströme und Migrationsbewegungen bietet einen detaillierten Einblick in die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die diese globalen Phänomene antreiben, und fordert zu einem Perspektivwechsel auf, der die Würde und die Rechte jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stellt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Flucht und Migration
2.1. Definition des UNHCR-Flüchtlingsstatus
2.2. Die politische Dimension
2.3. Quantitative Veränderungen
2.4. Qualitative Veränderungen
2.5. Ursachen
2.6. Lösungskonzepte
3. Grundlagen der Migrationstheorie
3.1. Vorstellung einzelner Migrationstheorien
3.1.1. Theorie sozialen Kapitals
3.1.2. Neoklassische Ökonomie
3.1.3. Theorie des dualen Arbeitsmarktes
3.1.4. Neue Migrationsökonomie
3.1.5. Weltsystemtheorie
3.1.6. Migrationsnetzwerke und transnationale Räume
3.1.7. Gendertheorien
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
„Sie werden auf allen Wegen, mit allen Mitteln, unter allen Gefahren in endlosen Massen herandrängen - überallhin, wo es nur um ein geringeres besser zu sein scheint, als in ihrer Heimat. [...] Die reicheren Länder werden sich gegen diesen An- sturm zur Wehr setzen. Sie werden Befestigungsanlagen an ihren Grenzen errichten, wie sie heute nur zum Schutz von Kernkraftwerken dienen. Sie werden Mienenfelder legen und Todeszäune und Hundelaufgehege bauen.“ (vgl. Neuffer 1982: 61)
Dieses ist eines von vielen Migrations-Horrorszenarien, die in den unterschiedlichsten Publikationsorganen skizziert werden. Von Boulevardzeitungen, über wissenschaftliche Fachzeitschriften, bis hin zu ausführlichen Monographien reicht die Palette der Druckerzeugnisse, die sich mit „explosivem Bevölkerungswachstum“ und dem „Ansturm der Armen“ auf die „Festung Europa“ beschäftigen. Das Thema Migration ist ein Reizthema und schon das allein ist Grund genug, sich einmal ohne populistische Panikmache damit zu beschäftigen.
Dieser Text wird versuchen, die unterschiedlichen Facetten des Themenbereichs Migration zu strukturieren und darzustellen. Er wird dabei auf die Situation von Flüchtlingen und MigrantInnen im Spannungsfeld zwischen nationalem und internationalem Recht eingehen und sowohl qualitative als auch quantitative Veränderungen im Migrationsprozeß aufzeigen. Weiterhin wird er die wichtigsten Migrationsursachen und einige Lösungskonzepte vorstellen.
Der zweite Teil des Textes wird sich mit der Entwicklung von Theorien zur Erklärung von Migrationsbewegungen auseinandersetzten, sich mit neueren Tendenzen in der Migrationsforschung beschäftigen und die wichtigsten Migrationstheorien kurz darle- gen.
2. Flucht und Migration
Dieses Kapitel wird die verschiedenen Teilaspekte des Komplexes Flucht und Migration darstellen und versuchen, die Verbindungen, die zwischen den einzelnen Bereichen bestehen, herauszuarbeiten. So werden die juristischen Rahmenbedingungen von Flucht und Asyl, strukturelle und anhand von Zahlenmaterial quantitative Veränderungen dargestellt werden. Außerdem wird ein Überblick über das Ursachenspektrum gegeben und Lösungskonzepte zur Reduktion von Migrationsbewegungen werden vorgestellt und bewertet werden.
2.1. Definition des UNHCR-Flüchtlingsstatus
Nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist ein Flüchtling diejenige Person, „die aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtung nicht in Anspruch nehmen will.“ (vgl. UNHCR 2001)
Der Flüchtling muß diese Verfolgung im potentiellen Zielland im Normalfall nicht beweisen, aber er muß glaubhaft machen können, daß diese Verfolgung wahrscheinlich ist und ihn individuell betrifft.
Der UNHCR-Flüchtlingsstatus und der damit verbundene Schutz gilt faktisch nicht für:
- Menschen die fliehen mußten, sich aber noch innerhalb ihres Heimatlandes be- finden (Binnenvertriebene)
- Kriegs und Bürgerkriegsflüchtlinge l Kriegsdienstverweigerer
- Menschen die vor Milizen, Rebellen und/oder anderer nichtstaatlicher Verfolgung fliehen
- Menschen die vor sexueller Gewalt fliehen
- Menschen die wegen ihres Geschlechts verfolgt werden
- Menschen die wegen ihrer sexuellen Neigungen verfolgt werden
Eine sehr große Gruppe von Flüchtlingen erhält also den offiziellen Flüchtlingsstatus nicht, obwohl sich ihre Fluchtgründe nicht oder nur in geringem Maße von denen offi- ziell anerkannter Flüchtlinge unterscheiden. Vor allem die Frage, ob Menschen die vor nichtstaatlicher und/oder geschlechtsspezifischer Verfolgung fliehen den Flücht- lingsstatus erhalten sollen, ist zwischen UNHCR und manchen Einzelstaaten umstrit- ten. Besonders Deutschland und andere westeuropäische Staaten erkennen diese Fluchtgründe entgegen den UNHCR-Empfehlungen nicht an. (UNHCR 2001, Sunjic 2000: 148f)
2.2. Die politische Dimension
Die in der Einleitung skizzierte Art und Weise der Beschäftigung mit dem Thema Migration zeigt, daß eine Verschiebung bei der Betrachtung dieses Politikbereichs stattgefunden hat. Migration ist nicht mehr länger ein humanitäres, sondern primär ein sicherheitspolitisches Thema. So wurden z.B. im Weißbuch 1994 des Bundesverteidigungsministeriums Flüchtlingsströme in die Liste neuer, unkalkulierbarer Risiken eingereiht. (Rheims 1997: 114, Nuscheler 1995: 25)
Dieses zeigt, daß Migration und besonders Einwanderung häufig als unerwünscht und/oder sogar gefährlich angesehen werden. Dementsprechend besteht neben dem allgemein anerkannten Menschenrecht auf Auswanderung, anders als im 19. Jahrhundert, kein Recht auf Einwanderung mehr. Schlagworte wie „allgemeine Reisefreiheit“, die jahrzehntelang als politische Waffe gegen die Warschauer Pakt-Staaten benutzt wurden, werden heute nur noch als Gefahr für das nationale Wohlstandsniveau angesehen. (Nuscheler 1995: 32, 39)
Während Kapital, Waren, Dienstleistungen und Informationen global und ohne grö- ßere Hindernisse transferiert werden können, wird Menschen und damit auch Ar- beitskräften diese Freizügigkeit verwehrt. (Massey 2000: 62) MigrantInnen sind so zwischen zwei gegenläufigen Entwicklungen gefangen. Einerseits verstärkt und be- schleunigt die Weltwirtschaft den Transfer von Kapital und Waren und erzeugt immer mehr Migration. Andererseits verschärfen die Einzelstaaten ihre Einwanderungsge- setzgebungen und schotten ihre Grenzen immer perfekter ab. (Sunjic 2000: 153) Ausnahmen werden dabei nur für international gesuchte, hochqualifizierte Fachkräfte gemacht, die häufig aktiv angeworben werden (Green Card). (Hödl 2000: 16)
Diese Verringerung legaler Einreisemöglichkeiten in die Industrieländer, vor allem durch die Verschärfung der Asylgesetzgebungen, führte zu einem starken Anstieg irregulärer („illegaler“) Migration. Inzwischen wird davon ausgegangen, daß es weltweit genauso viele irreguläre wie reguläre MigrantInnen gibt. (Hödl 2000: 17) Allein in den USA wird ihre Zahl auf ca. 10 Mio. geschätzt. (Nuscheler 1995: 30)
2.3. Quantitative Veränderungen
Bei der quantitativen Betrachtung von Migrationsbewegungen wird häufig die These aufgestellt, daß das Ende des 20. und der Beginn des 21. Jahrhunderts das „Zeitalter der Migration“ sei. (Hödl 2000: 9) Stichhaltige Belege sowohl für, als auch gegen diese These sind allerdings nur schwer zu erbringen, da die Zahlen- und Datenlage äußerst unübersichtlich und widersprüchlich ist. Es fehlt an vollständigen Statistiken und vor allem an international einheitlichen Erfassungs- und Definitionskriterien. So zählt z.B. in Deutschland jeder Zuzug als Einwanderung, während in Frankreich die Mindestaufenthaltsdauer um in die Statistik aufgenommen zu werden drei Monate und in Großbritannien sogar ein Jahr beträgt. Zusätzlich ist die Einbeziehung der A- sylbewerberInnenzahlen uneinheitlich. (Rheims 1997: 98)
Trotz aller statistischen Probleme kann man davon ausgehen, daß es in absoluten Zahlen noch nie so viele MigrantInnen wie zur Zeit gegeben hat. Während es 1965 weltweit ca. 75 Mio. waren, lebten 1990 insgesamt ca. 100-120 Mio. Menschen au- ßerhalb ihres Heimatlandes. (Asien, Naher Osten, Nordafrika ca. 36 Mio., Europa ca. 23 Mio., Nordamerika ca. 20 Mio., Sub-Sahara Afrika ca. 10 Mio., Lateinamerika ca. 6 Mio., Ozeanien ca. 4 Mio.) (Pries 1997: 15) Dieses entspricht einer Steigerung um ca. 60% in 25 Jahren. (siehe Anhang) Im Durchschnitt betrug die Steigerung damit ca. 1,9% jährlich. (Hödl 2000: 9)
Wenn man diese Steigerung allerdings mit dem zwischen 1965 und 1990 weltweit durchschnittlich ca. 1,8% pro Jahr betragenden Bevölkerungswachstum in Relation setzt, ist das Ergebnis weit weniger beeindruckend. Der Anteil der MigrantInnen an der Weltbevölkerung ist nämlich nur von ca. 2,1% im Jahr 1965, auf ca. 2,3% im Jahr 1990 und geschätzte 2,5% im Jahr 2001 gestiegen. In diesen Zahlen sind zwar die MigrantInnen enthalten, bei denen Grenzen über Menschen gewandert sind (ehema- lige Sowjetunion, ehemaliges Jugoslawien), jedoch keine irregulären oder Binnen- migrantInnen. Dieses Beispiel zeigt noch einmal, wie viele Faktoren bei der Datener- fassung eine Rolle spielen und wie schwierig es dadurch ist, aussagekräftige Zahlen zu erhalten. (Hödl 2000: 9f)
Der Großteil der ca. 100-120 Mio. MigrantInnen sind ArbeitsmigrantInnen (ca. 30-35 Mio.) und deren Familienangehörige (ca. 40-50 Mio.). Ebenfalls bemerkenswert hoch ist die Zahl der BinnenmigrantInnen, deren Zahl seit Mitte der 80er Jahre sehr stark ansteigt. So waren es 1985 nur ca. 3 Mio., 1995 aber schon ca. 30 Mio. Menschen, die zwar innerhalb ihres Heimatlandes, aber außerhalb ihrer Heimatregion lebten. (Afrika ca. 16 Mio., Asien ca. 7 Mio., Europa ca. 5 Mio.) (Rheims 1997: 98-100) Ab- schließend ist anzumerken, daß trotz der hohen absoluten Zahlen nur relativ wenige Menschen aus einer kleinen Zahl von Ländern migrieren. (Faist 1997: 63)
2.4. Qualitative Veränderungen
Kurz nach dem Ende des Ost-West-Konflikts bestand die Hoffnung auf eine Verringerung der Zahl von Kriegen und Bürgerkriegen und damit auf einen weltweiten Rückgang der Flüchtlingszahlen. Statt dessen trat jedoch das Gegenteil ein, da der durch die Blockbildung entstandene Stabilitätsfaktor weggefallen war. Außerdem sank auf Seiten der USA und anderer westlicher Staaten das Interesse und die Bereitschaft in regionale Konflikte regelnd einzugreifen. Ein weltweiter Anstieg der Flüchtlingszahlen war die Folge. (Opitz 1994: 52f)
Neben den oben beschriebenen, quantitativen Veränderungen ist auch eine qualitati- ve Veränderung im Migrationsprozeß festzustellen. Während Migration bisher im Normalfall einmalig und damit unidirektional stattfand, wandern Menschen nun häufig zeitlich befristet und mehrere Male. Es kommt zu einer Entkoppelung von geographi- schem (Nationalstaat) und sozialem Raum (Lebensbereich einer ethnischen Gruppe) und damit zum Entstehen sogenannter transnationaler Räume. (Pries 1997:16-18) Viele Länder sind gleichzeitig Ursprung und Ziel von Migrationsbewegungen. Wäh- rend Teile der Bevölkerung auf der Suche nach Arbeit auswandern, wandern andere Menschen in die Region ein. (Reims 1997: 98, Nuscheler 1995: 30) (z.B. Deutsch- land-Polen-Weißrußland, USA-Mexiko-übriges Lateinamerika) Ca. 2/3 von Flucht und Migration finden sowieso in der armen und ärmsten Ländern der Welt statt
(Rheims 1997: 102, Straubhaar 1994: 71) und nur 5% der Menschen mit UNHCR-
Flüchtlingsstatus haben Europa erreicht. (Nuscheler 1995: 24)
Im Idealfall läßt sich Migration nach fünf Kriterien unterteilen:
(1) Raum (innerstaatlich - grenzüberschreitend)
(2) Zeit (befristet - dauerhaft)
(3) Ursache (freiwillig - erzwungen)
(4) Umfang (Einzel - Gruppen - Massen)
(5) Rechtsstatus (regulär - irregulär)
Alle diese Unterteilungen können aber im Einzelfall häufig nicht eindeutig getroffen werden. Grenzen können sich verschieben, die Dauer der Migration kann sich än- dern oder es bestehen unterschiedliche Erwartungen bei MigrantIn und Zielland und bei der Motivation liegt meist eine Mischung mehrerer Ursachen vor. Der Umfang kann sich im Laufe der Zeit genau wie der Rechtsstatus beträchtlich ändern. (Wald- rauch 1995: 32f)
Besonders bei den Ursachen von Flucht und Migration hat eine Ausdifferenzierung der Gründe stattgefunden. (Rheims 1997: 99) Nur noch im theoretischen Idealfall lassen sich freiwillige Arbeitsmigration und Flucht vor Gewalt trennen. Meistens liegt eine Mischung verschiedener Gründe vor, da ökonomische Ursachen im Normalfall eine notwendige, aber noch keine hinreichende Motivation darstellen. (Straubhaar 1994: 76) Häufig wird Migration dann ausgelöst, wenn zu einer ökonomisch prekären Lage Kriege oder ähnliches hinzukommen. Außerdem muß hier die Frage gestellt werden, inwieweit die aktuelle Rechtssituation haltbar ist, gemäß der die Entschei- dung zu migrieren, als Alternative zum Verhungern, freiwillig ist. (Nuscheler 1995: 29, 40) Zusätzlich fördern die Einwanderungsgesetzgebungen vieler Einzelstaaten eine Vermischung und/oder Umdeklaration von Migrationsursachen, da sie die Möglich- keit zur Einwanderung nur bei der Flucht vor individueller Verfolgung und nicht bei Flucht vor Kriegen, vor dem Verhungern oder bei Arbeitsmigration bieten. (Sunjic 2000: 151f)
Abschließend läßt sich festhalten, daß im Normalfall nicht die ärmsten sondern die gebildeten, wohlhabenden Schichten eines Landes wandern, da nur sie die Möglich- keit haben, die Reisekosten aufzubringen. (Nuscheler 1995: 37, Hödl 2000: 18) Ins- gesamt sind bei der Entwicklung von Migration vier Trends festzustellen: Globalisie- rung, Beschleunigung, Differenzierung und Feminisierung. (Waldrauch 1995: 34) So ist schon jede zweite MigrantIn eine Frau und der Anteil ist weiter steigend. (Hödl 2000: 13)
2.5. Ursachen
In der klassischen Migrationstheorie werden Migrationsursachen in Push- und Pull- faktoren unterteilt. Pushfaktoren sind Umstände, welche die Lage im Herkunftsland unbefriedigend und/oder gefährlich machen (materielle Not, Landknappheit, Arbeits- losigkeit, Diskriminierung, Umweltzerstörung, Katastrophen, Kriege, politische Ver- folgung). Pullfaktoren sind Gegebenheiten, welche potentielle Zielländer attraktiv er- scheinen lassen (Freiheit, Sicherheit, Arbeit, Wohlstand und vor allem bestehende Aufnahmebereitschaft gegenüber MigrantInnen). Migration findet meistens dann statt, wenn Push- und Pullfaktoren zusammenkommen. Der wichtigste Faktor ist hierbei die Aufnahmebereitschaft im Zielland. Pushfaktoren sind somit im Normalfall eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung. (Rheims 1997: 102f, Nu- scheler 1995: 32, Straubhaar 1994: 78)
Häufig wird in der Literatur der Versuch unternommen, Migrationsursachen zu strukturieren, wobei jedoch jede AutorIn ihre eigenen Schwerpunkte setzt. Dieser Text wird Migrationsursachen in sieben Ursachenfelder untergliedern.
(1) Das vor allem im Süden starke Bevölkerungswachstum wird häufig als wichtigste Ursache angeführt, auch da es teilweise verheerende Auswirkungen auf die öko- nomische Entwicklung der Länder hat. (Opitz 1994: 56f, Waldrauch 1995: 35)
(2) Globale und regionale Entwicklungsgefälle, besonders zwischen Nord und Süd, sind ein anderer wichtiger Faktor. Diese haben sich in der letzten Zeit weiter ver- größert, was vor allem an der weltweiten Armutszunahme deutlich wird. Trotzdem sinkt die Bereitschaft des Nordens Entwicklungshilfegelder bereitzustellen. Hinzu kommen die äußerst negativen sozialen Auswirkungen der von der Weltbank be- triebenen Strukturanpassungspolitik. (Opitz 1994: 54f, Nuscheler 1995: 37f)
(3) Unter anderem aus den ersten beiden Punkten resultiert ein extremer Arbeits- platzmangel. Zusätzlich erzeugen Strukturveränderungen eine beträchtliche Landflucht, welche die Situation auf dem Arbeitsmarkt weiter verschärft, so daß in manchen Entwicklungsländern die Arbeitslosigkeit bei 40-50% liegt. Die Migrati- onsursache liegt also im Normalfall in der Suche nach Arbeit überhaupt und nicht in der nach besseren Einkommensmöglichkeiten. (Nuscheler 1995: 34-36, Wald- rauch 1995: 35)
(4) Die Globalisierung internationaler Beziehungen und vor allem die des Weltmark- tes und der Produktion erzeugen Migration. Arbeitskräfte und besonders Spezia- listInnen werden weltweit eingesetzt und wandern, soweit dieses möglich ist, zu- sammen mit den Arbeitsplätzen. Zusätzlich werben Konzerne oder Staaten häufig benötigte FacharbeiterInnen gerade im Ausland an. (Nuscheler 1995: 38, Hödl 2000: 18)
(5) Genau wie die Produktion vernetzen und globalisieren sich auch Kommunikation und Transportwesen immer mehr. Reisen ist einfacher, schneller und vor allem billiger geworden. Überall auf der Welt sind durch die modernen Massenmedien Bilder westlichen Wohlstands allgegenwärtig und üben so einen nicht zu unter- schätzenden Werbeeffekt aus. (Nuscheler 1995: 38)
(6) Kriege, Bürgerkriege, Diktaturen und religiöse oder politische Unterdrückung füh- ren häufig zu großen Flüchtlingsströmen. Die Ursachen dieser Konflikte liegen häufig noch in der Kolonialzeit, im Ost-West Konflikt, in der Rivalität um Ressour- cen (Wasser) und in den Waffenexporten des Nordens. (Nuscheler 1995: 39-41, Opitz 1994: 53f)
(7) Die immer weiter fortschreitende Umweltzerstörung wird vor allem in Zukunft wei- ter an Bedeutung gewinnen, denn sowohl im Norden als auch im Süden mangelt es an wirklichen Bemühungen die Ursachen zu beseitigen. (Opitz 1994: 56f) Wie schon in den einzelnen Punkten teilweise deutlich wurde, sind alle diese Ursa- chenfelder miteinander verknüpft. Migration ist darum im Normalfall nicht monokau- sal zu erklären, sondern beruht auf einer Mischung verschiedener Faktoren. Zusätz- lich muß als Prognose für die Zukunft festgehalten werden, daß wahrscheinlich kei- ner dieser Punkte signifikant an Bedeutung verlieren wird. Eher das Gegenteil könnte der Fall sein. (Opitz 1994: 57)
Trotz aller Ursachenanalysen bestehen aber keine Migrations-Automatismen, denn Menschen reagieren eben nicht gemäß mathematischer Gesetzte. So sind die Län- der mit den höchsten Geburtenraten keineswegs die mit den höchsten Auswande- rungsraten. Außerdem findet Migration sowohl zwischen Ländern mit jeweils hohem (Bangladesch-Indien), als auch zwischen Ländern mit jeweils niedrigem Bevölke- rungswachstum (Osteuropa-Westeuropa) statt. (Rheims 1997: 105) Auch allein durch Armut lassen sich Migrationsbewegungen nicht erklären. So hat die Türkei trotz eines höheren Lebensstandards eine doppelt so hohe Auswanderungsrate wie Bangladesch. (Parnreiter 2000: 25) Migration ist eben nicht das Ergebnis einer malthusianischen Verelendungsformel, sondern hängt stark von politischen und wirt- schaftlichen Faktoren ab. Außerdem ist die individuelle Komponente sehr wichtig, denn Menschen migrieren vor allem dann, wenn zwischen Herkunfts- und Zielland eine kulturelle und/oder geographische Nähe besteht. Wichtig sind hierbei vor allem persönliche und/oder religiöse Kontakte und die Aufenthaltsbedingungen im Zielland. (Nuscheler 1995: 35f)
Abschließend stellt sich die Frage, warum bei der großen Anzahl an Migrationsursachen und der äußerst schlechten Lage in fast allen Entwicklungsländern nicht viel mehr Menschen als bisher migrieren. (Hödl 2000: 117f) Dieser Frage soll später in der zweiten Hälfte des Textes nachgegangen werden.
2.6. Lösungskonzepte
Es existiert eine Vielzahl von Konzepten zur Reduktion oder totalen Verhinderung von Migration, wobei leider im Normalfall nicht hinterfragt wird, ob es überhaupt wünschenswert und/oder notwendig ist, Migration zu reduzieren. Trotz dieser offenen Frage werden im folgenden einige Ansätze kurz vorgestellt.
- Schnelle und umfassende humanitäre Hilfe in Katastrophengebieten
- Korrekte Informationen über die Situation von MigrantInnen im Zielland, um dem Bild der Massenmedien entgegenzuwirken (Arbeitsverbote, Lebensmittelscheine, Einschränkung der Freizügigkeit, etc.)
- Verlagerung von Arbeitsplätzen statt Migration von ArbeiterInnen
- Liberalisierung von Handel- und Kapitaltransfers ermöglichen einen Wohlstand- sangleich, da der Handelsprotektionismus der Industrieländer die Entwicklungs- länder doppelt soviel kostet wie sie Entwicklungshilfe erhalten
- Einführung einer „Nicht-Migrationssteuer“, die von den potentiellen Zielländern aufgebracht und in den Herkunftsländern für Modernisierungsmaßnahmen ver- wendet wird
- Einführung einer Internationalen Organisation, die Migration weltweit koordiniert
- Verringerung des Bevölkerungswachstums
- Bekämpfung ökologischer Migrationsursachen durch nachhaltiges Wirtschaften l Abbau des weltweiten Rüstungsmarktes und Stopp von Waffenexporten l Ausbau und Kontrolle von Menschenrechten, Minderheitenschutz und eine aktive Friedenspolitik durch eine gestärkte und reformierte UNO
- Bekämpfung der Armut in den Herkunftsländern unter anderem durch eine um- fassende Entschuldung und eine deutliche Erhöhung der Entwicklungshilfegelder l Umbau des kapitalistischen Wirtschaftssystems gemäß von Nachhaltigkeitskrite- rien (Straubhaar 1994: 83-86, Nuscheler 1995: 99f, Rheims 1997: 115f)
Während die oben genannten Lösungsansätze die Pushfaktoren bekämpfen sollen, existieren auch Konzepte um die Pullfaktoren zu reduzieren.
- Verweigerung aller Rechte außer dem Bleiberecht gegenüber Asylsuchenden und strikte Beibehaltung des Arbeitsverbots
- Zügige Rückführung von anerkannten AsylbewerbernInnen nach Wegfall des Fluchtgrundes
- Einführung einer Einwanderungsabgabe für ArbeitsmigrantInnen (Straubhaar 1994: 88f)
Für alle Lösungskonzepte muß aber gelten, daß Ursachen- Vorrang vor Symptom- bekämpfung hat. (Straubhaar 1994: 83) Außerdem müssen bei Migrationsbewegun- gen und diesbezüglichen Lösungskonzepten sowohl die Auswirkungen auf das Ziel-, wie auch auf das Herkunftsland betrachtet werden. So hat Migration durch den Weg- zug von Fachkräften häufig negative Auswirkungen auf die Herkunftsländer und im kulturellen, ökonomischen und demographischen Bereich positive auf die Zielländer. (Hödl 2000: 18f)
3. Grundlagen der Migrationstheorie
Als Begründer der Migrationsforschung wird im allgemeinen Ernest G. Ravenstein angesehen, der 1885/1889 seine sieben Migrationsgesetze1 formulierte. Während
Ravenstein Migration als ein hauptsächlich demographisches Phänomen ansah, be- schäftigen sich heute Soziologen, Politologen, Ökonomen, Ethnologen, Anthropologen und Demographen mit diesem Bereich. Dieses dürfte eine Ursachen für die Vielzahl unterschiedlichster Ansätze sein, die heute in der Migrationstheorie existieren. (Blaschke 1994: 24f, 45)
Schon immer versuchten Migrationstheorien herauszuarbeiten, warum manche Menschen wandern, während andere, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, dieses nicht tun. Zusätzlich dazu wird ist in letzter Zeit häufig die Frage gestellt, warum heute nicht viel mehr Menschen migrieren. (Faist 1997: 63) Wie schon in Punkt 2.5. angesprochen, lassen sich Migrationsbewegungen aber nicht allein durch eine mathematische Anwendung demographischer und ökonomischer Unterschiede erklären. Darum beziehen neuere Theorien andere Faktoren in ihre Analyse- und Erklärungskonzepte ein. Die stärkere Berücksichtigung von durch die Politik gesetzten Rahmenbedingungen wäre hierfür ein Beispiel. (Pries 1997: 33)
3.1. Vorstellung einzelner Migrationstheorien
Im folgenden werden einige der wichtigsten Migrationstheorien vorgestellt werden, wobei allerdings keine der Theorien einen Allgemeingültigkeitsanspruch besitzen soll. Die Gesamtheit der Migrationsprozeße kann sowieso nur durch Kombination mehrerer Theorien erklärt werden. Dieses ist auch durchaus möglich, da bis auf die neoklassischen Push- und Pull Modelle alle Theorien im großen und ganzen kompatibel sind. (Parnreiter 2000: 45)
3.1.1. Theorie sozialen Kapitals
Migrationstheorien haben im Normalfall entweder einen makrostrukturellen (globale und politische Rahmenbedingungen) oder einen individualistisch, mikrostrukturellen (persönliche Nutzenmaximierung) Ansatz. Mikrostrukturelle Theorien versagen aber im Normalfall schon bei der Erklärung unterschiedlicher Auswanderungsraten aus ökonomisch ähnlich strukturierten Ländern. Gleichzeitig stoßen makrostrukturelle Theorien bei der Erklärung, warum manche Mitglieder einer Familie wandern, wäh- rend andere dieses nicht tun, an ihre Grenzen. Als zusätzliches Erklärungselement wird darum die Theorie sozialen Kapitals hinzugefügt, die auf einer Mesoebene ansetzt. (Faist 1997: 63f)
Diese Theorie unterscheidet ökonomisches, soziales und humanes Kapital. Ökono- misches Kapital ist Kapital in klassischer Hinsicht, also Geld, Aktien oder anderer materieller Besitz, der ohne größere Probleme weltweit transferiert werden kann. Bei sozialem Kapital handelt es sich um jegliche Art von freundschaftlichen, familiären oder religiösen Beziehungen und den daraus resultierenden Vorteilen, die der Ein- zelne in Anspruch nehmen kann. Soziales Kapital ist stark regional gebunden, da die Kontaktpersonen nun einmal an bestimmten Orten leben und der entsprechenden Person nur dort von Nutzen sein können. Ein Familienmitglied z.B., welches hand- werkliche Arbeiten umsonst ausführt, kann dieses im Normalfall eben nur in relativer Nähe seines Wohnortes tun. Ähnlich schwer zu transferieren wie soziales ist huma- nes Kapital, daß Bildung, Wissen und Fertigkeiten einer Person umfaßt. Dieses Wis- senspotential ist häufig nur in bestimmten Regionen oder Ländern einsetzbar. So ist z.B. die Fertigkeit Reis anzubauen in Westeuropa nun einmal nur in den seltensten Fällen von Nutzen. (Faist 1997: 75)
Die Theorie geht davon aus, daß Menschen nur dann migrieren, wenn sie erwarten, daß die Summe aller drei Kapitalarten im Zielland größer als im Herkunftsland sein wird. (Faist 1997: 80) Dieses könnte erklären, warum so viele Menschen, trotz mögli- cherweise besseren Verdienstmöglichkeiten in anderen Ländern oder Regionen, nicht migrieren. Vor allem wenn man bedenkt, daß Migration immer mit Risiken ver- bunden ist, da die erhofften Vorteile eben nur erhofft und keinesfalls sicher sind. (Straubhaar 1994: 74)
3.1.2. Neoklassische Ökonomie
Die neoklassische Ökonomie ist die älteste Theorie zur Erklärung von Migration. (Parnreiter 2000: 27) Sie geht primär von einem mikrostrukturellen, individualisti- schen Ansatz aus und stellt ein nach Nutzenmaximierung strebendes, (Faist 1997: 66, 68) rational handelndes Individuum in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Migra-tion findet immer dann statt, wenn das Individuum oder die Familie sich davon einen größeren Nutzten als von Nichtmigration verspricht. (Straubhaar 1994: 71f) Dabei geht die Theorie davon aus, daß die potentielle MigrantIn ausreichende Informatio- nen über alle denkbaren Migrationsziele besitzt. (Pries 1997: 30) Entscheidender Faktor bei der Bewertung der Migrationsziele durch das Individuum, sind die zu erwartenden Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten am Zielort. (Pries 1997: 30) Internationale Lohnunterschiede sind somit die ausschlaggebende Migrationsur- sache. Die neoklassische Ökonomie geht hierbei davon aus, daß jedes Land das exportiert, was es im Überfluß besitzt, und daß sich durch diesen Prozeß die Preis- unterschiede letztendlich ausgleichen werden. Migration wird dementsprechend so- lange stattfinden, bis sich Arbeitskräfteangebot und Lohnniveau international ange- glichen haben. (Parnreiter 2000: 27f, Waldrauch 1995: 28)
Es existiert eine Vielzahl von Kritikpunkten am Model der neoklassischen Ökonomie. So beachtet sie z.B. nicht, daß viele Fähigkeiten nur regional einsetzbar sind, und MigrantInnen darum meistens im Zielland schlechtere Arbeitsmöglichkeiten als im Herkunftsland besitzen. (Faist 1997: 66f) Ein weiterer Kritikpunkt ist der ahistorischer Charakter der Theorie, da sie nicht hinterfragt, warum die bestehenden Unterschiede in Arbeitskräfteangebot und Lohnniveau existieren. Die Einbeziehung dieser histori- schen Faktoren ist aber häufig für das Verständnis von Migrationsprozeßen wichtig. Der Hauptkritikpunkt ist aber, daß sich durch die neoklassische Ökonomie nicht er- klären läßt, warum bei den zur Zeit bestehenden, riesigen Lohnunterschieden nur so wenige Menschen wandern. Außerdem läßt sich die Theorie empirisch nicht bewei- sen, sondern sogar widerlegen, da eben nicht die ärmsten Länder und/oder Regio- nen die größten Auswanderungsraten haben. So bestehen z.B. zwischen dem Nor- den und dem Süden der EU, trotz großer Lohnunterschiede und geringen politischen Hindernissen, kaum Migrationsbewegungen. Auch gleichen sich die Lohnniveaus weltweit nicht an, wie es gemäß der Theorie eigentlich sein müßte, sondern entfer- nen sich immer weiter voneinander. (Parnreiter 2000: 45f, Massey 2000: 58)
3.1.3. Theorie des dualen Arbeitsmarktes
Die Theorie des dualen Arbeitsmarktes ist teilweise mit der neoklassischen Ökono- mie verwandt. Sie geht jedoch nicht nur von objektiven, ökonomischen Gesichts-punkten aus, sondern berücksichtigt auch subjektive, soziologische Aspekte. (Pries 1997: 31) Der Hauptunterschied zur neoklassischen Ökonomie liegt jedoch in der theoretischen Zweiteilung der Arbeitsmärkte in den Industrieländern. Der primäre Sektor besteht dabei aus abgesicherter, relativ gut bezahlter und vor allem gesell- schaftlich angesehener Arbeit. Im sekundären Sektor sind die Jobs häufig ungesi- chert, schlechter bezahlt, schlecht angesehen und bieten kaum Aufstiegschancen. Da einheimische Arbeitskräfte den sekundären Sektor, aufgrund des damit verbun- denen niedrigen soziales Status, nach Möglichkeit meiden, entsteht dort Arbeitskräf- tebedarf. (Parnreiter 2000: 28f)
MigrantInnen sind nicht selten die einzigen, die diese Jobs annehmen wollen, da sie häufig arm und grundsätzlich dazu bereit sind. Im Gegensatz zu Einheimischen ist es ihnen dank ihres häufig nur befristeten Aufenthalts im Land nämlich möglich, soziale Identität und durch ihre Arbeit zugewiesene gesellschaftliche Stellung zu trennen. Sie definieren sich nicht über ihre Arbeit, sondern betrachten diese nur als Mittel zum Zweck. Diese Anspruchslosigkeit macht die Beschäftigung von MigrantInnen äußerst attraktiv für die Industrie, auch da ihre Konkurrenz disziplinierend auf einheimische Arbeitskräfte wirkt. Deshalb werben Unternehmen häufig aktiv MigrantInnen im Aus- land an. Im Gegensatz zur neoklassischen Ökonomie ist die Migrationsentscheidung darum weniger individuell, sondern vor allem von den Industriebetrieben in den Ziel- ländern abhängig. (Parnreiter 2000: 28-30, Pries 1997: 31)
3.1.4. Neue Migrationsökonomie
Genau wie die beiden vorangegangenen Theorien stammt auch diese aus der Öko- nomie. Sie betrachtet aber primär nicht das Individuum, sondern die Familie, die ein- zelne Mitglieder in andere Länder und/oder Regionen entsendet. Migration ist gemäß der neuen Migrationsökonomie keine Reaktion auf Lohndifferenzen, sondern auf nicht funktionierende Versicherungs- und Kapitalmärkte in den Herkunftsländern. Die Entsendung einzelner Familienmitglieder in Städte oder ins Ausland ist nämlich häu- fig die einzige Möglichkeit der Risikoabsicherung und Kapitalbeschaffung. Nicht Ar- mut, sondern das Bedürfnis nach zusätzlichen Einnahmen, stellt damit die Migration- sursache dar. Im Zentrum des Interesses stehen dementsprechend die Geldüber- weisungen an die Familie im Herkunftsland.
Erst durch diese Gelder ist es vielen Familien möglich, ihren landwirtschaftlichen Familienbetrieb zu modernisieren und eine Absicherung vor Ernteausfällen durch Umstellungsprobleme oder Dürreperioden zu gewährleisten. (Parnreiter 2000: 31f) Außerdem sind diese Geldüberweisungen häufig die beste Migrationswerbung, so daß andere Familien- oder Dorfmitglieder ebenfalls migrieren. (Pries 1997: 33)
3.1.5. Weltsystemtheorie
Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Theorien geht die Weltsystemtheorie von einem makrostrukturellen, soziologischen Ansatz aus. (Faist 1997: 68) Ihr Ursprung liegt in der Dependenztheorie,2 aus der sie in den späten 60er Jahren entstand. (Waldrauch 1995: 29) Gemäß der Weltsystemtheorie entsteht Migration durch das Übergreifen des Kapitalismus auf ein nicht kapitalistisch organisiertes Land. Hierbei werden die bestehenden sozialen und ökonomischen Strukturen durch den kapitalistischen Weltmarkt zerstört und die Menschen so ihrer angestammten Lebensgrundlage beraubt und zu LohnarbeiterInnen gemacht. Diese migrieren dann in die Städte oder andere Länder. (Massey 2000: 55f, Pries 1997: 31)
Migration ist damit ein Teil des Weltmarktes. Sie ist der Teil in dem Arbeitskräfte ge- handelt werden, wobei immer Bedarf nach neuen Arbeitskräften besteht, da diese im Normalfall am billigsten sind. Diese Kostenfaktoren sind es, die Industrie und Staaten dazu veranlassen, genau wie in der Vergangenheit, MigrantInnen anzuwerben. (Parnreiter 2000: 33f) Durch den Import von Arbeitskräften sparen die Zielländer de- ren Reproduktionskosten (Erziehung, Ausbildung), können sie im Falle von Arbeits- losigkeit wieder ausweisen und mittels der Konkurrenz Druck auf die ArbeiterInnen im Zielland ausüben. (Waldrauch 1995: 30) Staatsgrenzen nehmen in diesem Pro- zeß die Funktion eines Filters bzw. Umwandlers ein, der MigrantInnen zwar durch- läßt, ihnen aber einen niedrigeren Rechtsstatus zuweist. So verlieren sie z.B. durch ihren irregulären Aufenthaltsstatus fast alle persönlichen Rechte.
Die sich immer weiter beschleunigende Globalisierung hat mehrere Auswirkungen auf den Migrationsprozeß. Die oben beschriebene Entwurzelung der Menschen wird beschleunigt und in den Zielländern entstehen mehr ungesicherte Arbeitsplätze, die von MigrantInnen besetzt werden können. Außerdem entstehen durch den globalen Kapital-, Waren- und Informationsverkehr immer mehr Verbindungen zwischen einzelnen Ländern, welche die Migration erleichtern. (Parnreiter 2000: 34f) Neben persönlichen existieren eben auch ökonomische, kulturelle, geschichtliche (Kolonien) und militärische zwischenstaatliche Beziehungen. (Faist 1997: 68f)
3.1.6. Migrationsnetzwerke und transnationale Räume
Die Migrationsnetzwerktheorie besitzt sowohl soziologische wie auch anthropologi- sche Komponenten. Sie beschäftigt sich, anders als die bisher vorgestellten Theo- rien, nicht mit dem Entstehen, sondern mit dem Fortlaufen und der Selbstreprodukti- on von Migration. Für diesen Effekt sind vor allem informelle Verwandtschafts- und Bekanntschaftsstrukturen verantwortlich, die sich zwischen Herkunfts- und Zielland erstrecken. Durch diese Migrationsnetzwerke kommen zu den unter Umständen be- reits existierenden Migrationsursachen weitere dazu, so daß ein Migrationsprozeß weiterlaufen kann, obwohl die ursprünglichen Ursachen überhaupt nicht mehr beste- hen. Es kommt zu Kettenwanderungen, bei denen ein Verwandter, Bekannter oder Nachbar jeweils einem anderen nachfolgt.
Migrationsnetzwerke bieten den nachfolgenden MigrantInnen mehrere Vorteile. Vor allem mehr und bessere Informationen über das Zielland und sinkende finanzielle und psychosoziale Migrationskosten lassen die Migrationsrisiken abnehmen. Die finanziellen Kosten sinken durch die Vermittlung von Arbeit, Wohnung, etc., während die psychosozialen Eingewöhnungsprobleme im Zielland durch Freunde und Verwandte natürlich ebenfalls geringer werden. (Parnreiter 2000: 36-38)
Transnationale Räume sind eine Verfestigung von Migrationsnetzwerken, wobei sich der soziale und kulturelle Raum einer ethnischen Gruppe über mehrere geographi- sche Räume (Staaten) erstreckt. (Pries 1997: 16-18) Dabei kommt es oft zu mehrma- ligen, multidirektionalen und sich häufig zyklisch wiederholenden Wanderungsbewe- gungen, die z.B. jeweils zur Erntezeit stattfinden. (Parnreiter 2000. 40) Transnationa- le Räume sind damit sozusagen der der Globalisierung entsprechende Effekt auf zwischenmenschlicher Ebene. Sie sind eine Folge bzw. eine Parallele zur Ausbrei- tung der Massenmedien, der Kommunikationsmöglichkeiten und der immer stärker voranschreitenden Verflechtung der weltweiten Konzerne. (Pries 1997: 35)
3.1.7. Gendertheorien
Der Ansatz von Gendertheorien besteht in der Frage, ob geschlechterspezifische Ungleichheiten Migration fördern, hemmen oder zu unterschiedlichen Auswirkungen führen. Ein Ergebnis dieser Forschung ist, daß Migrantinnen häufig mehrfach diskri- minierte Menschen sind, da sie im Herkunftsland als Frau und im Zielland als Frau und als Migrantin diskriminiert werden. Dieses führt aus mehreren Gründen aber auch dazu, daß der Anteil von Frauen an der Gesamtmigration beständig steigt. Ei- nerseits müssen Frauen in der traditionellen Landwirtschaft häufig die untersten und einfachsten Arbeiten übernehmen, was zur Konsequenz hat, daß sie im Falle von Modernisierungen als erste freigesetzt werden und so die Möglichkeit zur Migration haben. Andererseits sind Migrantinnen bei der Industrie aufgrund ihrer mehrfachen Diskriminierung äußerst begehrt, weil sie dadurch gezwungen sind, jeden Job anzu- nehmen und für jeden Lohn zu arbeiten.
Hinzu kommt, daß Frauen durch das Aufwachsen in patriarchalischen Strukturen als gehorsamer gelten, was sie sowohl bei Industriebetrieben als auch in Falle von Geldüberweisungen an die Familie beliebt macht. Die sich daran anschießende Fra- ge, ob sich durch Migration für Frauen die Möglichkeit zur Emanzipation bietet, konn- te aber noch nicht eindeutig beantwortet werden. (Parnreiter 2000: 41-43)
4. Fazit
Abschließend läßt sich sagen, daß das Thema Migration in vielen Fällen vom fal- schen Standpunkt aus betrachtet und diskutiert wird. Es ist eben kein sicherheitspoli- tisches, sondern ein humanitäres Thema, bei dem Menschenrechte und Verantwor- tung und nicht eine eurozentrische Wohlstandsverteidigung im Mittelpunkt stehen müßten. Für einen Großteil der Migration, sowohl was Flucht, als auch was Arbeits- migration angeht, sind die Länder des Nordens sowieso direkt oder indirekt verant- wortlich. Kriege werden mit Waffenlieferungen aus dem Norden geführt, einheimi- sche Volkswirtschaften durch den vom Norden beherrschten IWF zerstört und Men- schen verhungern aufgrund der im Norden erzeugten Klimaveränderungen. Dieser Verantwortung entziehen sich die Länder des Nordens aber bisher weitestgehend und ein Umdenken ist nicht in Sicht.
Statt dessen werden Abwehrmaßnahmen gegen einen Flüchtlingsansturm getroffen, der überhaupt nicht stattfindet und den wenigen, die es schaffen nach Europa vorzu- dringen, werden die elementarsten Menschenrechte verweigert. Immer wieder wird mit einem explosiven Bevölkerungswachstum und abermillionen von Flüchtlingen argumentiert. Zahlen, Statistiken und Grafiken werden benutzt, ohne daß sie auf wirklich verläßlichen Daten beruhen oder bei genauerer Betrachtung tatsächlich et- was aussagen würden. Eine Statistik z.B. die besagt, daß es so viele MigrantInnen wie noch nie gibt, ist vollkommen wertlos, wenn man sie nicht mit dem Bevölke- rungswachstum in Relation setzt. Hinzu kommt die Frage, wer definiert, ab wann das Bevölkerungswachstum einer Region oder der Welt insgesamt zu hoch ist. Faktisch ist es nämlich nicht möglich, eine objektive Bevölkerungsobergrenze festzulegen. Schon gar nicht, wenn man die internationalen Abhängigkeitsverhältnisse und den unterschiedlichen Ressourcenverbrauch in Nord und Süd nicht berücksichtigt.
Wenn man Migration mit dem Themenbereich nachhaltiger Entwicklung verknüpft, werden die Verbindungen nicht sofort auf den ersten Blick deutlich. Das mag auch daran liegen, daß Migration teilweise ein Ergebnis von fehlender Nachhaltigkeit in Ökonomie, Ökologie und Sozialem ist. Menschen müssen migrieren, weil die Situati- on in ihrer Heimatregion nun einmal so katastrophal und eine nachhaltige Verbesse- rung nicht in Sicht ist.
Andererseits muß Migration auch in Konzepte nachhaltiger Entwicklung eingebunden werden. Sozialpolitisch nachhaltige Konzepte müssen die Integration von MigrantIn-nen in den Zielländern gewährleisten. Bei Migration handelt es sich nämlich nicht um etwas grundsätzlich Gefährliches und Bedrohliches, aber nun einmal auch nicht um einen Prozeß, der nur aufgrund von Notlagen stattfindet. Darum muß Migration auch nicht auf jeden Fall verhindert oder reduziert werden, wovon aber fast alle Lösungs- konzepte ausgehen. Es ist nur notwendig die Zwangslagen zu bekämpfen, aufgrund derer erzwungene Migration stattfindet. Migration an sich ist nicht das Problem. Bei der Frage, welche Migrationstheorie zur Erklärung der derzeitigen Situation am besten geeignet erscheint, ist eine eindeutige Antwort schwer zu finden. Alle Theo- rien erscheinen in sich schlüssig und können wahrscheinlich ihren Teil bei der Erklä- rung der Gesamtheit der Migrationprozesse beitragen. Allerdings erscheinen mir jene Theorien, welche Migration hauptsächlich als Ergebnis von individuellen Entschei- dungen ansehen, in Anbetracht der aktuellen Situation, nur in den seltensten Fällen zuzutreffen. Freiwilligkeit und individuelle Entscheidungsmöglichkeiten scheinen mir in der Lebensrealität von (potentiellen) Flüchtlingen und MigrantInnen eher selten vorzukommen. Aber es wäre ein großer Fortschritt, wenn dieses in Zukunft der Fall wäre.
Literaturverzeichnis
Blaschke, Jochen, Internationale Migration: Ein Problemaufriß, in: Knapp, Manfred (Hrsg.), Migration in Europa, Veröffentlichungen des Studienkreises Internationale Beziehungen, Bd. 5, Stuttgart 1994, S. 23-50.
Faist, Thomas, Migration und der Transfer sozialen Kapitals oder: Warum gibt es relativ wenige internationale Migranten?, in: Pries, Ludger (Hrsg.), Transnationale Migration, Soziale Welt, Sonderband 12, Baden-Baden 1997, S. 63-83.
Hödl, Gerald, u.a. Internationale Migration: Globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts?, in: Husa, Karl, Parnreiter, Christof, Stacher, Irene (Hrsg.), Internationale Migration, Die globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts?, Historische Sozialkunde Bd. 17, Internationale Entwicklung, Frankfurt a. M. 2000, S. 9-23.
Massey, Douglas S., Einwanderungspolitik für ein neues Jahrhundert, in: Husa, Karl, Parnreiter, Christof, Stacher, Irene (Hrsg.), Internationale Migration, Die globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts?, Historische Sozialkunde Bd. 17, Internationale Entwicklung, Frankfurt a. M. 2000, S. 53-76.
Neuffer, Martin, Die Erde wächst nicht mit, Neue Politik in einer übervölkerten Welt, München 1982.
Nuscheler, Franz, Internationale Migration., Flucht und Asyl, Grundwissen Politik, Bd. 14, Opladen 1995.
Opitz, Peter J., Die Migrations- und Flüchtlingsproblematik nach Beendigung des Ost-West-Konflikts: Globale und europäische Dimension, in: Knapp, Manfred (Hrsg.), Migration in Europa, Veröffentlichungen des Studienkreises Internationale Beziehungen, Bd. 5, Stuttgart 1994, 51-67.
Parnreiter, Christof, Theorien und Forschungsansätze zu Migration, in: Husa, Karl, Parnreiter, Christof, Stacher, Irene (Hrsg.), Internationale Migration, Die globale Her-ausforderung des 21. Jahrhunderts?, Historische Sozialkunde Bd. 17, Internationale
Entwicklung, Frankfurt a. M. 2000, S. 25-53.
Pries, Ludger, Neue Migration im transnationalen Raum, in: Pries, Ludger (Hrsg.), Transnationale Migration, Soziale Welt, Sonderband 12, Baden-Baden 1997, S. 15- 44.
Rheims, Birgit, Migration und Flucht, in: Hauchler, Ingomar, Messner, Dirk, Nuscheler, Franz (Hrsg.), Stiftung Entwicklung und Frieden, Globale Trends 1998, Fakten Analysen Prognosen, Frankfurt a. M. 1997, S. 96-117.
Straubhaar, Thomas, Druck und/oder Sog: Migration aus ökonomischer Sicht, in: Knapp, Manfred (Hrsg.), Migration in Europa, Veröffentlichungen des Studienkreises Internationale Beziehungen, Bd. 5, Stuttgart 1994, 69-96.
Sunjic, Melita H., Das Weltflüchtlingsproblem: gestern - heute - morgen, in: Husa, Karl, Parnreiter, Christof, Stacher, Irene (Hrsg.), Internationale Migration, Die globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts?, Historische Sozialkunde Bd. 17, Internationale Entwicklung, Frankfurt a. M. 2000, S. 145-155.
UNHCR (Hrsg.), Wer ist ein Flüchtling?, http://unhcr.de/un&ref/who/gwhois.htm, Ja- nuar 2001.
Waldrauch, Harald, Theorien zu Migration und Migrationspolitik, in: Journal für Sozialforschung, 35. Jg., Heft 1, 1995, S. 27-49.
Anhang
[...]
1 (1) Die Mehrheit migriert lediglich über kurze Distanzen und etabliert dabei „Ströme der Migration“ in urbane Zentren. (2) Dies verursacht Verlagerungs- und Entwicklungsprozesse bei der Bevölkerung in den Sende und Empfängerländern. (3) Die Prozesse der Verdrängung und Aufnahme von Migranten bedingen sich gegenseitig. (4) Es entwickeln sich im Laufe der zeit Migrationsketten. (5) Migrati- onsketten führen zur Auswanderung in Richtung der jeweiligen Zentren von Handel und Industrie. (6)Stadtbewohner sind weniger anfällig für Migration als die ländliche Bevölkerung. (7) Das gleiche gilt für den weiblichen Teil der Bevölkerung. (vgl. Faist 1997: 65)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau zum Thema Flucht und Migration, die Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält.
Was sind die Hauptpunkte von Kapitel 2, "Flucht und Migration"?
Dieses Kapitel behandelt verschiedene Aspekte von Flucht und Migration, einschliesslich der juristischen Rahmenbedingungen für Flucht und Asyl, strukturelle und quantitative Veränderungen basierend auf Zahlenmaterial, einen Überblick über die Ursachen und Lösungsansätze zur Reduzierung von Migrationsbewegungen.
Wie definiert das UNHCR den Flüchtlingsstatus?
Gemäss der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist ein Flüchtling eine Person, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb ihres Heimatlandes befindet und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder will.
Welche politische Dimension wird dem Thema Migration beigemessen?
Migration wird zunehmend als sicherheitspolitisches und weniger als humanitäres Thema betrachtet, wobei Einwanderung oft als unerwünscht oder gefährlich angesehen wird, was zu einer Verschärfung der Einwanderungsgesetze und einem Anstieg irregulärer Migration führt.
Welche quantitativen Veränderungen wurden im Migrationsprozess festgestellt?
Obwohl statistische Probleme bestehen, gibt es in absoluten Zahlen mehr Migranten als je zuvor. Der Anteil der Migranten an der Weltbevölkerung ist jedoch nur geringfügig gestiegen. Ein Grossteil der Migranten sind Arbeitsmigranten und deren Familienangehörige. Bemerkenswert ist auch die hohe Zahl der Binnenmigranten.
Welche qualitativen Veränderungen wurden im Migrationsprozess festgestellt?
Neben den quantitativen Veränderungen hat sich auch die Art der Migration verändert. Migration ist häufig zeitlich befristet und mehrfach, wodurch transnationale Räume entstehen. Viele Länder sind gleichzeitig Herkunfts- und Zielland für Migrationsbewegungen.
Was sind die Hauptursachen für Flucht und Migration?
Migrationsursachen werden oft in Push- und Pull-Faktoren unterteilt. Push-Faktoren sind Umstände, die die Lage im Herkunftsland unbefriedigend machen, während Pull-Faktoren potenzielle Zielländer attraktiv erscheinen lassen. Zu den Ursachen gehören Bevölkerungswachstum, Entwicklungsgefälle, Arbeitsplatzmangel, Globalisierung, Kriege, Umweltzerstörung usw.
Welche Lösungskonzepte werden zur Reduzierung der Migration vorgeschlagen?
Es gibt verschiedene Konzepte, darunter humanitäre Hilfe in Katastrophengebieten, korrekte Informationen über die Situation von Migranten, Verlagerung von Arbeitsplätzen, Liberalisierung des Handels, Einführung einer "Nicht-Migrationssteuer", Bekämpfung von Armut und Umweltzerstörung, Friedenspolitik und weitere.
Wer gilt als Begründer der Migrationsforschung?
Ernest G. Ravenstein wird im Allgemeinen als Begründer der Migrationsforschung angesehen, der 1885/1889 seine sieben Migrationsgesetze formulierte.
Welche Migrationstheorien werden vorgestellt?
Es werden verschiedene Migrationstheorien vorgestellt, darunter die Theorie sozialen Kapitals, die neoklassische Ökonomie, die Theorie des dualen Arbeitsmarktes, die neue Migrationsökonomie, die Weltsystemtheorie, Migrationsnetzwerke und transnationale Räume sowie Gendertheorien.
Was sind die Kernaussagen der Theorie des sozialen Kapitals?
Die Theorie unterscheidet ökonomisches, soziales und humanes Kapital und geht davon aus, dass Menschen nur dann migrieren, wenn sie erwarten, dass die Summe aller drei Kapitalarten im Zielland grösser als im Herkunftsland sein wird.
Was sind die Kritikpunkte an der neoklassischen Ökonomie in Bezug auf Migration?
Die neoklassische Ökonomie wird kritisiert, weil sie regionale Fähigkeiten, historische Faktoren und die Tatsache, dass nur relativ wenige Menschen angesichts grosser Lohnunterschiede migrieren, nicht berücksichtigt.
Was ist die Weltsystemtheorie?
Die Weltsystemtheorie besagt, dass Migration durch das Übergreifen des Kapitalismus auf ein nicht-kapitalistisch organisiertes Land entsteht und die Menschen ihrer Lebensgrundlage beraubt.
Was sind Migrationsnetzwerke und transnationale Räume?
Migrationsnetzwerke sind informelle Verwandtschafts- und Bekanntschaftsstrukturen, die sich zwischen Herkunfts- und Zielland erstrecken und zur Selbstreproduktion von Migration beitragen. Transnationale Räume sind eine Verfestigung dieser Netzwerke, wobei sich der soziale und kulturelle Raum einer ethnischen Gruppe über mehrere geografische Räume erstreckt.
Was sind die Erkenntnisse der Gendertheorien im Kontext von Migration?
Gendertheorien untersuchen, ob geschlechterspezifische Ungleichheiten Migration fördern, hemmen oder zu unterschiedlichen Auswirkungen führen. Migrantinnen sind häufig mehrfach diskriminiert, was ihre Beschäftigung in bestimmten Branchen begünstigt.
Was ist die abschliessende Bewertung des Themas Migration?
Migration sollte als humanitäres und nicht als sicherheitspolitisches Thema betrachtet werden, bei dem Menschenrechte und Verantwortung im Mittelpunkt stehen sollten. Die Länder des Nordens tragen häufig direkt oder indirekt zu Migrationsursachen bei und sollten ihre Verantwortung wahrnehmen.
Wie wird die Verknüpfung von Migration und nachhaltiger Entwicklung eingeschätzt?
Migration ist teilweise ein Ergebnis von fehlender Nachhaltigkeit in Ökonomie, Ökologie und Sozialem und muss in Konzepte nachhaltiger Entwicklung eingebunden werden, wobei die Integration von Migranten und die Bekämpfung von Zwangslagen im Vordergrund stehen sollten.
- Quote paper
- Lars Thiede (Author), 2001, Migration und Migrationstheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104933