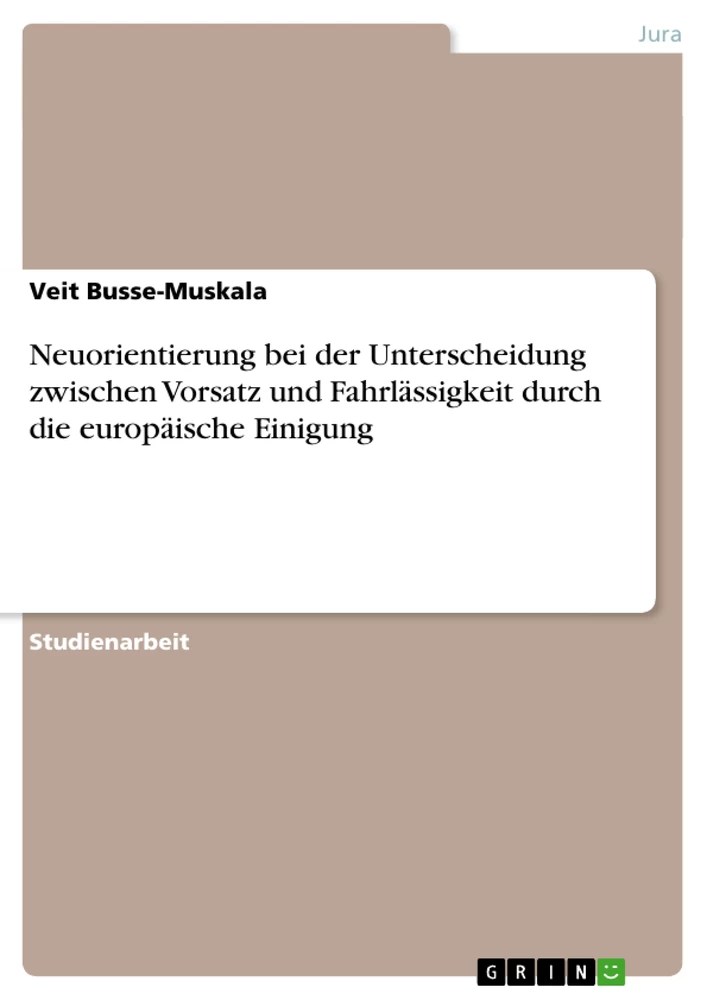Problematisch ist v. a. die steigende Gesetzesflut im Verweisungsdschungel (Problem: Blankettstrafgesetzgebung) komplexer Normensysteme (v.a. im Nebenstrafrecht), die nicht sozial- ethisch indiziert, sondern infolge formalen Verwaltungsgehorsams an EG- rechtlichen Vorgaben orientiert ist und somit der ultima- ratio- Funktion des Strafrechts nicht gerecht werden kann.1 [...] Aus dem Problemaufriß ergibt sich daher die Frage, welche Beachtung der Schuldgrundsatz- i.S.v. festzustellenden Vorsatzes oder Fahrlässigkeit als individuelle Schuldmerkmale- in einzelnen Rechtsordnungen und schließlich durch die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene findet. Fraglich ist, inwiefern gemeinschaftsrechtliche Normgebung und Rspr. auf das deutsche StrR einwirken, und ob sich der Strafjurist gegebenenfalls neu orientieren muß. Wenn vorlie-gend von "Sanktionen" gesprochen wird, so sind diese i. w. S. zu verstehen. Der Streit, ob Sanktionsformen nach Kriminal- und sonstigem StrR qualitativ oder quantitativ getrennt werden können, muß dahinstehen, da jedenfalls allen Sanktionen die hoheitliche Ahndung eines Rechtsverstoßes gemeinsam ist.2 [1 Moll, Europäisches StrR, S 284; 2 Böse, Strafen und Sanktionen im EG-R, S. 35-45 (insbesondere S.45)]
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- 1) Einfluß der Europäischen Einigung auf deutsches Strafrecht.
- 2) große Anfrage zur Strafrechtsvereinheitlichung.
- 3) Problemstellung
- 4) Ziel der Untersuchung
- II) Nationale Strafrechtsentwicklung - Reformen, Rspr. und Schrifttum
- 1) Deutsche Strafrechtsentwicklung
- a) Einordnung der Begriffe in das Verbrechenssystem.
- b) Stellenwert des Schuldprinzips
- c) gesetzliche Regelung..
- d) Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit
- e) Probleme
- 2) Entwicklung in Ost- und Nordeuropa.
- a) Die ehemalige DDR
- b) Polen
- c) Finnland
- d) Schweden
- 3) Entwicklung in Südeuropa.
- a) Griechenland
- b) Italien
- 4) Entwicklung in Westeuropa
- a) Österreich
- b) Portugal
- c) Spanien.
- d) Belgien
- e) Niederlande
- f) Dänemark
- g) Frankreich
- h) Irland
- i) Großbritannien
- aa) Allgemeines zur britischen Rechtsprechung
- bb) Beispiele aus der britischen Rechtsprechung
- cc) Vorsatz-Fahrlässigkeitsdogmatik.
- dd) Britische Rechtspraxis
- 5) Zwischenergebnis
- III) Die europäische Dimension
- 1) historischer Abriẞ
- 2) Die EMRK
- 3) Das EG- Recht
- a) Corpus Juris
- aa) Einzelne Regelungen
- bb) Probleme
- b) Sanktionsrecht der EG i. w. S.
- aa) VO (EG/EURATOM) 2988/95
- bb) VO (EG) 800/99
- cc) VO (EWG) 17/62
- (1) Tatbestand des Art. 15 der EWG-KartellVO
- (2) Beweisfragen in der Praxis
- (3) Irrtümer
- 4) Rspr. des EuGH, EuG
- a) ständige Rspr. zum Kartellrecht
- b) Rs. C-104/94
- c) Rs. C-137/95
- d) Rs. C-7/98
- IV) Zusammenfassung und Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, wie sich die europäische Einigung auf die Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit im deutschen Strafrecht auswirkt. Sie analysiert, wie die Entwicklungen im europäischen Recht die traditionelle deutsche Dogmatik beeinflussen und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.
- Einfluss der Europäischen Einigung auf das deutsche Strafrecht
- Strafrechtsvereinheitlichung
- Entwicklungen in verschiedenen europäischen Ländern
- Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
- Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Kartellrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Untersuchung vor. Sie erläutert den Einfluss der europäischen Einigung auf das deutsche Strafrecht und beleuchtet die Frage der Strafrechtsvereinheitlichung.
Kapitel II befasst sich mit der nationalen Strafrechtsentwicklung in Deutschland, Ost- und Nordeuropa, Südeuropa und Westeuropa. Es werden die relevanten Reformen, Rechtsprechungen und wissenschaftlichen Positionen zu den Begriffen Vorsatz und Fahrlässigkeit analysiert. Die Entwicklung in Großbritannien wird besonders detailliert betrachtet, da das englische Recht ein unterschiedliches System der Unterscheidung von Vorsatz und Fahrlässigkeit aufweist.
Kapitel III untersucht die europäische Dimension des Themas. Es beleuchtet den historischen Abriß der europäischen Integration im Strafrecht, die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und die Rolle des Europäischen Gemeinschaftsrechts (EG-Recht) für die Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Kartellrechts und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).
Schlüsselwörter
Europäische Einigung, Strafrecht, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Strafrechtsvereinheitlichung, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), Europäisches Gemeinschaftsrecht (EG-Recht), Kartellrecht, Europäischer Gerichtshof (EuGH)
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die EU-Einigung das deutsche Strafrecht?
Durch EG-rechtliche Vorgaben und die Rechtsprechung des EuGH entstehen neue Normen (oft Blankettstrafgesetze), die den nationalen Gesetzgeber zur Anpassung zwingen und den Schuldgrundsatz beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit?
Vorsatz bezeichnet das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung, während Fahrlässigkeit die Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt bei Vorhersehbarkeit des Erfolgs bedeutet.
Welche Rolle spielt das Kartellrecht in dieser Untersuchung?
Das EG-Kartellrecht dient als Beispiel dafür, wie europäische Sanktionsnormen (z. B. Art. 15 der EWG-KartellVO) die Unterscheidung von individuellem Verschulden in der Praxis handhaben.
Was bedeutet „Blankettstrafgesetzgebung“?
Es handelt sich um Gesetze, die die Strafdrohung festlegen, aber die Beschreibung des verbotenen Verhaltens anderen (oft europäischen) Verordnungen oder Verwaltungsakten überlassen.
Gibt es eine europäische Strafrechtsvereinheitlichung?
Die Arbeit untersucht Bestrebungen wie das „Corpus Juris“, die auf eine Vereinheitlichung abzielen, zeigt aber auch die erheblichen dogmatischen Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsordnungen auf.
- Citar trabajo
- Dr. Veit Busse-Muskala (Autor), 2001, Neuorientierung bei der Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit durch die europäische Einigung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10504