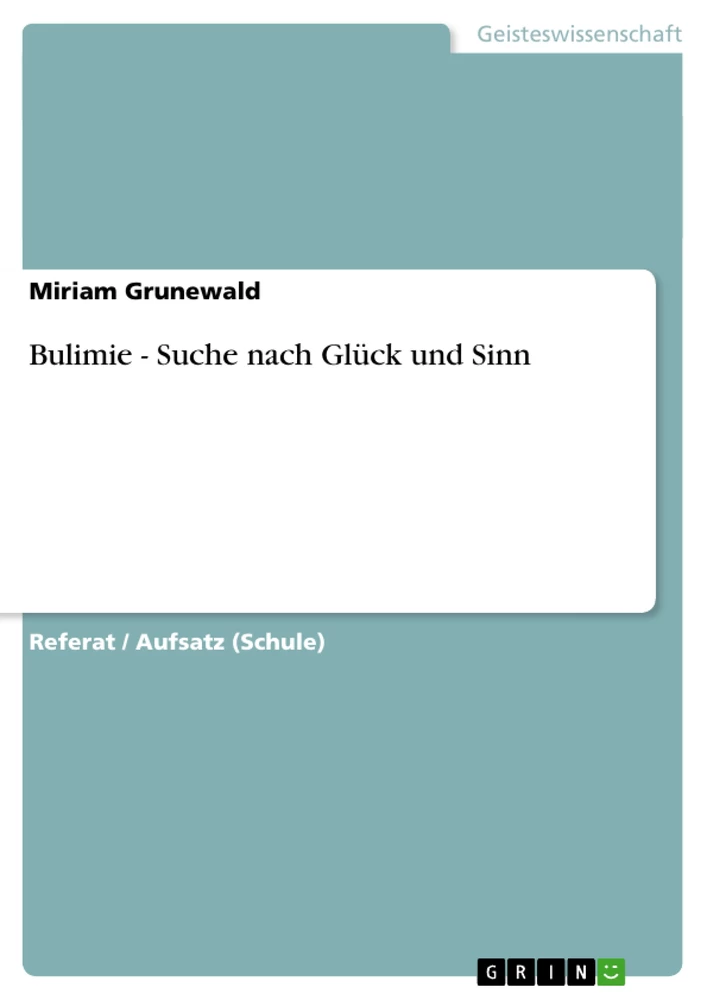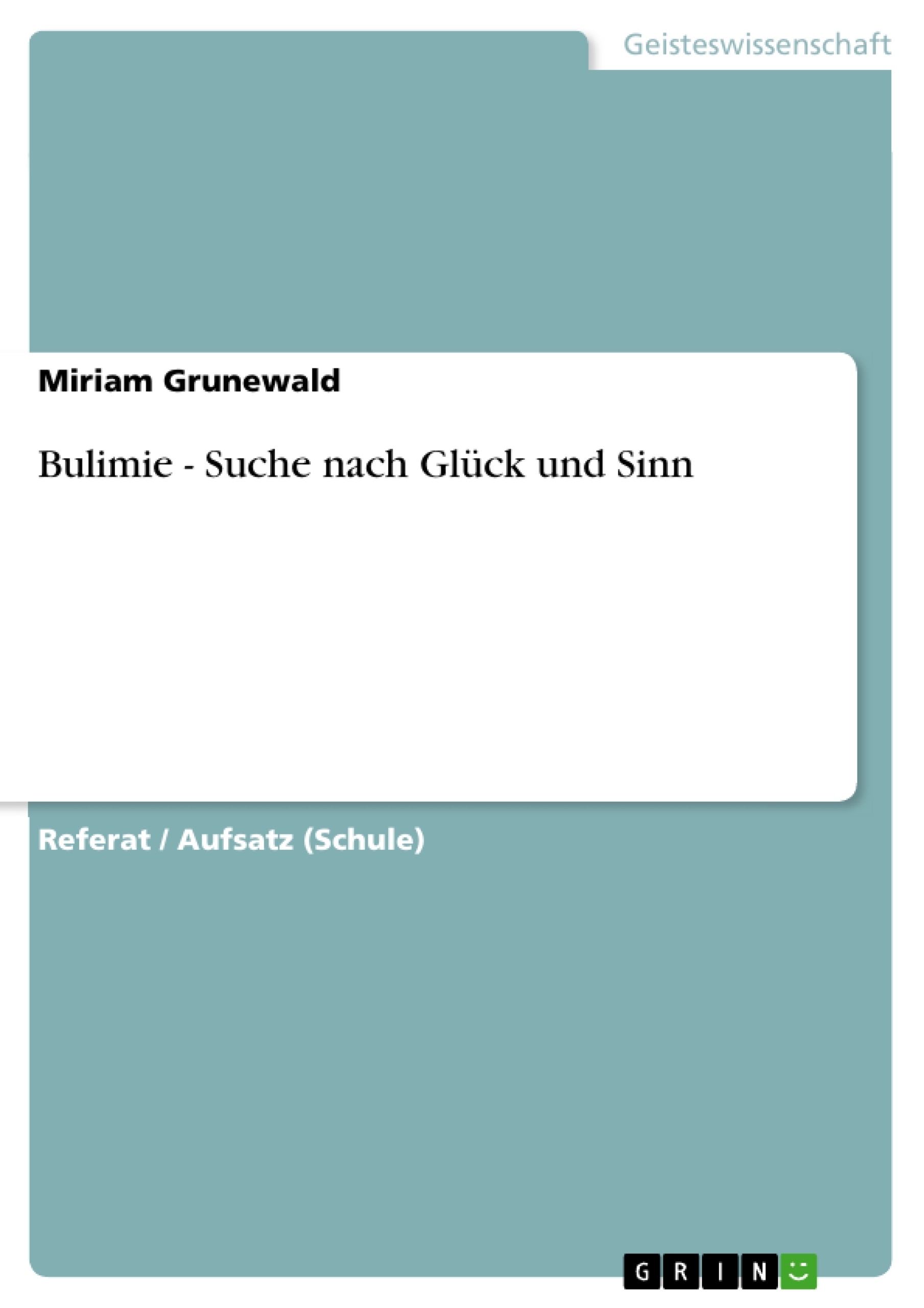Stell dir vor, dein Leben ist ein perfekt gedeckter Tisch, doch du darfst nur die Krümel essen, die herunterfallen. Dieses Buch enthüllt die verborgene Welt der Bulimie, einer heimtückischen Essstörung, die weit mehr ist als nur ein Kampf mit dem Gewicht. Es ist ein tiefgreifender Einblick in die psychischen Ursachen, die Betroffene in einen Teufelskreis aus Essanfällen und kompensatorischem Verhalten treiben. Angefangen bei den gesellschaftlichen Idealen, die ein unrealistisches Schönheitsbild propagieren, bis hin zu den persönlichen Traumata und dem Mangel an Selbstwertgefühl, werden die komplexen Wurzeln dieser Erkrankung beleuchtet. Erfahre mehr über die verheerenden körperlichen Folgen, von Elektrolytstörungen und Zahnschäden bis hin zu schwerwiegenden Herzproblemen, sowie über die psychischen und sozialen Auswirkungen, die zu Isolation, Depressionen und sogar Kriminalität führen können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der oft übersehenen Bulimie bei Männern, deren Leiden häufig falsch diagnostiziert oder ignoriert wird. Doch es gibt Hoffnung! Dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, von stationären und ambulanten Behandlungen bis hin zur Familientherapie, und zeigt Wege auf, wie Betroffene sich aus dem Teufelskreis befreien und ein gesundes, erfülltes Leben führen können. Es ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Betroffene, Angehörige und Fachleute, die ein tieferes Verständnis für diese komplexe Krankheit entwickeln und wirksame Unterstützung leisten wollen. Entdecke die Wahrheit hinter der Fassade und finde den Weg zu Heilung und Selbstakzeptanz. Lass dich von den vielfältigen Therapieansätzen inspirieren und gewinne neue Perspektiven für ein Leben ohne Esszwang. Dieses Buch ist dein Schlüssel zum Verständnis und zur Überwindung der Bulimie.
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitende Bemerkung
1. Ursachen und Wege in die Bulimie
2. Symptom Bulimie
3. Folgen
3.1. körperliche Folgen
3.2. psychische und soziale Folgen
4. Bulimie bei Männern
5. Therapiemöglichkeiten
6. Anhang
0. Einleitende Bemerkung
Eßgestörte haben alle eins gemeinsam: sie befinden sich in dem Irrglauben, das Erreichen ihres Schönheitsideals könne sie glücklich machen.
Teilweise tut es das zwar auch, bulimische Anfälle sind für die meisten Bulimiker die einzige Möglichkeit sich entspannen zu können und die Leere zu verbannen, doch macht es sie krank. Nicht nur körperlich, sie verfallen auch psychisch.
Ihre Art der Problembewältigung treibt sie immer tiefer in die Sucht, manche gar in den Tod.
1. Ursachen und Wege in die Bulimie
Da Bulimie eine psychosomatische Störung des Eßverhaltens ist, liegen die Ursachen dieser Suchterkrankung in der Psyche der Patientin.
Studien zufolge besteht bei eineiigen Zwillingen ein um 50 % erhöhtes Risiko, daß beide an Bulimie erkrankten. Dies deutet darauf hin, daß es biologische Faktoren gibt, die zumindest begünstigend auf die Entstehung einer Eßstörung einwirken. Der Grund dafür könnten aber auch die Bedingungen sein, unter denen sie aufwachsen und die ja bei beiden gleich sind.
Schlankheit und gutes Aussehen haben in unserer Gesellschaft eine sehr große Bedeutung. Vor allem Frauen werden oft nur auf ihr Äußeres reduziert, was zur Folge hat, daß viele sich selbst auf ihr Aussehen reduzieren.
Das Selbstbewußtsein und Selbstwertgefühl von Bulimikern hängt in hohem Maße von Ihrem äußeren Erscheinungsbild ab. Sie verinnerlichen das gesellschaftliche Schönheitsideal und machen es zu ihrem eigenen.
Dieses Streben nach Perfektion, das viele Bulimiker gemeinsam haben, äußert sich aber nicht nur in ihrem gestörten Eßverhalten, sondern auch in anderen Bereichen ihres Lebens. Beispielsweise der „perfekt aufgeräumten“ Wohnung, dem „guten“ Job und der „glücklichen“ Partnerschaft, die sie versuchen zu führen. Sie sind der Meinung glücklich zu werden, indem sie andere glücklich machen und sich die Liebe anderer erarbeiten zu müssen.
Viele Bulimiker wurden in ihrer Kindheit vernachlässigt und nicht ernst genommen.
Oft spielen dabei auch Geschwister, die bevorzugt wurden und zu denen sie somit in Konkurrenz standen, eine große Rolle. So versuchten sie dann die Aufmerksamkeit und Anerkennung ihrer Eltern, besonders der Mütter, durch besonderen Fleiß zu erlangen.
In diesem Zusammenhang ist oft von einem „negativen Mutterkomplex“ die Rede.
2. Symptom Bulimie
Die Ursachen von Magersucht und Bulimie sind sehr ähnlich, die Übergänge zwischen beiden Erkrankungen fließend. Viele Bulimiker haben vor Ausbruch der Krankheit Magersuchtphasen.
Das Leitsymptom der Bulimie sind die Freßanfälle, in denen die Betroffenen binnen kürzester Zeit Nahrungsmittel mit bis zu 10 000 Kilokalorien und mehr essen. Währen dieser Freßattacken verlieren sie die Kontrolle über sich und können ihr Verhalten nicht mehr bewußt steuern. „Die Frau steht fassungslos, manchmal sarkastisch lächelnd, daneben und sieht sich selbst zu.“ (1)
Nach dem Freßanfall schämen sich die Frauen über ihr zügelloses und impulsivhaftes Verhalten. Um einer Gewichtszunahme vorzubeugen und sich dem als „Gift“ empfundenen Essen wieder zu entledigen, erbrechen sich ca. 90% der Betroffenen.
Diese bulimischen Anfälle können sich über Stunden hinziehen und sind bei vielen Bulimikerinnen schon fester Bestandteil des Tagesablaufes.
Zusätzlich ergreifen die meisten Bulimiepatienten weitere gewichtsregulierende Maßnahmen. Sie halten zwischen den Anfällen streng Diät, treiben übermäßig Sport, nehmen Appetitzügler, Abführmittel und harntreibende Mittel.
Hinzu kommt, daß sich die Betroffenen permanent mit dem Thema Essen beschäftigen und auch ständig Hunger empfinden. Ihre Gedanken kreisen dabei immer um ihr Gewicht, von dem zu einem großen Teil ihr Selbstwertgefühl abhängt.
Das Körpergewicht von Bulimikern liegt dabei im Normalgewicht, weist aber Schwankungen von bis zu 5 kg auf.
3. Folgen
3.1. Körperliche Folgen
Durch die gestörte Nahrungsaufnahme kommt es zu Störungen im Elektrolythaushalt (kalium-, Calciummangel) und niedrigem Blutdruck, infolge derer es zu Müdigkeit, Antriebsmangel und Konzentrationsstörungen kommen kann.
Die Folgen des häufigen Erbrechen sind jedoch viel schwerwiegender :
der Schließmechanismus am Mageneingang kann gestört werden so das auch ohne Erbrechen Säure in die Speiseröhre gelangen kann (Reflux Krankheit). Da die Speiseröhre gegen Säure nicht geschützt ist, kann es zu Verätzungen und Entzündungen kommen, Speiseröhrenkrebs kann auch nicht ausgeschlossen werden.
Da die Säure auch den Zahnschmelz angreift, sind die Zähne vieler Bulimiker an der Rückseite regelrecht abgeschliffen und stark kariös.
Selten kommt es infolge heftiger bulimischer Anfälle zum Einreißen der Schleimhaut des Mageneinganges oder zum Bersten der Magenwand.
50 % der weiblichen Bulimie Patienten haben einen unregelmäßigen Zyklus oder gar keine Menstruation.
Infolge des Mißbrauchs von Abführmitteln und dem damit verbundenen Kaliummangel können Herzrythmusstörungen, Muskelschwäche und bleibende Nierenschäden auftreten. Appetitzügler können Nervosität und Schlafstörungen hervorrufen.
3.2. Psychische und soziale Folgen
Die psychischen Folgen können nicht nur als Folgen der Bulimie betrachtet werden, sondern resultieren vielmehr aus der Persönlichkeitsstörung, die ihr zugrunde liegt.
Sie versuchen durch die Bulimie nur ein Ideal zu erreichen um ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Da sie diesem Ziel jedoch nicht näher kommen, sinkt ihr Selbstwertgefühl noch weiter ab.
Das Gefühl der Hilflosigkeit ihrer eigenen Krankheit gegenüber, die sie auch als solche erkennen, lässt sie depressiv werden. Im Alltag sind sie oft ängstlich, hilflos und angespannt. Ihr Schamgefühl und die Bemühungen die Krankheit zu verbergen treibt sie oft in die soziale Isolation. Zuletzt dreht sich ihr ganzes Leben nur noch um Essen, um Hunger, um die Beschaffung der für die heftiger werdenden Freßanfälle nötigen Lebensmittel.
„Einige sind nicht mehr arbeitsfähig, sind verwahrlost, chaotisch, werden kriminell, um die riesigen Eßmengen für die Attacken zu beschaffen, einige prostituierten sich. Einige fressen Müll im wahrsten Sinne des Wortes, andere eine Brühe aus Mehl und Wasser.“ (2)
Die Betroffenen geraten so in einen Teufelskreis aus Fasten, dem daraus resultierenden Heißhunger und den folgenden Freßattacken mit anschließenden gewichtsregulierenden Maßnahmen, aus dem sie sich ohne ärztliche Hilfe nicht befreien können.
4. Bulimie bei Männern
Der Anteil der Männern unter den Bulimikern macht nur etwa 5 % aus, was daran liegen könnte, dass die Anforderungen an sie, auch an ihr Aussehen, nicht so groß sind wie bei Frauen.
Das Krankheitsbild der Bulimie bei Männern ist dem von Frauen sehr ähnlich. Der größte Unterschied besteht darin, daß Männer nicht an Amenorrhoe (Ausbleiben der Menstruation) leiden, sondern in ca. 80 % der Fälle an einem erniedrigten Testosteronspiegel mit der damit verbundenen mangelnden sexuellen Aktivität und oft auch Impotenz.
Die Ursachen sind bei Männern ähnlich wie bei Frauen. Auch sie leben größtenteils sozial isoliert.
Problematisch ist die Seltenheit männlicher Bulimiker dahingehend, daß ihre Krankheit oft übersehen oder falsch diagnostiziert wird.
5. Therapiemöglichkeiten
Die Therapie von Bulimikern besteht nicht nur aus der Wiederherstellung des Eßverhaltens, sondern zum größten Teil aus der psychischen Therapie der ihm zugrunde liegenden Ursachen.
Im Groben gibt es drei Therapieformen: die stationäre Therapie, die ambulante Therapie und die Familientherapie, die besonders für junge Patienten geeignet ist.
Ob ein Betroffener stationär behandelt wird, hängt unter anderem davon ab, ob er stark depressiv ist, medikamentenabhängig oder stark suizidgefährdet.
Welche Therapie gewählt wird, muss aber für den einzelnen Patienten individuell entschieden werden.
Da viele Ärzte und Therapeuten, vor allem in ländlichen Gebieten, keine Erfahrung im Umgang mit Eßstörungen haben, sollten sich Betroffene an Beratungsstellen wenden, um qualifizierte Fachärzte zu finden.
Generell ist die Zahl der Therapieangebote und Fachkliniken in den letzten Jahren gestiegen, so daß auch die Erfolgschancen größer geworden sind.
6. Anhang
Literaturverzeichnis
Barmer Ersatzkasse : Eßstörungen bei Kindern und Jugendlichen.
Informationen für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. Echo-Verlag. Köln
Bruch, Hilde : Eßstörungen. Zur Psychologie und Therapie von Übergewicht
und Magersucht. Fischer Taschenbuchverlag GmbH. Frankfurt am Main 1991
Bünting, Karl-Dieter : Deutsches Wörterbuch. Iris-Verlag. Chur/Schweiz 1996
Cuntz, Ulrich, Hillert, Andreas : Eßstörungen - Ursachen, Symptome, Therapien. C.H.Beck Verlag. München 1998
Göckel, Renate : Endlich frei vom Eßzwang. Kreuz-Verlag. Stuttgart 1992
Keppler, Cordula : Bulimie. Wenn Nahrung und Körper die Mutter ersetzen. Walter-Verlag. Solothurn u. Düsseldorf 1995
Internetquellen
www.beratung-therapie.de/krankheitsbilder/essstoerungen/essstoerungen.html
Quellenverzeichnis
(1) Keppler, Cordula : Wenn Nahrung und Körper die Mutter ersetzen
Häufig gestellte Fragen
Was ist Bulimie und was sind die Hauptursachen?
Bulimie ist eine psychosomatische Essstörung, bei der Betroffene unter wiederholten Essanfällen leiden, gefolgt von Maßnahmen zur Verhinderung von Gewichtszunahme, wie Erbrechen, Fasten, übermäßiger Sport oder der Missbrauch von Abführmitteln. Die Ursachen liegen hauptsächlich in der Psyche und können durch biologische Faktoren, gesellschaftliche Ideale von Schlankheit, Perfektionismus, geringes Selbstwertgefühl und traumatische Kindheitserlebnisse begünstigt werden.
Welche Symptome treten bei Bulimie auf?
Das Leitsymptom sind die Fressanfälle, bei denen Betroffene große Mengen an Nahrungsmitteln in kurzer Zeit konsumieren und dabei die Kontrolle verlieren. Nach den Anfällen treten Schamgefühle auf, gefolgt von Maßnahmen zur Gewichtsregulation wie selbstinduziertem Erbrechen, Diäten, Sport oder dem Gebrauch von Abführmitteln. Betroffene beschäftigen sich permanent mit Essen und ihrem Gewicht.
Welche körperlichen Folgen hat Bulimie?
Bulimie kann zu Störungen im Elektrolythaushalt, niedrigem Blutdruck, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen führen. Häufiges Erbrechen kann die Speiseröhre schädigen (Refluxkrankheit, Speiseröhrenkrebs), den Zahnschmelz angreifen und zu Karies führen. In seltenen Fällen kann es zu Einrissen der Magenschleimhaut oder zum Bersten der Magenwand kommen. Bei Frauen kann der Menstruationszyklus unregelmäßig werden oder ausbleiben. Der Missbrauch von Abführmitteln kann Herzrhythmusstörungen und Nierenschäden verursachen.
Welche psychischen und sozialen Folgen hat Bulimie?
Bulimie kann zu einem Teufelskreis aus Fasten, Heißhunger und Fressattacken führen. Betroffene entwickeln Gefühle der Hilflosigkeit und Depression. Sie versuchen, durch das Erreichen eines Schönheitsideals ihr Selbstwertgefühl zu steigern, scheitern jedoch und isolieren sich sozial. Im Extremfall kann dies zu Arbeitsunfähigkeit, Verwahrlosung und kriminellem Verhalten führen.
Gibt es Bulimie auch bei Männern?
Ja, Bulimie tritt auch bei Männern auf, jedoch seltener als bei Frauen (ca. 5% der Fälle). Das Krankheitsbild ist ähnlich wie bei Frauen, jedoch leiden Männer nicht unter Amenorrhoe, sondern häufig unter einem erniedrigten Testosteronspiegel, der zu sexuellen Problemen führen kann.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei Bulimie?
Die Therapie von Bulimie besteht aus der Wiederherstellung eines normalen Essverhaltens und der psychischen Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen. Es gibt verschiedene Therapieformen wie stationäre Therapie, ambulante Therapie und Familientherapie. Die Wahl der Therapie hängt von den individuellen Bedürfnissen des Patienten ab.
Wo finde ich Hilfe bei Bulimie?
Betroffene können sich an Beratungsstellen wenden, um qualifizierte Fachärzte und Therapeuten zu finden. Die Zahl der Therapieangebote und Fachkliniken ist in den letzten Jahren gestiegen, was die Erfolgschancen erhöht.
- Quote paper
- Miriam Grunewald (Author), 2001, Bulimie - Suche nach Glück und Sinn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105044