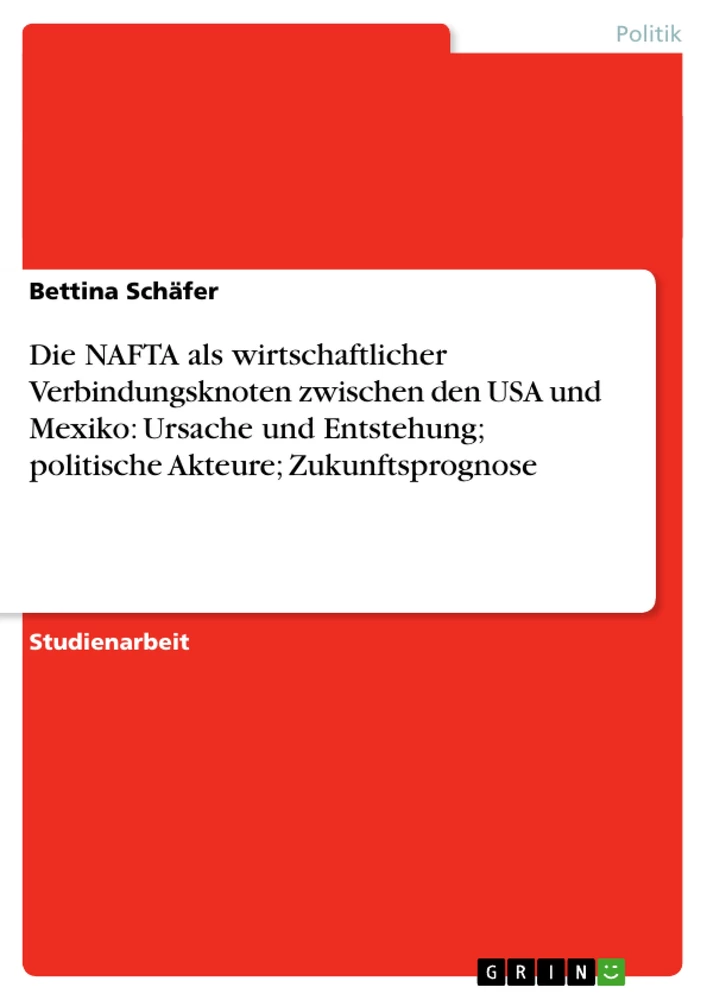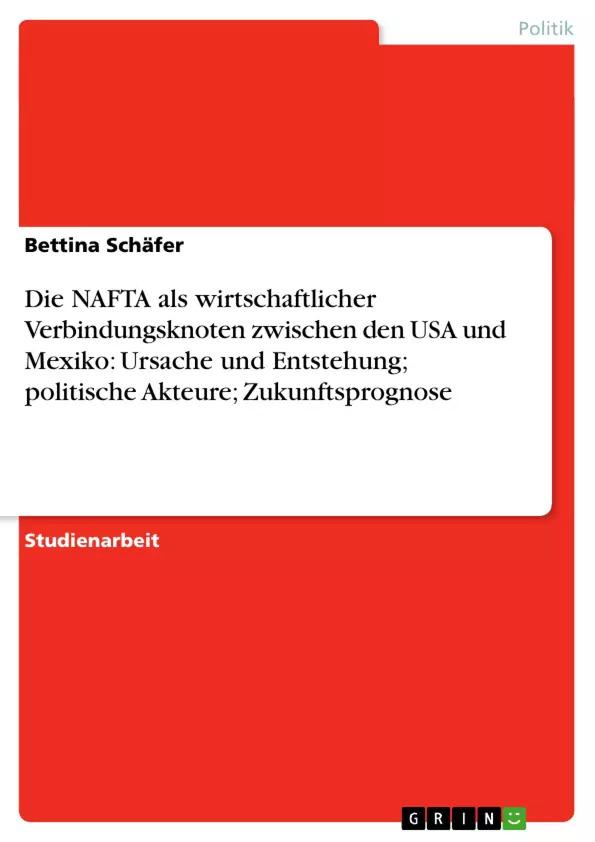Inhaltsverzeichnis:
Einführung
1.1. Problemerläuterung und Fragestellung
1.2. historischen Hintergründe
Hauptteil
2. die NAFTA
2.1. eine wirtschaftliche Einführung
2.2. politische Entstehungschronologie 1990-1994
3. Außenpolitik im Wandel
3.1. Beitrittsmotive
3.2. politische Akteure
3.2.1. Grundsteinleger Bush -
3.2.2. Fertigsteller Clinton
3.2.3. Kooperationsbereitschaft unter Salinas
4. Veränderungen in Mexiko durch Zedillo -
5. Schlussteil
6. Zukunftsprognosen unter George W. Bush und Vincente Fox -
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Einführung
1.1. Problemerläuterung und Fragestellung
Bestand der Hausarbeit ist das politische Verhältnis zwischen der USA und ihrem Nachbarstaat Mexiko. Aus den historisch prägenden Erfahrungen mit den Nordamerikanern hat sich eine starke Aversion entwickelt, woraus sich eine höchst brisante Außenpolitik beider Nationen entwickelt hat. Schaut man in die junge Vergangenheit zurück, stößt man auf die NAFTA, das Freihandelsabkommen der USA und Kanada mit Mexiko. Diese wirtschaftliche Kooperation wirft die Frage auf, welche Veränderungen es in der Außenpolitik beider Nationen gegeben hat, um die NAFTA in die Wirklichkeit um zusetzten. Um eine Antwort darauf zu geben, werde ich nach einem Exkurs in die Historie und einer kurzen Einführung in das Projekt NAFTA Gründe für ein verändertes Verhältnis in der Außenpolitik und deren Akteure suchen. Abschließend werde ich versuchen, Zukunftsprognosen für die Amtsperiode der neuen Präsidenten Buch und Fox abzugeben.
1.2. historischen Hintergründe
Angefangen hat alles mit der von James Monroe am 02.12.1823 propagierte Doktrin der amerikanischen Außenpolitik, die besagt, dass sich die USA nicht in die inneren Angelegenheiten europäischer Mächte einmischt. Weiter bestimmte sie die gesamte westliche Hemisphäre zur Einfluss- und Sicherheitszone der USA.1 Die anfangs eher defensiv gemeinte Doktrin entwickelte in der imperialistischen Außenpolitik eine Schutzfunktion der westlichen Hemisphäre, die der USA als Rechtfertigung für ihren praktizierten Interventionismus diente.2 Der Expansionsdrang der Amerikaner, der sie sog. „frontier“ immer weiter gen Westen drang, forderte neben indianischen Siedlungsgebieten fast die Hälfte des damals noch territorial- größeren Nachbarn Mexiko. Es fielen Arizona, Kalifornien, Nevada, Neu Mexiko, Utah und Teile von Colorado und Wyoming an die USA (Vertrag von Guadalupe 1848). Der Krieg, der diese Verluste zur Folge hatte, wird von den Mexikanern als einer der ungerechtesten in der Geschichte der imperialistischen Expansion gesehen.3
Theodore Roosevelt, 26. Präsident der Vereinigten Staaten (1901-1909) vertrat die sog. „open-door policy“, die einer Polizeifunktion für Lateinamerika gleich kam, welche die US- amerikanische Außenpolitik erstmals während der mexikanischen Revolution (1910-1917) und der postrevolutionären Phase anwendete. Tolerierung oder Nichtakzeptanz von Revolutionsführern, Stabilisierung oder Destabilisierung von Regierungen, Vergabe oder Zurückhaltung politischer, finanzieller und militärischer Unterstützung sowie der Abzug von Industrieunternehmen kamen einer differenzierten Art der Intervention in die mexikanische Innenpolitik gleich. Sie taten dies, um die politische Stabilität ihres Nachbarn zu stärken, woraus eine Regierung resultieren sollte, die ein Garant für das amerikanische Eigentum in mexikanischem Territorium darstellen sollte.
Nach der Revolution war jegliches einmischen der USA in innere Angelegenheiten negativ besetzt, Präsidenten wie Carranza kritisierten die Monroe Doktrin scharf und gestanden ihr keine legitime Rechtmäßigkeit zu.4
Hauptteil
2. die NAFTA
2.1. die NAFTA, eine wirtschaftliche Einführung
Seit dem 01.04.1994 besteht die Freihandelszone NAFTA (North American Free Trade Agreement) zwischen den USA, Kanada und Mexiko, welche neben der EU die größte Freihandelszone ist. Ziele der NAFTA sind die Liberalisierung von Handel, Dienstleistungen und Investitionen zwischen den Vertragspartnern. Dazu sollen Zölle und Quoten bis 2009 komplett abgebaut werden, um Handel und gegenseitige Investition zu fördern. Allgemeine/Grundlegende Auswirkungen des NAFTA Abkommens sind neben dem bilateralen Handelspielraum im Exportsektor niedrige Kosten im Importsektor sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen. Auswirkungen auf die mexikanische Wirtschaft sind einerseits eine hohe Abhängigkeit von der amerikanischen Wirtschaft durch die starke Anlehnung an deren Absatzmarkt, andererseits steigt durch die NAFTA die Attraktivität des Landes für ausländische Investoren.5 Es sollte der erste Schritt zur Bildung eines gemeinsamen Freihandelsraum in der westlichen Hemisphäre sein.6
2.2. politische Entstehungschronologie 1990-1994
Mitte des Jahres 1990 wurde das Projekt NAFTA von dem damaligen Präsidenten Carlos Salinas de Gortari vorgeschlagen. Im Laufe des nächsten Jahres liefen die Verhandlungen mit der US-amerikanischen Regierung und Präsidenten George Bush an, Kanada zeigte sich kooperativ und stieg in die Verhandlungen mit ein. Im August 1992 wurde das über 2000 Seiten lange Vertragswerk fertig gestellt, so dass im Dezember desselben Jahres es von den Vertragspartnern unterzeichnet werden konnte.7
Nach Protesten seitens des amerikanischen Volkes über Mängel des Vertrages in den Bereichen Umwelt und Arbeitnehmerrecht wurden unter der neu gewählten Clinton Administration Nachverhandlungen angesetzt, welche im August 1993 erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Am 14.09.1993 wird das Zusatzabkommen zur gleichen Zeit von dem amerikanischen Präsidenten Clinton, dem mexikanischen Präsidenten Carlos Salinas und der kanadischen Premierministerin Campbell unterzeichnet. Im November wird das Vertragswerk von den landeseigenen politischen Institutionen ratifiziert. Schließlich tritt das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada am 01.01.01994 rechtmäßig in Kraft.8
3. Außenpolitik im Wandel
Nach dem Ende des Kalten Krieges vollzog sich ein Wandel in der Außenpolitik der USA im Bezug auf ganz Lateinamerika. Er brachte eine Änderung des Sicherheitskonzeptes mit sich, Probleme der lateinamerikanischen Staaten wie instabile politische Verhältnisse, krisenanfällige Ökonomien, große Ungerechtheit der Einkommensverteilung sowie der Drogenhandel wurden auf die vorderen Ränge der außenpolitischen Prioritätsliste verrückt.9
Nach dem Wegfall der kommunistischen Bedrohung (Kuba ist wohl in dieser Hinsicht in keiner Weise, trotz kommunistischem System, eine Bedrohung) wurde nun Betonung auf a. die Konsolidierung der Demokratie b. die Verteidigung der Menschenrechte und c. die Förderung der freien Marktwirtschaft gelegt, wobei bei Punkt a und c fraglich ist, wenn man c als Förderung des Globalisierungsprozesses sieht, ob sie einen Gegensatz darstellen, oder ob sie miteinander verträglich sind. Ich verweise an dieser Stelle auf einen interessanten Beitrag von Alessandro Pinzani.10
Dies stellen die wesentlichen Grundelemente der US- amerikanischen Außenpolitik dar, wie sie für die Bush Administration und der Clinton Administration von nun an von Bedeutung waren.11 Die mexikanische Außenpolitik zielte seit dem 20. Jahrhundert genau darauf ab, eine direkte oder indirekte Einflussnahme der USA zu verhindern. Das Souveränitätsverständnis baut auf dem Recht der Selbstbestimmung und der freien Wahl der Regierungsform auf, welches gleichzeitig jegliche Art von Intervention wie militärische oder politische Einmischung in innere Angelegenheiten eines Staates missbilligt. Aus diesem Verständnis heraus verurteilte schon damals der mexikanische Präsident Carranza die Monroe Doktrin als er sagte:
„Diese Doktrin verletzt die Souveränität und Unabhängigkeit Mexikos und sie stellt für alle amerikanischen Nationen eine erzwungene und unannehmbare Vormundschaft dar.“
Wendepunkt der Außenpolitik war hier die Finanzkrise 1982, die USA half Mexiko mit großzügigen Krediten (aus nicht uneigennützigen Gründen), und es wurde klar, dass sich durch wirtschaftliche Integration mit dem Norden die Wirtschaft im eigenen Land auf längere Sicht stabilisieren würde. Der gewollte Partikularismus musste um der Wirtschaft Willen aufgegeben werden12, denn das alte Wirtschaftssystem hatte ausgedient.13
3.1. Beitrittsmotive
Das Vertragswerk NAFTA ist insofern ein außergewöhnliches Abkommen, zumal es sich bei den Vertragspartnern um zwei Industrienationen und ein Schwellenland handelt. Dementsprechend folgt der Beitritt aus verschiedenen Motivationen heraus.
Der Initiator Mexiko hat sich zweifellos zum langfristigen Ziel gesetzt, von einem Schwellenland in die Ländergruppe der ersten Welt aufzusteigen. Die mexikanische Regierung erhofft sich mit ihrer aktiven Handlungspolitik eine Ankurbelung der Wirtschaft und eine Verbesserung des Lebensstandards. Konkrete wirtschaftliche Ziele sind die Konsolidierung des aus den 80er Jahre stammenden Reformkurses, Deregulierung14, Privatisierung und außenwirtschaftliche Öffnung. Die USA, die über eine stabile Wirtschaft verfügen, haben wiederum ganz andere Beweggründe:
a. mit einem amerikanischen Wirtschaftsblock wird die weltwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der USA gegenüber der Europäischen Union und Japan gestärkt
b. Stabilisierung der längerfristigen Produktionen, Investitionen sowie dem Export in die Nachbarstaaten
c. Absatzsicherung der eigenen Produkte auf den benachbarten Märkten
d. Sicherung der strategischen wichtigen Rohstoffen (primär Erdöl aus Mexiko)
e. Förderung der innenpolitischen Stabilität und von demokratischen Reformen im politisch labilen Nachbarstaat Mexiko durch politische Anbindung an den amerikanischen Norden15
Bei diesen Gründen, die aus wirtschaftlichen aber auch aus politischen Motiven aus herrühren, muss man sich jedoch immer im Gedächtnis behalten, dass die Außenpolitik der USA nie aus altruistischen Beweggründen entstanden ist, auch wenn sie diese selbst in den Vordergrund stellen, sondern immer bedacht auf ihren eigenen Nutzen.
3.2. Politische Akteure
Schon in den 60er Jahren wurde das Projektes eines gemeinsamen Marktes zwischen Mexiko, Kanada und der USA unter Präsident Johnson diskutiert, Präsident Carter griff die Idee erneut Ende der 70er Jahre auf, und auch Präsident Reagan machte in den 80er Jahren den Vorschlag dazu. Es macht deutlich, dass sich die US Regierungen schon damals und bis in die 90er Jahre bewusst waren, dass ein gemeinsamer Markt sowohl die Position der USA auf dem weltwirtschaftlichen Markt stärken würde (gegenüber Japan und Westeuropa) und weiter von der Bedeutung der strategischen Rohstoffe und der Notwendigkeit auf deren Zugriff.
Mexikos Regierungen lehnten in der Vergangenheit den Vorschlag aus folgenden Motiven ab. Erstens wäre die mexikanische Wirtschaft reduziert worden auf die Lieferung von Rohstoffen, landwirtschaftlichen Produkten und billigen Arbeitskräften, und es wäre zu einer Marktwirtschaft gekommen, die an frühere Zeiten der Kolonialherrschaft erinnert. Zweitens war durch die asymmetrischen ökonomischen Bedingungen eine erhöhte Konkursanmeldung mexikanischer Unternehmen zu befürchten, da sie der Konkurrenz aus dem Norden nicht stand halten würden.16
3.2.1. Grundsteinleger Bush
Der 41. Präsident der Vereinigten Staaten, George Bush (Amtszeit 1889-1993) war ein politischer Pragmatiker, der auf „[...] persönliche Gipfeldiplomatie, auf Teamwork mit wenigen Vertrauten, auf Vorsicht und Kompromiss“(Zitat C. Hacke aus „Zur Weltmacht verdammt“ S.385) setzte. Er machte die Außenpolitik zu seiner wichtigsten Aufgabe, und vernachlässigte in seiner Amtszeit innenpolitische Probleme, die in die Wiederwahl kosteten.
Unter seinen außenpolitischen Aktivitäten gehört die Grundsteinlegung der NAFTA, womit er erstmals in der Geschichte ein Regionalkonzept amerikanischer Wirtschaftspolitik schuf.17 Das Entstehen dieses Vertrages ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Bush- Administration eingesehen hatte, dass die USA nach dem Ende des Kalten Krieges ihren Führungsanspruch in der wirtschaftlichen Weltordnung verloren hatte. Sie begannen mit dem Zusammenschluss anderer Staaten, um neben der wirtschaftlichen Konkurrenz aus Europa und Asien wettbewerbsfähig zu bleiben. Mexiko war und ist wegen seiner geographischen Begebenheit immer schon attraktiv für solche Vorhaben gewesen.18
3.2.2. Fertigsteller Clinton
Nach der Amtsübergabe hatte Bill Clinton eine schwierige Außenpolitik sowie ein wirtschaftlich geschwächtes Land vor sich. Um sich auf die innenpolitischen Probleme zu konzentrieren, ohne von außenpolitischen Angelegenheiten abgelenkt zu werden, benannte er als Außenminister W. Christopher und als Nationalen Sicherheitsberater A. Lake, die beide beträchtliche Erfahrungen zur Amtszeit Carters gesammelt hatten. Er betonte schon in seinem Wahlkampf, dass die Außenpolitik in Dienste erweiteter nationaler Interessen stehen sollte, denn sein Ziel war es aus dem Nutzen dieser eine Verbesserung der innenpolitischen, sozialen und ökonomischen Lage zu erreichen.19 Clinton widmete sich der inneren Erneuerung des Landes, weil er dies als die Vorraussetzung für eine aktive und globale Führungsrolle der USA sah.20
„Eine pro-demokratische Außenpolitik weder liberal, noch konservativ, weder demokratisch noch republikanisch ist; sie ist eine tief verwurzelte amerikanische Tradition, und zwar aus einem guten Grund. Weil keine Außenpolitik anhaltend erfolgreich sein kann, wenn sie nicht die dauerhaften Werte des amerikanischen Volkes wiederspiegelt Die Demokratie außerhalb unseren Landes schützt nun einmal auch intern unsere eigenen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen“ Bill Clinton21
Dem großen Engagement Clintons ist es zu verdanken, dass das Projekt NAFTA letzten Endes realisiert werden konnte. Denn in Amerika war man zunächst kritisch gegenüber dem neuen Handelsvertrag. Man befürchtete den Verlust von Arbeitsplätzen, eine Umgehung der Umweltgesetze und eine Invasion von asiatischen Billigexporten, die durch Mexiko Absatz in den USA finden konnten. Clinton reagierte darauf mit Nachverhandlungen, die Anfang August 1993 aus denen die gewünschten Verbesserungen in den Bereichen Umweltpolitik und Arbeitnehmerrecht resultierten. Clinton war immer ein Befürworter der NAFTA; denn er erkannte sie als eindeutige Chance für die amerikanische Wirtschaft an, als Schritt in Richtung internationaler Wettbewerbsfähigkeit und zur Rückgewinnung der globalen ökonomischen Führungsrolle. Es sollte der erste Schritt zur Bildung eines gemeinsamen Freihandelsraum in der westlichen Hemisphäre sein.22
Zu seinen großen außenpolitischen Erfolgen gehört auch die Verhinderung einer schweren Wirtschaftskrise in Mexiko 1994. Er war sich bewusst, dass wenn Mexikos Wirtschaft den Bach runter gehen würde, die amerikanische automatisch in Mitleidenschaft gezogen würde. Dementsprechend zeigte er beeindruckendes Engagement, den Kredit zu gewähren. Die Hälfte des 40 Milliarden Kredites schöpfte er aus dem Währungsstabilisierungsfond, den zweiten großen Teil bekam er nach eindringlichem Eingehen auf den IWF und die Europäern, die letzten nicht unbeträchtlichen 2,2 Milliarden nahm der Vorsitzende der amerikanischer Zentralbank von einer Schweizer Bank. Dank dieser Finanzspritze erholte sich die mexikanische Wirtschaft schneller als geplant, und die Regierung Clintons konnte durch vorzeitige Zurückzahlung eines großen Teil des Kredites eine halbe Milliarde Gewinn machen (Abschlusszinsen).23
3.2.3. Kooperationsbereitschaft unter Salinas
Am Datum 1988 wurde Carlos Salinas de Gortari zum Präsidenten gewählt. Es war das knappste Ergebnis in der Geschichte des PRI (Partido Revolucionario Institucional) Regimes, der Partei, die nach dem ende der mexikanischen Revolution die Regierung übernommen und, mit unkonventionellen Mitteln (Wahlbetrug), über Jahrzehnte lang regiert hatte. Zu deren Politik gehörte es, dass der amtierende Präsident (der nur eine Regierungsperiode lang das Amt ausführen konnte) seinen Nachfolger mittels des „dedazo“ bestimmte (Fingerzeig auf den nächsten Präsidenten). Salinas setzte die Wirtschaftspolitik seines Vorgängers De la Madrid, die Stabilisierung der Wirtschaft durch die eingeleitete marktwirtschaftliche Öffnung, fort.24 Er versuchte die innenpolitischen Spannungen durch eine aktive Außen- und Außenwirtschaftspolitik abzuschwächen. Es folgte unter seiner Regierung eine radikale Öffnung und Internationalisierung der mexikanischen Wirtschaft.25 Es entstand das Auslandsinvestitionsgesetz vom Mai 1989 zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen. Zur Internationalisierung prüfte man im Frühjahr 1990 außenwirtschaftliche Optionen in Richtung Ostasien und Europa, die zum Beitritt der APEC ( Asian Pacific Economic Cooperation) 1993 führten. Weitere Erst im Sommer 1990 eröffnete Salinas dem amerikanischen Präsidenten Bush das Interesse an einer Freihandelszone.26
Das Verhalten des mexikanischen Präsidenten zeigt neben dem Willen Mexiko zu einer stabileren Wirtschaft zu verhelfen, dass er die USA zwar als unumgehbare, jedoch zuletzt ausschöpfende Möglichkeit sieht, um Mexikos Wirtschaft durch andere Handelsverträge so viel Autonomie wie nur möglich gegen über der amerikanischen Wirtschaft zu gewähren. Trotzdem ist die NAFTA der bedeutendste Schritt in Richtung auf eine weltmarktintegrierte und exportorientierte Wirtschafts- und Entwicklungspolitik,27 die aber auch eine große Abhängigkeit von der nordamerikanischen Wirtschaft mit sich bringt.
Um in Mexiko einen höheren Lebensstandard zu erreichen, sagte auch Salinas den bis in den Anfang der 80er Jahre praktizierten Protektionismus ab und setzte sich für Handelsliberalisierung ein: „Queremos que México sea parte del primer Mundo y no del Tercero“28
4. Veränderungen unter Zedillo
1994 wurde Salinas von seinem Parteikollegen Ernesto Zedillo Ponce de Léon im Präsidentenamt abgelöst. Unter ihm überwand Mexiko die schwere Finanzkrise von 1994, seine Politik fand zu einem wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs zurück. Er verzichtete als erster Präsident auf den Fingerzeig „dedazo“, und mischte somit nicht in dem Nominierungsverfahren mit.
Unter Zedillo fanden erhebliche politische Wandlungen statt, wie die Wahlrechtsreform Ende 1996, die den Oppositionsparteien eine gewisse Chancengleichheit durch die regierungsunabhänigige Kontrolle eines Bundeswahlinstitutes gewähren wird. Zu weiteren Wandlungen gehört auch die Erscheinung und Etablierung einer wirklich unabhängigen Zeitung, der „Reforma“. Man kann, wenn man von Zedillo spricht ihn wirklich einen Reformer nennen.
Schlussteil
5. Zukunftsprognosen unter George W. Bush und Vincente Fox
Der amtierende Präsident George W. Bush versucht die Freihandelszone von Alaska bis Feuerland FTAA ("Free Trade Area of the Americas") voranzutreiben, um des Wohl des Kontinent Willen. Dies betonte er ausdrücklich auf dem Amerika Gipfel diesen Jahres (21.-23.04.) in Quebec. Als vorbildliches Beispiel nannte er die Handelsbeziehungen mit Mexiko, die sich in den ersten Jahren des Freihandelsabkommen zugunsten beider Länder verbessern konnte.
Der mexikanische Präsident Vincente Fox, dessen Land bereits in der nordamerikanischen Freihandelszone partizipiert, betonte das Demokratie nicht möglich sei in einer Gesellschaft wo es große Ungleichheit und Armut gebe. Deswegen sei es wichtig, die Ausbildung in den Ländern Lateinamerikas zu verbessern. Fox schlug vor, dass alle lateinamerikanischen Staaten ein Prozent ihrer Verteidigungsausgaben in einen Sozialfonds zahlen sollten.29
Demokratie ist die Grundlage für eine radikale Öffnung der Märkte, um von der Globalisierung keine negative Folgen davon zu tragen.
Vincent Fox (PAN - Partido Acción Nacional), der 2000 zum Präsidenten von Mexiko gewählt wurde, will versuchen, eine Umverteilung durch die „Revolution durch Marktwirtschaft“ zu erreichen. Ein Mann, der nicht nur durch seine
Parteiangehörigkeit frischen Wind in die Politik bringt (er ist der erste Präsident seit Ende der 20er, der nicht aus der PRI stammt), sondern auch wegen seines Charismas und seinem Regierungsstil (wenig Ideologie, viel Markt und konkrete Unterstützung für „gente trabajadora“), den er bereits als Gouverneur von Guanajuato unter Beweis gestellt hat.30
6. Fazit
Schlussbetrachtend kann man sagen, dass verschiedene Faktoren zu einer Veränderung des Verhältnisses Mexiko - USA geführt haben. Seitens der USA ist der prägnante Faktor das Ende des Kalten Krieges mit den Folgen in der Außenpolitik und im Wirtschaftssektor zu definieren.
Sicherheitspolitische Aspekte verloren ihre Bedeutung in der Außenpolitik, und die Neudefinition US- amerikanischer Beziehungen mit Mexiko basierte auf Demokratie, Integration und Handelsliberalisierung. Von dem letzten Punkt versprach man sich den wirtschaftlichen Führungsanspruch in der Weltordnung wieder zu gewinnen.31
Im Hinblick auf Mexiko ist der auslösende Faktor die Wirtschaftskrise von 1982 zu sehen, die eine Veränderung der Außenwirtschaftspolitik mit sich zog. Zur Stabilisierung der Wirtschaft entschloss man sich zur Absage an den Protektionismus und zu einer wirtschaftlichen Öffnung des Landes.
Der Wunsch nach Bewahrung der nationalen Souveränität und Identität beugt sich dem „Sachzwang“ zur Herausbildung von Großregionen, denn man kann eine gewisse Einbindung in die nördliche Wirtschaftregion nicht ignorieren, und eine Abschottung dieser Region würde einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage entgegen stehen.32
Hoffnung besteht für die Konsolidierung der Demokratie in Mexiko, die durch das wirtschaftliche Anbinden an die USA voran getrieben wird.
Die geschichtlichen Narben sind bei den Mexikanern längst nicht vergessen, auch wenn sie sich der USA wirtschaftlich öffnen tun sie dies nicht, weil die gemeinsame Geschichte in den Hintergrund gerückt ist, sondern aus dem wirtschaftlichen Zwang heraus. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Bündnis die Kluft der beiden Länder überwindet.
[...]
1 „Einführung in das Studium der iberischen und lateinamerikanischen Geschichte“ Karin Schüller, Münster 2000, S. 190-191
2 Lexirom Version 2.0 - Lexikon
3 „Mexiko: Außenpolitik zwischen Souveränität und Dependenz“ Linda Helfrich; Saarbrücken 1991 S.61
4 L. Helfrich 1991; S.62-63
5 „Wirtschaftsraum Lateinamerika“, deutscher Industrie- und Handelstag(Hrg.) Dagmar Boving & Dipl.-Vw. Ingrid Ott Bonn 1997, S. 11-14
6 „regionale Großmächte“, Hrsg. Th. Jäger und Wilfried von Bredow, Opladen 1994, S.30
7 Th. Jäger und Wilfried von Bredow, 1994, S. 28
8 „Lateinamerika Jahrbuch 1994“ Institut f. Lateinamerika-Kunde, Hrsg. Hartmud Sangmeister u.a. Frankfurt a. Main 1994, S.214-225
9 Th. Jäger und Wilfried von Bredow, 1994S. 27-28
10 „Demokratisierung als Aufgabe, lässt sich Globalisierung demokratisch gestalten?“ Alessandro Pinzani
11 „Der Staat in Lateinamerika“ Hrsg. Manfred Mols/ Josef Thesing, Mainz 1995 S. 439-440
12 L. Helfrich 1991 S.82-85, 159
13 Verweis auf die vier wirtschaftlichen Entwicklungsphasen ab 1950: „Freihandelszone in Nordamerika“ Harald Victor Proff, Wiesbaden 1994 S.75- 81
14 Lexirom: Deregulierung [lat.], Bez. für wirtschaftspolit. Maßnahmen, deren Ziel es ist, den staatl. Einfluß auf die Wirtschaft zu verringern und Entscheidungsspielräume für Unternehmen zu schaffen (v.)a. für Investitionen), um insgesamt wirtschaftl. Wachstum zu begünstigen und die Schattenwirtschaft einzudämmen. Dazu zählen u.)a. Maßnahmen der (Re- )Privatisierung, die Abschaffung wettbewerbl. Ausnahmebereiche sowie der Abbau ›bürokrat.
15 Th. Jäger und Wilfried von Bredow, 1994, S. 28-29
16 L. Helfrich, 1991 S.164-165
17 „Zur Weltmacht verdammt“ Christian Hacke, Berlin 1997 S. 386, 394
18 „Die Internationale Politik 1991-1992“ deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, Hrsg. W. Wagner, München 1995 S.276-277
19 Ch. Hacke 1997 S. 501-504
20 Ch. Hacke 1997 S. 508
21 zitiert nach Eduardo F. Costa in „der Staat in Lateinamerika“ Mainz 1995, S.440
22 Th. Jäger und W. von Bredow 1994, S. 30
23 Ch. Hacke 1997, S. 576
24 Harald V. Proff 1994 S. 80
25 „Politische Ökonomie von Wirtschaftsreformen: Mexiko 1982-1994“ Moritz Kraemer Frankfurt a.M. 1997, S. 175
26 „Mexiko heute“ Hrsg. Dietrich Brisemeister/Klaus Zimmermann, Frankfurt a.M. 1996 (2.Auflage), S. 97
27 „Der Wandel politischer Systeme“ Hrsg. Wilhelm Hofmeister/ Josef Thesing, Frankfurt a.M. 1996 S.258
28 zitiert nach W. Hofmeister, J. Thesing 1996 259
29 Welt-Artikel vom 23.4.01:
http://www.welt.de/daten/2001/04/21/0421wi248582.htx?search=
30 Welt-Artikel vom 4.12.00:
http://www.welt.de/daten/2000/12/04/1204fo206797.htx?search=
31 W. Wagner 1995, S .276
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Hausarbeit behandelt das politische Verhältnis zwischen den USA und Mexiko, insbesondere im Kontext der NAFTA (North American Free Trade Agreement).
Was ist die Hauptfragestellung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, welche Veränderungen es in der Außenpolitik der USA und Mexikos gegeben hat, um die NAFTA umzusetzen.
Welche historischen Hintergründe werden betrachtet?
Die Arbeit geht auf die Monroe-Doktrin, die Expansion der USA auf mexikanisches Territorium und die „open-door policy“ Theodore Roosevelts ein.
Was sind die Ziele der NAFTA?
Die NAFTA zielt auf die Liberalisierung von Handel, Dienstleistungen und Investitionen zwischen den USA, Kanada und Mexiko ab, indem Zölle und Quoten abgebaut werden.
Welche Motive hatten die USA und Mexiko für den Beitritt zur NAFTA?
Mexiko erhoffte sich, von einem Schwellenland in die Ländergruppe der ersten Welt aufzusteigen, während die USA ihre weltwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken und den Absatz ihrer Produkte sichern wollten.
Welche Rolle spielten George Bush und Bill Clinton bei der NAFTA?
George Bush legte den Grundstein für die NAFTA, während Bill Clinton Nachverhandlungen führte, um Bedenken in Bezug auf Umwelt und Arbeitnehmerrechte auszuräumen, und das Abkommen letztendlich durchsetzte.
Welche Veränderungen gab es in Mexikos Außenpolitik unter Präsident Salinas?
Salinas öffnete die mexikanische Wirtschaft und suchte nach internationaler Kooperation, was zum Beitritt zur NAFTA führte.
Was waren die Veränderungen in Mexiko durch Zedillo?
Unter Zedillo überwand Mexiko die schwere Finanzkrise von 1994, seine Politik fand zu einem wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs zurück. Unter Zedillo fanden erhebliche politische Wandlungen statt, wie die Wahlrechtsreform Ende 1996.
Welche Zukunftsprognosen werden unter George W. Bush und Vincente Fox gegeben?
George W. Bush versuchte die Freihandelszone von Alaska bis Feuerland FTAA voranzutreiben. Der mexikanische Präsident Vincente Fox betonte, dass Demokratie nicht möglich sei in einer Gesellschaft, wo es große Ungleichheit und Armut gebe.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Verschiedene Faktoren führten zu einer Veränderung des Verhältnisses Mexiko - USA. Seitens der USA ist der prägnante Faktor das Ende des Kalten Krieges mit den Folgen in der Außenpolitik und im Wirtschaftssektor zu definieren. Im Hinblick auf Mexiko ist der auslösende Faktor die Wirtschaftskrise von 1982 zu sehen, die eine Veränderung der Außenwirtschaftspolitik mit sich zog.
- Arbeit zitieren
- Bettina Schäfer (Autor:in), 2001, Die NAFTA als wirtschaftlicher Verbindungsknoten zwischen den USA und Mexiko: Ursache und Entstehung; politische Akteure; Zukunftsprognose, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105065