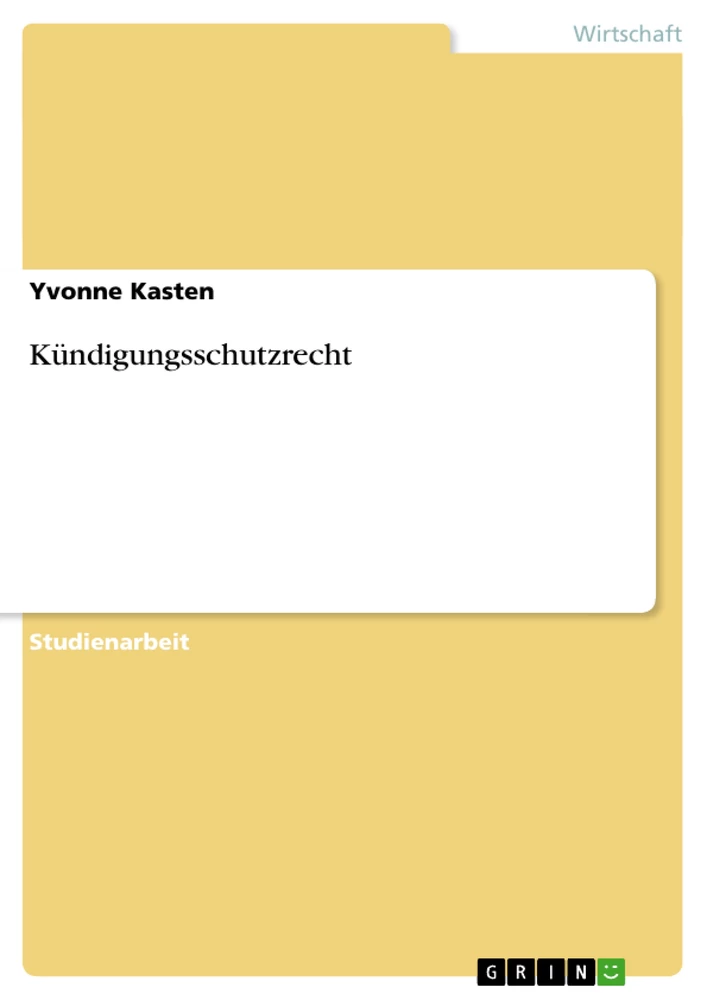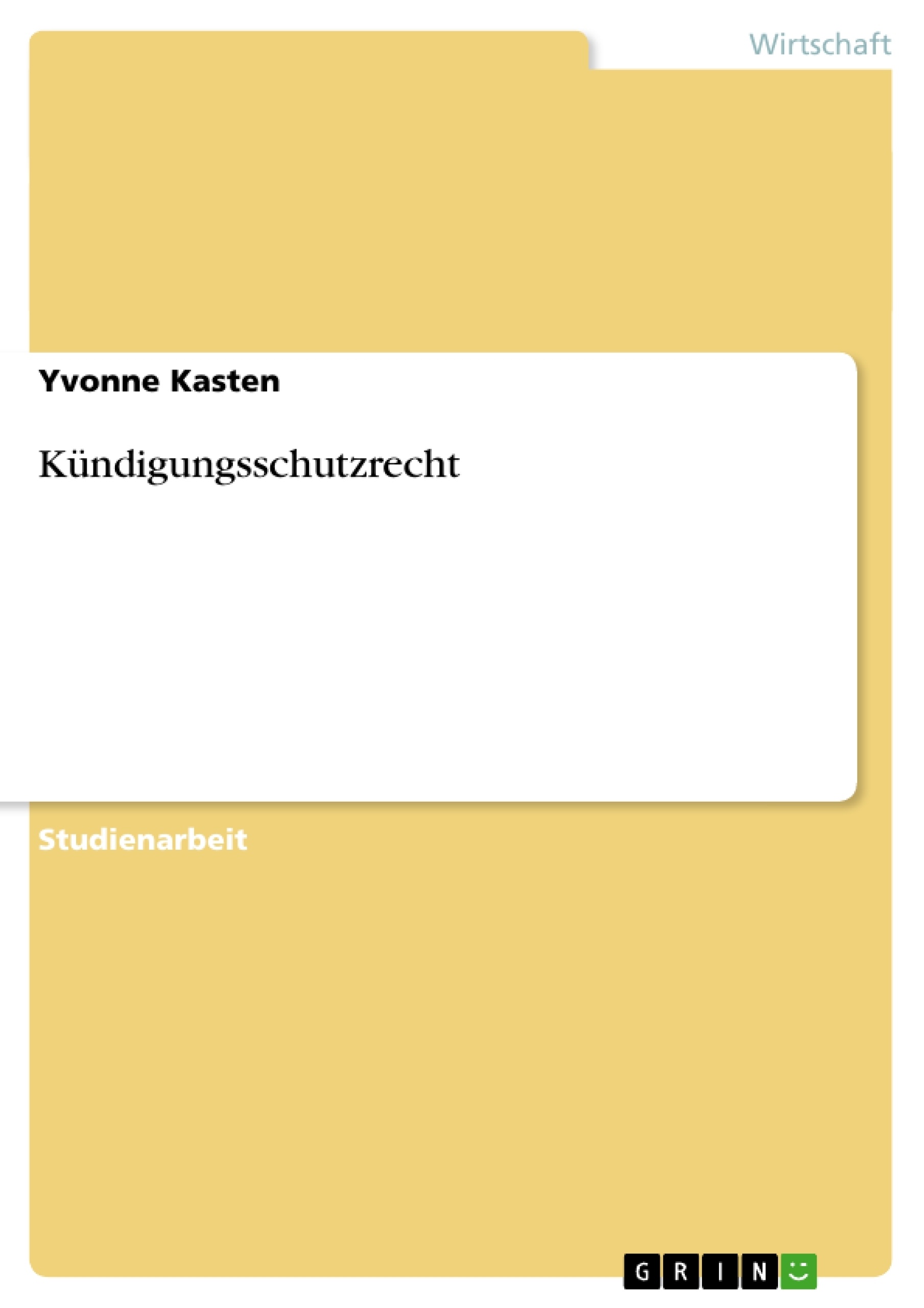Ein möglichst umfassender Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses ist aus der Sicht des Arbeitnehmers wünschenswert. Der Arbeitgeber ist im Gegensatz dazu daran interessiert, Flexibilität zu wahren, um in der Lage zu sein, seinen Personalbestand den wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen.
Der Arbeitnehmer kann im Einzelfall auch daran Interesse haben, das Arbeitsverhältnis schnell zu beenden, da er eine neue besser bezahlte Stelle in Aussicht hat. Der Arbeitgeber benötigt allerdings einen gewissen Zeitraum, um die Stelle neu zu besetzen. Aufgabe der Regelungen über den Bestandsschutz im Arbeitsverhältnis ist es deshalb, einen vernünftigen Ausgleich zwischen den Interessen der Beteiligten zu finden.
Das Ergebnis dessen ist ein komplexes System des Bestandsschutzes des Arbeitsverhältnisses. Es geht zum einen darum, die Fälle der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses durch Kündigung zu erfassen. Zum anderen ist aber auch die Frage des Bestandsschutzes bei der Befristung von Arbeitsverhältnissen von Bedeutung.
Das klassische Mittel der Beendigung von Arbeitsverhältnissen ist die Kündigung. Arbeitsverträge sind als Dauerschuldverhältnisse kündbar. Das BGB regelt hierzu in § 626 die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund, welche grundsätzlich nicht der Einhaltung einer Frist bedarf. Allerdings wird hier auf eine Unterscheidung zwischen einem Dienstvertrag und einem Arbeitsvertrag verzichtet. In § 622 BGB sind speziell für Arbeitsverhältnisse die Kündigungsfristen für die ordentliche Kündigung bestimmt. Im BGB wird aber keine Regelung über zulässige Kündigungsgründe oder Kündigungsschutzbestimmungen aufgeführt. Dazu ist das KSchG heranzuziehen, das auf einen Großteil der Arbeitsverhältnisse anzuwenden ist.
Eine Kündigung ist nach diesem Gesetz nur dann wirksam, wenn sie sozial gerechtfertigt ist. Die Regelungen des BGB allein sind also nur auf den Personenkreis derjenigen anwendbar, die nicht unter den persönlichen Anwendungsbereich des KSchG fallen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in das Allgemeine Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- 2. Die Anwendbarkeit des KSchG
- 3. Die ordentliche Kündigung
- 3.1. Nach dem BGB
- 3.2. Nach dem KSchG
- 3.2.1. Personenbedingte Kündigung
- 3.2.2. Verhaltensbedingte Kündigung
- 3.2.3. Betriebsbedingte Kündigung
- 4. Die Änderungskündigung
- 5. Die außerordentliche Kündigung im Verhältnis zur ordentlichen Kündigung
- 6. Die gerichtliche Geltendmachung des allgemeinen Kündigungsschutzes
- 7. Besonderer Kündigungsschutz
- 7.1. Mutterschutz
- 7.2. Schwerbehindertenschutz
- 7.3. Betriebsverfassungsrechtliche Funktionsträger
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat beleuchtet das Kündigungsschutzrecht und untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen.
- Anwendbarkeit des Allgemeinen Kündigungsschutzgesetzes (KSchG)
- Ordentliche Kündigung nach dem BGB und dem KSchG
- Kündigungsgründe und deren Rechtmäßigkeit
- Besonderer Kündigungsschutz für bestimmte Personengruppen
- Gerichtliche Geltendmachung des Kündigungsschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in das Allgemeine Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ein und beleuchtet die unterschiedlichen Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen.
- Kapitel 2 erläutert die Anwendbarkeit des KSchG, die von der Betriebsgröße und der Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers abhängt.
- Kapitel 3 befasst sich mit der ordentlichen Kündigung, die nach dem BGB grundsätzlich fristgebunden ist. Es werden die Voraussetzungen einer ordentlichen Kündigung nach dem BGB und dem KSchG dargestellt.
- Kapitel 4 behandelt die Änderungskündigung, die eine Möglichkeit für den Arbeitgeber darstellt, das Arbeitsverhältnis zu modifizieren.
- Kapitel 5 setzt die außerordentliche Kündigung im Verhältnis zur ordentlichen Kündigung in Bezug.
- Kapitel 6 beleuchtet die gerichtliche Geltendmachung des allgemeinen Kündigungsschutzes.
- Kapitel 7 widmet sich dem besonderen Kündigungsschutz für bestimmte Personengruppen wie Schwangere, Schwerbehinderte und Betriebsratsmitglieder.
Schlüsselwörter
Kündigungsschutzrecht, Kündigungsschutzgesetz (KSchG), ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung, Änderungskündigung, Betriebsgröße, Beschäftigungsdauer, Kündigungsgründe, Rechtmäßigkeit, besonderer Kündigungsschutz, Mutterschutz, Schwerbehindertenrecht, Betriebsverfassungsrecht, gerichtliche Geltendmachung.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) anwendbar?
Das KSchG gilt für Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate im Unternehmen beschäftigt sind, sofern der Betrieb eine bestimmte Mindestgröße (in der Regel mehr als 10 Mitarbeiter) überschreitet.
Welche Arten der ordentlichen Kündigung gibt es nach dem KSchG?
Es wird zwischen personenbedingter, verhaltensbedingter und betriebsbedingter Kündigung unterschieden.
Was ist eine außerordentliche Kündigung?
Eine außerordentliche Kündigung erfolgt aus einem „wichtigen Grund“ gemäß § 626 BGB und beendet das Arbeitsverhältnis in der Regel fristlos.
Wer genießt besonderen Kündigungsschutz?
Besonderen Schutz genießen unter anderem Schwangere (Mutterschutz), Schwerbehinderte und Mitglieder des Betriebsrats.
Was versteht man unter einer Änderungskündigung?
Bei einer Änderungskündigung kündigt der Arbeitgeber das bestehende Arbeitsverhältnis und bietet gleichzeitig die Fortsetzung zu geänderten Bedingungen an.
- Quote paper
- Yvonne Kasten (Author), 2001, Kündigungsschutzrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10510