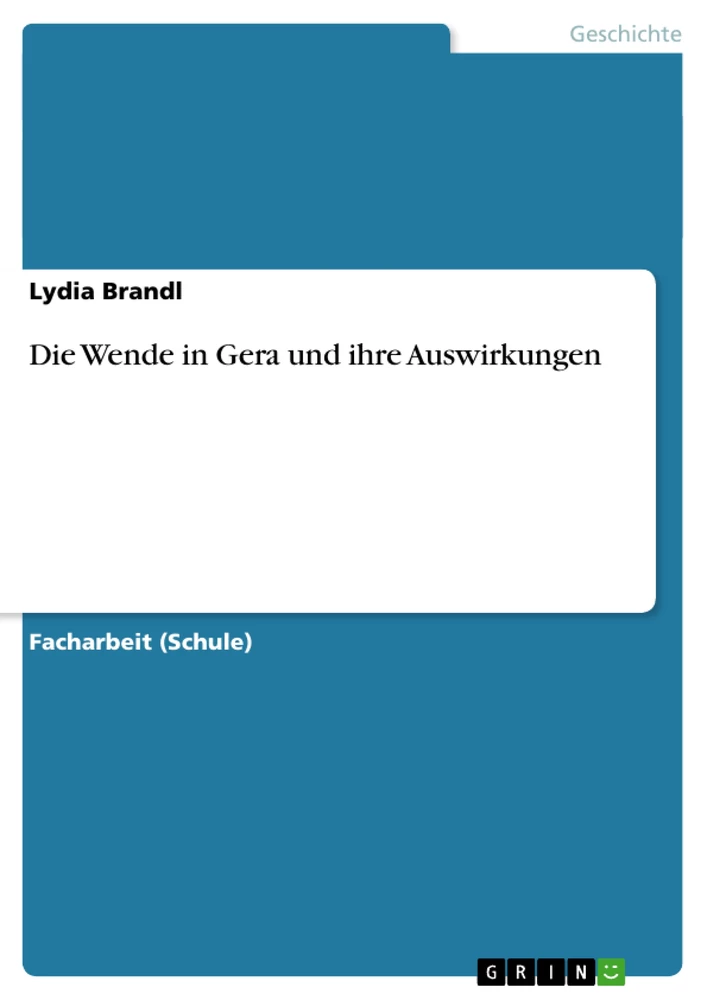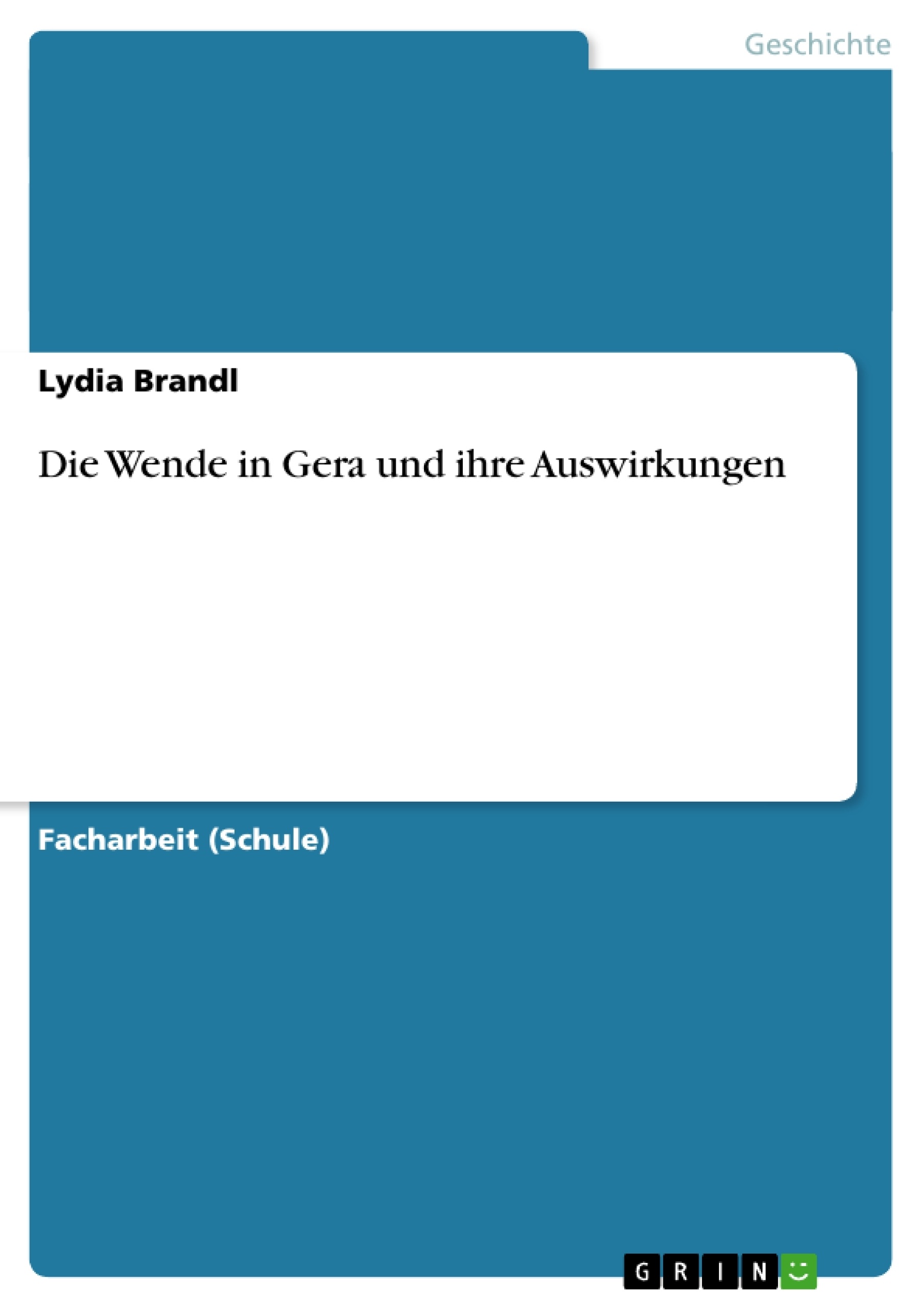INHALTSVERZEICHNIS
1. PREFACE
1. VORWORT
2. DER WEG ZUR EINHEIT
2.1 Historischer Abriss
2.1.1 Ursachen und Anlässe für den Fall der Mauer
2.1.2 Die weiteren Geschehnisse nach dem 09. November 1989
2.2 Interview mit Herrn Pfarrer Geipel über persönliche Erfahrungen während der Wendezeit
3. DIREKTER VERGLEICH DER SITUATION DAMALS UND HEUTE
4. UMFRAGE ZUR WENDE
4.1 Vorstellung der Fragebögen
4.2 Auswertung der Fragebögen
4.2.1 Ergebnispräsentation
4.2.2 Auswertung
5. RESUMEE
6. ANHANG
6.1 Bildmaterial zur Wende in Gera
6.2 Bildmaterial von Geschehnissen in der gesamten DDR
6.3 Grafische Darstellung zur Auswertung der Umfragen
6.4 Sonstiges
7. QUELLENNACHWEIS
7.1 Literaturverzeichnis
7.2 Bildnachweis
7.3 Ehrenwörtliche Erklärung
1. PREFACE
Within the scope of the "Seminarfacharbeit" we decided to examine the expectancy and the real effects of the "changing" in Gera and environs. While working on that topic it turned out that people were very reserved towards that theme. Because of this we did not find enough material to handle with. As in 2000 the tenth anniversary of the reunification was celebrated and we found out that there is not much to get in our history lessons about this event we made up to keep the main subject "changing". But it still was on our interest to find out how Gera and the whole life had changed during those ten years. We especially went into the happenings in the whole GDR as well as in Gera. To get a better insight into personal experiences we interviewed the pastor Mr. Roland Geipel.
For comparing the situation before the "changing" with the one today we evaluated statistics of 1988 and 2000 and made some comparisons. Unforunately it was only possible to make this comparison relating to social factors because statistics about the economy and the structure of the citywere used for different purposes and are not comparable with the ones of today. This is a result of the former planned economy.
To include the population of Gera we took some surveys which were answered in different ways.
1. VORWORT
Im Rahmen der Seminarfacharbeit entschieden wir uns, die Erwartungshaltungen und Auswirkungen der Wende in Gera und Umgebung vergleichend zu untersuchen. Während der Bearbeitung stellte sich jedoch heraus, dass die Menschen sehr reserviert gegenüber diesem Thema waren, wodurch sich nicht genügend Material zur Bearbeitung fand. Da im Jahr 2000 der zehnjährige Jahrestag der Wiedervereinigung gefeiert wurde und wir feststellten, dass aus dem Geschichtsunterricht nicht viel über dieses historische Ereignis, welches uns ja selbst wenigstens indirekt betraf, zu erfahren ist, beschlossen wir, das große Thema "Wende" beibehalten. Es war aber für uns weiterhin von Interesse herauszufinden, wie sich Gera und das Leben der Menschen im Laufe der zehn Jahre verändert haben. Dabei gingen wir besonders auf die Ereignisse in der gesamten DDR sowie speziell in Gera ein. Um einen besseren Einblick auch in persönliche Erfahrungen zu bekommen, führten wir zusätzlich ein Interview mit Herrn Pfarrer Roland Geipel durch.
Um die Situation vor der Wende mit der heutigen zu vergleichen, werteten wir verschiedene Statistiken von 1988 und 2000 aus und zogen Vergleiche. Es war uns leider nur möglich, diese Vergleiche in Bezug auf soziale und gesellschaftliche Faktoren durchzuführen, da Statistiken zur Wirtschaft und zur Struktur der Stadt früher anders geführt und deshalb mit den heutigen nicht zu vergleichen. Dies lässt sich durch die damals herrschende Planwirtschaft begründen.
Um die Geraer Bevölkerung einzubeziehen, führten wir Umfragen zu diesem Thema durch, die auf unterschiedlichste Art und Weise beantwortet wurden.
2. DER WEG ZUR EINHEIT
2.1 Historischer Abriss
2.1.1 Anlässe und Ursachen, die zum Fall der Mauer führten
Bereits vor den Friedensgebeten und Donnerstags-Demonstrationen, die Ende 1989 begannen, mehrte sich die Unzufriedenheit der Geraer Bevölkerung gegenüber der DDR-Staatsmacht. Schon Anfang der 80er Jahre häuften sich die Probleme in Politik und Wirtschaft: Der Staat war hoch verschuldet, die Produktion ging enorm zurück und mit der Planwirtschaft waren viele unzufrieden. Im Sommer/Herbst 1989 kam es in der Sowjetunion unter Gorbatschow1zu tiefgreifenden Reformen. Da die Partei in der DDR aber nicht reformwillig war und ihr Herrschaftsanspruch stieg, formierten sich erste Widerstände. Nachdem sich in Berlin2 und Leipzig, der Stadt, in der die Veranstaltungen ihren Ursprung hatten, Anfang Oktober viele tausend Menschen zu Demonstrationen zusammen gefunden hatten, zog die Geraer Bevölkerung am 19. Oktober 1989 mit den ersten Friedensgebeten in den drei Kirchen St. Salvador, Trinitatis- und Johanniskirche und am 22. Oktober 1989 mit einem spontanen Protestmarsch, welcher vor allem von den Jugendlichen ausging, nach. Dieser fand später regelmäßig jeden Donnerstag statt. Die jungen Leute brachten neue Losungen von den Montags-Demonstrationen in Leipzig mit, so zum Beispiel "Wir sind das Volk" oder "Wir bleiben hier". Zentrale Forderungen während dieser Veranstaltungen waren die Beseitigung der Alleinherrschaft der SED, mehr Demokratie sowie die Schließung der Staatssicherheit.
Zur gleichen Zeit nahm auch der politische Widerstand Gestalt an: Die Bürgerinitiative "Neues Forum"3 festigte sich und warb mehr und mehr Gleichgesinnte. Am 25. Oktober 1989 wurde die SDP4Gera gegründet, die ebenfalls zu einer bedeutenden Gruppe heranwuchs.
Unter dem anhaltenden Druck stärker werdender Demonstrationen und politischen Bewegungen kam es zu ersten Gesprächen mit dem Oberbürgermeister Horst Jäger und weiteren Stadtratsmitgliedern, in welchen unter anderem Fragen der Bevölkerung zur Umweltproblematik, zum Handel und zur Versorgung diskutiert wurden.
Der Donnerstagsmarsch vom 02. November 1989, der mit zu den größten Geras zählte, endete vor der SED-Bezirksleitung5, wo die Demonstranten zahlreiche Kerzen aufstellten. Gegen diesen friedlichen Protest waren die SEDFunktionäre machtlos.
Auch die Künstler blieben von diesem Treiben nicht unberührt und demonstrierten auf dem Zentralen Platz gegen die Zensur und für die Objektivität der Medien.
Als ersten großen Erfolg konnten die Bürger der DDR den Rücktritt des bis dahin fungierenden Staatsoberhauptes Erich Honecker6 aus allen Ämtern verzeichnen.
Doch die Demonstrationen fanden weiterhin statt. So ergab sich zum Beispiel am 04. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz die erste staatlich genehmigte und größte Protestveranstaltung in der Geschichte der DDR, bei dem mehr als 500.000 Menschen teilgenommen haben sollen. Die Regierung des Landes war nun nicht mehr zu halten und trat am 07. November 1989 geschlossen zurück.
Die Öffnung der Mauer kam nicht nur für die Geraer, sondern auch für den Rest der DDR-Bevölkerung überraschend. Durch ein Missverständnis verkündete Günter Schabowski7 während einer Pressekonferenz am Abend, dass die Grenzen geöffnet seien. Daraufhin machten sich in dieser Nacht auch viele Bürger Geras auf den Weg in die alten Bundesländer.
2.1.2 Die weiteren Geschehnisse nach dem 09. November 1989
Nach diesem Ereignis wurden die Friedensgebete und Demonstrationen weiterhin durchgeführt, jedoch änderten sich bald die Forderungen: Der Wiedervereinigungsgedanke wurde immer stärker, was unter anderem durch die Änderung der Losung "Wir sinddasVolk" in "Wir sindeinVolk" zum Ausdruck gebracht wurde. Als erstes sichtbares Zeichen wurden schwarz-rot- goldene Fahnen geschwenkt.
Während Helmut Kohl Ende November 1989 seinen Zehn-Punkte-Plan zur Wiedervereinigung vorstellte, ging es den Oppositionsgruppen der DDR um eine Erneuerung des Staatssystems mit einer Demokratie und die Eigenständigkeit des Landes.
Der Wille nach einem gewaltlosen Verlauf der Wende wurde auch durch die "Menschenkette für Frieden und Demokratie", welche am 03. Dezember 1989 durch die DDR und auch durch Gera verlief, ausgedrückt.
Ein weiteres großes Problem, welches gelöst werden musste, war die Frage nach der Zukunft der Staatssicherheit8, die inzwischen unter großem Druck der Bürger stand. Infolgedessen wurden am 05. Dezember erstmals Journalisten in das Gebäude der heutigen Herrman-Drechsler-Straße gelassen. Einen Tag darauf fand ein "Tag der offenen Tür" statt, bei welchem Vertreter des "Neues Forum", des "Demokratischen Aufbruch"9und der SDP im Beisein der Medien über die zukünftigen Aufgaben der Stasi diskutierten.
Nach dem Willen der Verantwortlichen sollte die Vernichtung der Akten, welche bereits Anfang Dezember begonnen worden war, fortgeführt werden. Diese Wiederaufnahme wurde durch den Einspruch von Michael Galley (CDU), Thomas Wetzel (SDP) und Roland Geipel (Kirchenvertreter) verhindert. Am 07. Dezember lud OB Jäger zum ersten "Runden Tisch"10. Einer der Schwerpunkte war der Antrag auf Nichtigkeitserklärung des Wahlergebnisses vom 07. Mai 1989, bei der die SED offiziell 99% der Stimmen erhalten hatte. Weiterhin fand eine Berichterstattung über die Entwaffnung der Kampfgruppen und die Auflösung der Staatssicherheit statt.
Der Beschluss, ein Bürgerkomitee11zu gründen, wurde am 20. Dezember verwirklicht. Im Vordergrund stand die Stasiauflösung, mit welcher nach Anordnung des Regierungsbeauftragten N. Kobus mit der Entwaffnung am 06. Januar 1990 begonnen wurde. An diesem Tag besetzte das Bürgerkomitee außerdem die Stasizentrale in Gera. Der weitere Abtransport der Waffen und Munition sowie die Sicherung der Akten wurde von dieser Kommission beaufsichtigt. Dadurch war das Problem einer gewaltsamen Eskalation und damit eine große Gefahr gebannt.
Als Zeichen politischer Unabhängigkeit spaltete sich die "Volkswacht" am 18. Januar 1990 von der SED/PDS ab und nannte sich von nun an "Ostthüringer Nachrichten".
Während dieser Zeit des großen Umbruchs fanden zahlreiche Warnstreiks und Kundgebungen verschiedenster Gruppierungen und Berufsklassen statt. So demonstrierten zum Beispiel Ärzte und Angestellte der Sparkasse für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen.
Im Februar stand die Geraer Bevölkerung aber erstmals einem ganz neuen Problem gegenüber: Die Arbeitslosenzahl war gestiegen, demgegenüber stand ein Rückgang an freien Stellen. Bedingt durch diese Veränderungen kam es zu neuen Spannungen und zu Forderungen nach Umstrukturierung im Amt für Arbeit. Im August 1990 betrug die Arbeitslosenquote 4,2 %, was sicher auch ein Grund für die steigende Abwanderung in den Westen war.
Im Rahmen einer Großkundgebung besuchte der SPD-Politiker Willy Brandt12am 04. März 1990 Gera. Eine Woche später hielt Theo Waigel (CDU) im Rahmen der am 18. März 1990 stattfindenden Wahl zur Volkskammer eine Rede, in welcher er eine rasche Währungsreform fordert. Unter dem Leitspruch "Kohl rück' die Kohle raus" protestierten die Menschen Anfang April gegen den von der BRD-Regierung proklamierten Umtauschkurs.
Am 06. Mai 1990 fanden die ersten freien Kommunalwahlen Geras statt. Dabei erhielt die CDU die meisten Mandate. Nach dieser Wahl wurde im Kultur- und Informationszentrum die erste Sitzung einberufen, aus welcher Michael Galley (CDU) als neuer Oberbürgermeister hervor ging.
Neben zwei großen Banken ließen sich innerhalb kurzer Zeit weitere Firmen und Betriebe aus der BRD in Gera und Umgebung nieder. Aber die erhofften Massen in den Geschäften blieben trotz Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion13vom 01. Juli 1990 weg, da dadurch die Preise für den täglichen Bedarf erheblich anstiegen.
Hemmnisse für Investoren, sich in den neuen Bundesländern anzusiedeln, waren ungeklärte Eigentumsverhältnisse sowie bürokratische Hindernisse. Infolgedessen kam es im Sommer 1990 zu einem konjunkturellem Abschwung im Osten, während die Wirtschaft im Westen "aufblühte".
Im "Zwei-Plus-Vier-Vertrag", welcher am 12. September 1990 von den ehemaligen Siegermächten des Zweiten Weltkriegs unterzeichnet wurde, kam es zur Anerkennung eines vereinigten Deutschlands sowie auf den Verzicht aller Sonderrechte, die seit dem Kriegsende 1945 bestanden. Am 03. Oktober 1990 trat der Einigungsvertrag in Kraft, welcher die Einheit Deutschlands besiegelte. Damit wurde das Rechtssystem bis auf wenige Ausnahmen von der Bundesrepublik übernommen.
Diesen Tag feierten die Geraer mit einem Festgottesdienst in der Johanniskirche, bei welchem ein Baum als Symbol der Einheit gepflanzt und ein Gedenkstein gesetzt wurde. Damit war das Wendegeschehen mit einem geschichtsträchtigen Tag abgeschlossen.
2.2 Interview mit Herrn Pfarrer Geipel über persönliche Erfahrungen während der Wendezeit
Um einen besseren Einblick in die persönlichen Erfahrungen der Menschen zu bekommen, entschieden wir uns, ein Interview mit einem der Hauptmitwirkenden im Geraer Wendegeschehen, Herrn Pfarrer Roland Geipel, durchzuführen.
Roland Geipel wuchs in der Werdauer Umgebung auf und entschied sich nach seiner Lehre zum Kfz-Schlosser 1957, in die Bundesrepublik Deutschland zu gehen, da ihn seine Arbeit nicht ausfüllte und er Veränderung suchte. Er holte sein Abitur nach und beschloss, Theologie zu studieren, was für ihn eine Vorraussetzung darstellte, sich später in das politische Leben einzumischen. Das es in einem so starken Maße auf ihn zu kommen würde, konnte er damals noch nicht ahnen. Während eines Besuches bei seiner Familie lernte er seine jetzige Frau kennen, wegen welcher er 1969 in die DDR zurückkehrte. Schon früh kamen Leute auf ihn zu, die die DDR verlassen und ihn aufgrund seiner Vergangenheit kennen lernen wollten.
Von 1969 bis 1974 studierte Roland Geipel Theologie an der Universität Jena. 1978 trat er sein Amt als Pfarrer in Gera-Lusan an, wo er bis heute tätig ist. Bei seiner Übersiedlung kam er mit der Staatssicherheit in Berührung, die ihn gezielt und gut ausgefragt hatte. Diese Erfahrung machte ihn gegenüber der DDR hellhöriger und vor allem kritischer. Als 1980/ 81 das sichtbare Zeichen "Schwerter zu Pflugscharen"14aufkam, bedeutete das für ihn und andere Bürger "Frieden schaffen ohne Waffen", wohingegen Polizei und Staatssicherheit zum Teil mit Verhaftungen reagierten. Solche und ähnliche Dinge brachten ihm eine breite Palette von Erfahrungen ein.
Es machte sich in Gesprächen mit Kollegen bemerkbar, dass es unterschiedliche Sichtweisen darüber gab, wie sehr die denkerische Freiheit durch den Staat eingeschränkt werden durfte. Dies veranlasste ihn, die Jugendarbeit engagierter zu betreiben. Bei den Treffen der jungen Leute sprachen sie auch über ihre politischen Ansichten, was von den Eltern nicht unbedingt immer gern gesehen war. In diesem Zusammenhang wurden auch Umwelt- und Friedensgruppen gegründet. Der Pfarrer selbst zählt sich zu denjenigen, die sich immer an der Grenze bewegt haben, aber nicht versucht haben, sie zu überschreiten, da er sich und die Jugendlichen und Gemeindeglieder nicht gefährden und den anderen weiter helfen wollte.
In den Jahren 1988/ 89 spürte er eine Unruhe und begann dadurch Dinge zu wagen, die ihm und anderen Beteiligten Mut gemacht haben, wie die Öffnung der Johanniskirche im Oktober 1989, als Tausende von Leuten in das Gebäude strömten, ihn grüßten und umarmten. Für ihn war die Atmosphäre unbeschreiblich. Er meinte, die Leute trauten der Kirche und ihren Mitgliedern zu diesem Zeitpunkt etwas zu und steckten Hoffnung in sie hinein. Dies veranlasste, dass sie ihre Kirchen weiter für die Menschen öffneten. Ohne Absprachen geschah dies auch in anderen Städten.
Auf die Frage hin, inwiefern die Jugend am Wendegeschehen mitwirkte, antwortete Herr Geipel, dass sie für Neues offen war. Sie hatte besonderen Anteil an den Demonstrationen, die im Januar und Februar 1990 stattfanden. Auch bei der Auflösung der Staatssicherheit spielte der Pfarrer eine bedeutende Rolle. Nach der Gründung des Bürgerkomitees15war er schnell integriert und mit diesem verschaffte man sich schnell Einblick in das Gebäude der Staatssicherheit in der Drechslerstraße, wo sich etwa vier Kilometer Aktenmaterial befand. Dieser Anblick der oft handgeschriebenen Material erschütterte ihn sehr. Daraufhin wurde vereinbart, dass bei einem Pressetermin im Geraer Rathaus die Entscheidung getroffen werden sollte, ob diese Akten vernichtet werden oder nicht. Je mehr er sich mit diesem Problem beschäftigte kam für ihn die Frage auf, was überhaupt die Institution Staatssicherheit sei. Für ihn war wichtig, dass alles gesichtet, gesichert und in einem demokratischen System ans Licht kommen sollte. Dadurch wurde die Aktenvernichtung verhindert.
Nach dem 09. November wurde der Druck auf die Verantwortlichen enorm groß. Als Anfang Dezember eine große Demonstration zur "Volkswacht" stattfand, wurde auch der Pfarrer erstmals mit neuen Forderungen wie Deutschland-Rufen konfrontiert. Er vertrat die Ansicht, dass die Demos erst aufhören dürften, wenn demokratische Wahlen stattfänden, ansonsten sei das Ziel nicht erreicht.
Schließlich kommt Herr Pfarrer Roland Geipel zu dem Schluss, dass er heute alles wieder genauso machen würde, da er mehr die positiven Seiten vor Augen hat. Für ihn ist es ein Höhepunkt seines Lebens, ein Stückchen Geschichte mitverändert zu haben.
3. DIREKTER VERGLEICH DER SITUATION DAMALS UND HEUTE
Auf den ersten Blick wird ersichtlich, dass die Bevölkerungszahl der Stadt Gera von 1988 (134.834) bis zum Jahr 2000 (116.462) deutlich zurückgegangen ist, obwohl sich die Grundfläche mit jetzt rund 150 km² fast verdoppelt hat.16 Ein Grund hierfür ist unter anderem die rapide Abnahme der Geburten im Laufe eines Jahres, die sich um 1.200 verringert haben und heute nur noch 578 betragen. Aufgrund dieser Tatsache ist festzustellen, dass auch immer weniger Kindertagesstätten in Gera existieren.17 Waren es 1988 noch 60, so sind heute nur noch 51 zu zählen.
Weiterhin wirkte sich dieser Geburtenrückgang auch auf die Schülerzahl aus, welcher sich um etwa ¼ verringert hat. Die Schulen18 blieben jedoch weitestgehend bestehen. Jedoch ist festzustellen, dass sich die Anzahl der Gymnasiasten fast verneunfacht hat, was natürlich zur Entstehung neuer Schulen dieses Typus führte. Zudem sank die Zahl derer erheblich, die die Schule nach der zehnten Klasse abschließen. Ein Grund dafür liegt in der freieren Wahl der Schulart, welche durch die hinzugekommene Gesamtschule erweitert wurde.
Berufsschulen sind in Gera jedoch seit der Wende nicht mehr so stark vertreten: Ihre Anzahl sank von 13 auf fünf herab. Im Gegenzug dazu wurde Gera Standort einer Berufsakademie, deren Qualifikation der einer Fachhochschule gleichzusetzen ist.
Im Gesundheitswesen sind keine größeren Veränderungen zu registrieren. Die Zahl der Ärzte sank seit 1988 um 100 und beträgt heute nur noch 190. Zusätzlich ist ein Anstieg von Apotheken um das dreifache zu verzeichnen, was heute eine bessere, flächendeckendere Versorgung im Gesundheitswesen erlaubt.
Auch im familiären Bereich vollzog sich ein Wandel: Während 1988 noch 1321 Ehen neu geschlossen wurden, waren es 12 Jahre später lediglich 398. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung stieg um circa sieben auf 42,2 Jahre an. Diese immer älter werdende Gesellschaft Geras lässt sich auch durch den Vergleich der Bevölkerungsaufteilung auf das Alter deutlich erkennen. Die Zahl der Null- bis Sechsjährigen sank von 13.021 auf 4.412 herab, was einen Rückgang von knapp 66 % ergibt. Im Gegensatz dazu stieg die Gruppe derer, die zwischen 41 und 65 Jahren alt sind, von 32.189 auf 41.279, also um 28 %.
4. UMFRAGE ZUR WENDE
4.1 Vorstellung der Fragebögen
Zum Thema “Die Wende in Gera” bot es sich an, eine Umfrage durchzuführen, da es die Stadt Gera selbst betraf und ihre Einwohner verschiedenste Erfahrungen gesammelt hatten. Diese Befragungen verliefen anonym und die angesprochenen Personen entschieden selbst, inwiefern sie die Fragen vollständig beantworten wollten. Bei diesen Untersuchungen wurden das Geschlecht, das Alter zum Zeitpunkt der Wende sowie der Wohnsitz registriert. Dabei war es uns wichtig, Personen jeder Altersgruppe aufzunehmen.
Um einen Vergleich zur beruflichen Situation zu ziehen, wurden die Professionen von damals und heute erfasst. Anschließend interessierte uns, ab welchem Zeitpunkt die befragten Personen feststellten, dass es zu Problemen in der DDR kam. Die weiteren Punkte behandelten das direkte Wendegeschehen, die Beteiligung des Einzelnen an der Wende, wie man von der Öffnung der Mauer erfuhr und wie die erste Reaktion darauf war. Zum Schluss ließen wir die Menschen ein persönliches Resümee ziehen, ob das Leben nach der Wende besser ist.
Bei diesen Umfragen stellten wir fest, dass die Menschen teilweise sehr zurückhaltend und distanziert antworteten. Somit gab es fast nur kurze Antworten, die sich auf die Fragen beschränkten. Viele waren nicht bereit, auf das Interview einzugehen, andere lehnten erst ab, als sie vom Thema hörten. Besonders die älteren Menschen waren redefreudiger und zugänglicher.
4.2 Auswertung der Fragebögen
4.2.1 Ergebnispräsentation
Insgesamt wurden 23 Befragungen im gesamten Raum der Geraer Innenstadt durchgeführt. Dabei wurden sieben männliche und 16 weibliche Bürger interviewt, wobei 19 Personen zum Zeitpunkt der Wende in der Stadt und vier auf dem Land lebten. Das Alter der Menschen vor der Wiedervereinigung wurde in fünf Altersabschnitte gegliedert. Dabei kam heraus, dass 30,4 % zwischen 20 und 34 Jahre alt waren. Ein weiterer großer Teil (21,7 %) der Befragten gab an, damals zwischen 35 und 44 gewesen zu sein. Etwa ein Drittel war im Alter von
45 bis 60 Jahre. Die übrigen 13 verbleibenden Prozent entfielen den Altersgruppen jünger als 20 beziehungsweise älter als 60 Jahre. Von den 23 Personen waren fünf in derselben Branche tätig wie vor elf Jahren. Im Gegensatz dazu arbeiteten zehn Interviewte nicht mehr in ihrem alten Tätigkeitsbereich, wobei jedoch zu beachten ist, dass vier zum Zeitpunkt der Umfrage zu den Arbeitslosen zählten. Zusätzlich zu diesen 15 Berufstätigen ist noch die Gruppe von Rentnern zu beachten, welche acht Personen umfasst. Davon befanden sich 1989 bereits zwei Frauen im Ruhestand. Auf die Frage hin, ab wann man die Probleme in der DDR bemerkte, antworteten vier Leute, dass es aus ihrer Sicht keine Schwierigkeiten gab. Sehr frühzeitig erkannten vier die Missstände, wogegen zwei die siebziger und sieben die achtziger Jahre als Zeitpunkt angaben. Sechs der Befragten konnten keine genaueren Angaben darüber machen.
Zwei große Kritikpunkte, die deklariert wurden, waren die massiven Versorgungsprobleme sowie die fehlende Reisefreiheit. Weitere genannte Punkte waren die schlechte politische und ökonomische Situation und die eingeschränkte Meinungsfreiheit. Weitere Kritik übten Einzelne an der Armee, der Stellung des Volkes in der DDR, zu geringe Löhne und Renten sowie der mangelnden Handlungsfreiheit.
Die Beteiligung am Wendegeschehen wurde klar mit “Ja” und “Nein” definiert. Von den neun Personen, die die Frage bejahten, gaben einige an, unter anderem an Demonstrationen in Gera, Leipzig und Greiz beteiligt gewesen zu sein.
82,6 % erfuhr von der Öffnung der Mauer am 09. November 1989 durch das Fernsehen. Nur jeweils zwei Personen gaben an, von diesem Ereignis über Rundfunk beziehungsweise bei einer Demonstrationen erfahren zu haben.
Bei der Frage nach der ersten Reaktion nach dem Fall der Mauer gab es verschiedene Erinnerungen: Die Anzahl der positiv Erfreuten umfasste zwölf, sieben waren überrascht und konnten es erst gar nicht glauben. Im Kontrast dazu stehen die vier Personen, welche nicht erfreut waren oder ein ungutes Gefühl hatten. Im Zusammenhang mit dieser Frage berichteten 47,8 %, dass sie nicht sofort in die alten Bundesländer gereist sein. Lediglich eine Frau gab an, unmittelbar nach diesem Ereignis gefahren zu sein.
Die abschließende Frage bezog sich auf die heutige Zeit und brachte die unterschiedlichen Meinungen der Geraer Bevölkerung zum Vorschein. In Bezug auf die Berufs- und Karrierechancen antworteten 21,1 %, dass diese im Vergleich zu früher besser wären, 40,9 % aber sahen das nicht so. 13,6 % fanden, dass sich die Aussichten nicht wesentlich verändert haben. Ein weiterer Punkt, bei welchem die Meinungen stark auseinander gingen, ist der Bereich der Finanzen. Hier erwiderten 15 Personen, dass die Finanzen sich zum positiven entwickelt haben. Die verbleibenden 36,4 % entgegneten zu gleichem Teil, dass sich die finanzielle Situation nicht verbessert hat beziehungsweise gleich geblieben ist.
4.2.2 Auswertung
Festzustellen ist, dass zwei der vier Personen, welche nicht über die Wende erfreut waren, heute arbeitslos sind. Auch auf die Frage, ob sie das Leben nach der Wende besser fänden, zogen sie in allen der angesprochenen Punkte ein negatives Resümee. So ist die Vermutung naheliegend, dass die jetzige Situation der beiden Frauen auch Einfluss auf ihre heutige Sicht zur Wende hat. Hingegen äußerten die anderen beiden befragten Arbeitslosen, ebenfalls Frauen, nicht so eine negative Einstellung zur heutigen Lage, sondern meinten, man “will nicht klagen”.
Im Hinblick auf die Literatur, die das Wendegeschehen in Gera beschreibt, sind Widersprüche in Bezug auf die Aussage, dass “Viele Menschen […] noch in der Nacht vom 09. 11. zum 10. 11. 1989 über die Grenze [fuhren].”19, zu finden. Dadurch, dass 11 Personen dies nicht bestätigten, entstand die Unstimmigkeit, welche nicht nachvollziehbar ist.
Aus den Umfragen lässt sich erkennen, dass die Menschen eine Verbesserung in der Freizeitgestaltung sehen und durch die positiven Antworten, kann man sagen, dass sie zufriedener mit den Finanzen sind. Lediglich im Berufsleben meinten die Befragten, dass sich dieser Zustand verschlechtert hat, was zum Beispiel an der hohen Arbeitslosigkeit und der schlechten wirtschaftlichen Situation liegt.
5. RESÜMEE
Während der Arbeit am Thema wurden wir mit einigen Problemen konfrontiert. Nicht nur das die Menschen sehr zurückhaltend auf unsere Befragungen reagierten, auch mit öffentlichen Einrichtungen und Ämtern machten wir teilweise negative Erfahrungen. Die Recherchen gestalteten sich deshalb manchmal sehr zeitaufwendig und schwierig, da wir gezwungen waren, ein und dieselbe Institution mehrmals aufzusuchen. Andererseits zeigten sich viele auf unsere Anfragen sehr hilfsbereit und gaben gerne Auskunft.
Wir stellten fest, dass sich die Angaben der Sekundärliteratur mit den Informationen deckten, die wir vom Zeitzeugen Roland Geipel erhielten. Um Zusammenhänge besser zu verstehen, gingen wir neben regionalen Geschehnissen auch auf nationale ein, wobei wir zu dem Ergebnis kamen, dass Gera nur eine "Mitläuferstadt" in der Wende war.
Beim Betrachten der Auswirkungen fanden wir heraus, dass es sowohl positive als auch negative Veränderungen in den Leben der Menschen der ehemaligen DDR gab. Der soziale Bereich verschlechterte sich zum Beispiel drastig, während die Lebensqualität durch die freie Marktwirtschaft und offenere Politik anstieg.
Auch die Meinung der Bevölkerung stimmt mit diesen Aussagen überein. Sind einige scheinbar rundum zufrieden, gab es andere, die das Leben nach der Wende schlechter finden.
Durch das Arbeiten an diesem Thema sammelten wir viele Erfahrungen in Bezug auf das Leben der Menschen Geras und deren Geschichten.
Heute, am 03. Oktober 2001, 11 Jahre nach der Wiedervereinigung, wollen wir unsere Seminarfacharbeit mit einem Zitat von Dr. Bernhard Vogel, Thüringens Ministerpräsident, zum 10. Jahrestag beenden:
„An Kerzen und Gebeten ist dieses System zusammengebrochen. [...] Zweifel daran, dass die Einheit gelingt, mag der haben, der die Einheit nicht wollte [...] und der auch heute ihren Erfolg nicht sehen will. [...] Ja, es wächst zusammen, was zusammengehört.“20
6. ANHANG
6.1 Bildmaterial zur Wende in Gera
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Herr Pfarrer Roland Geipel mit seiner Frau Susanne.21
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Friedensgebet am 02. November 1989 in der Geraer Johanniskirche.22
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tausende Menschen versammeln sich zum Gebet am 02. November 1989.23
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Menschenkette am 03. November 1990 durch die DDR und auch durch Gera.24
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.000 Menschen demonstrieren am selben Tag vor den drei großen Kirchen.25
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auch am 16. November findet eine Donnerstagsdemonstration statt. Allen voran Horst Jäger, OB von Gera.26
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Menschen stellen nach den Friedensgebeten und Demonstrationen im November 1989 Kerzen vor der SED-Bezirksleitung auf.27
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Am 04. Januar 1990 versuchen Demonstranten, in das Gebäude der Staatssicherheit vorzudringen. Pfarrer Geipel verhindert schlimmeres.28
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Treffen des Bürgerkomitees am 09. Januar 1990.29
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Von den Streiks war auch die Stadt- und Kreissparkasse betroffen (13. Februar 1990).30
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Willy Brandt weilt im Rahmen des Wahlkampfes zur Volkskammerwahl am 18. März 1990 in Gera.31
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Am 03. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, wird in Gera vom amtierenden OB Michael Galley eine Linde gepflanzt.32
6.2 Bildmaterial von Geschehnissen in der gesamten DDR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ca. 120.000 Demonstranten am 16. Oktober 1989 in Leipzig.33
Bei der größten Demonstration in der Geschichte der DDR demonstrieren am 04. November 1989 500.000 aufgebrachte Menschen.34
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Drei Bilder von Montagsdemonstrationen in Leipzig im Winter 1989.35
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Demonstranten in Berlin suchen nach der Besetzung der Stasi-Zentrale nach ihren Akten.36
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aktenberge in Ost-Berlin im März 1990.37
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Mauerabbau in Kreuzberg beginnt.38
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Brandenburger Tor nach dem Mauerfall.39
6.3 Grafische Darstellung zur Auswertung der Umfragen
- Geschlechter der Befragten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Altersverteilung unter den Befragten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Kritikpunkte an der DDR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.4 Sonstiges
- Wahlergebnisse der Kommunalwahlen vom 06. Mai 1990
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. QUELLENNACHWEIS
7.1 Literaturverzeichnis
Stadtmuseum Gera (Hrsg.): ZeitenWende. Gera zwischen 1989 und 1990. Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Außenstelle Gera. Stadtarchiv Gera. Thüringer Landesmedienanstalt - Offener Kanal Gera. Bonifatius Verlag. Gera, 2000.
Gülland, Dieter: Menschschicksale. Gera, 1996.
Müller-Hegemann, Annelies/ Butzmann, Gerhard/ Gottschalg, Dr. sc. Jonny/ Gurst, Dr. Günter: Meyers Jugendlexikon. 6. Auflage. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1976.
Hoffmeister, Hans/ Hempel, Mirko (Hrsg.): Die Wende in Thüringen. Zehn Jahre danach. Ein Rückblick. Eine Gemeinschaftsproduktion der Thüringer Landeszeitung, Friedrich-Ebert-Stiftung Thüringen. Rhino Verlag Arnstadt und Weimar, November 1999.
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Außenstelle Gera: Herrmann-Drechsler-Straße 1 07548 Gera
Stadtverwaltung Gera, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung: Florian-Geyer-Straße 17 07545 Gera
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Bezirksstelle Gera: Bevölkerungsstatistik Teil 1. Struktur der Wohnbevölkerung des Bezirkes Gera nach Alter und Geschlecht, 1988.
Gera-Information (Hrsg.): Gera in Zahlen 1988. Gera, 1989.
Appel, Reinhard (Hrsg.): Einheit die ich meine. 1990-2000. Verlagsgesellschaft mbH. Köln, 2000.
http://www.gera.de
http://www.chronikderwende.de
7.2 Bildnachweis
Stadtmuseum Gera (Hrsg.): ZeitenWende: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Gülland, Dieter: Menschenschicksale (Fotos: Gülland, Heidi): 20
Internet:
24
http://www.chronikderwende.de/servlets/de.blueorange.util.GetImage?db=xRed &tbl=cdw_typ_DerTag&key=key&keyval=Tag3.11.1989&imgcol=bildgross&mim e=bildgross_mime
33
http://www.chronikderwende.de/servlets/de.blueorange.util.GetImage?db=xRed &tbl=cdw_typ_DerTag&key=key&keyval=Tag16.10.1989&imgcol=bildgross&mi me=bildgross_mime
34
http://www.chronikderwende.de/servlets/de.blueorange.util.GetImage?db=xRed &tbl=cdw_typ_DerTag&key=key&keyval=Tag12.1989&imgcol=bildgross&mime =bildgross_mime
35
http://www.chronikderwende.de/servlets/de.blueorange.util.GetImage?db=xRed &tbl=cdw_typ_DerTag&key=key&keyval=Tag3.11.1989&imgcol=bildgross&mim e=bildgross_mime
36
http://www.chronikderwende.de/servlets/de.blueorange.util.GetImage?db=xRed &tbl=cdw_typ_DerTag&key=key&keyval=Tag2.3.1990&imgcol=bildgross&mime =bildgross_mime
37
http://www.chronikderwende.de/servlets/de.blueorange.util.GetImage?db=xRed &tbl=cdw_typ_DerTag&key=key&keyval=Tag15.3.1990&imgcol=bildgross&mim e=bildgross_mime
38
http://www.chronikderwende.de/servlets/de.blueorange.util.GetImage?db=xRed &tbl=cdw_typ_DerTag&key=key&keyval=Tag3.1990&imgcol=bildgross&mime= bildgross_mime
39
Microsoft ® Encarta ® Enzyklopädie Plus 2000
7.3 Ehrenwörtliche Erklärung
Hiermit versichern wir, dass wir unsere Seminarfacharbeit mit dem Thema
„Die Wende in Gera und ihre Auswirkungen“
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben.
Ort: ______________________
Datum: ___________________
Unterschrift: __________________
__________________
[...]
1Gorbatschow, Michail Sergejewitsch (*1931), war ein sowjetischer Politiker . Von 1988 bis 1991 war er Staatspräsident der UdSSR, seit 1985 arbeitete er an umfangreichen Reformen ("Perestroika" - Wende in Verwaltung und Wirtschaft - und "Glasnost" - mehr Transparenz nach innen und außen). Durch seine Außenpolitik kam es zu weltweiten Entspannungen und durch seine Zustimmung zum Zwei-Plus-Vier-Vertrag schließlich zur Wiedervereinigung
2Im Anschluss an die Feier zum 40. Jahrestag der DDR fand die erste Gegendemo mit der Forderung "Demokratie - jetzt oder nie!" mit anschließendem gewaltsamen Polizeieinsatz statt.
3Bürgerbewegung, "die es Menschen aus allen Berufen, Lebenskreisen, Parteien und Gruppen möglicht macht, sich an der Diskussion und Bearbeitung lebenswichtiger Gesellschaftsprobleme in diesem Land zu beteiligen" (Gründungsdokument "Aufbruch 89 - NEUES FORUM"); gegründet am 19. September 1989 in der DDR, sah sich nicht als Partei, sondern als demokratische Initiative
4Sozialdemokratische Partei; Gründung in Berlin am 07. Oktober 1989; Umbenennung im Januar 1990 zur SPD, September 1990 Zusammenschluss mit SPD-West
5Verwaltungsapparat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auf Bezirksebene, in dem das eigentliche Machtzentrum der DDR verankert war.
6Erich Honecker (1912-1994), Staatsoberhaupt der DDR (seit 1976) und demnach Politiker in der SED. Er hob immer die Unabhängigkeit "seines" Landes hervor und besann sich auf die Politik der Sowjetunion. Allerdings lehnte er die angestrebten Reformen Gorbatschows ab, weshalb er 1989 zurücktreten musste.
7Günther Schabowski (*1929), war ein Mitglied des SED-Politbüros und galt als eventueller Nachfolger Honeckers. In der Wendezeit sprach er sich auch selbstkritisch gegenüber seiner Person, wurde auch deshalb 1990 aus der SED ausgeschlossen.
8Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in der DDR, eines der bedeuternsten Machtinstrumente der SED, politische Geheimpolizei mit weitreichendem Spitzelnetzwerk zur Kontrolle von Bevölkerung, Betrieben und Verwaltungen.
9 1989 in der DDR gegründete Bewegung, die sich später zur formatierte und für die Wiedervereinigung eintrat. Im August 1990 schloss sie sich der CDU an.
10entstanden 1989 während der Revolution in der DDR zur Lösung der Probleme im Staat; der "Zentrale Runde Tisch" fand in Ost- Berlin statt und setzte sich aus Vertretern der neuen und alten Parteien zusammen. Daneben gab es Runde Tische auf Kommunal- und Bezirksebene, die sich als "gewaltlose Selbstorganisation" (www.chronikderwende.de) verstanden.
11Zusammenschluss von Bürgern, um geforderte Ziele durchzusetzen. In Gera bestand das Bürgerkomitee aus je zwei Vertretern aller Parteien und politischen Bewegungen mit dem Hauptziel der Auflösung der Staatssicherheit.
12 Willy Brandt (1913-1992), war Politiker in der SPD und der vierte gewählte Bundeskanzler der BRD (1969-1974).
13Übergangslösung auf dem Weg zur Wiedervereinigung: Am 01. Juli 1990 wurde das Wirtschafts-, Währungs- und Sozialsystem der BRD in der DDR anerkannt. Dadurch wurde die D-Mark eingeführt und die Planwirtschaft abgeschafft.
14Dies war eine Friedensbewegung in der DDR, die zum Teil von der christlichen Kirche unterstützt wurde, welche sich gegen die Rüstungspolitik des Warschauer Paktes aussprach.
15Dies setzte sich zusammen aus je zwei Vertreter der alten Partei en(SED, CDU und Bauernpartei) und Vertreter der neuen Gruppierungen
16damals = 1988
17heute = August 2000
18Direkter Vergleich nicht möglich, da das Schulsystem umstrukturiert wurde: Es wurde nach dem "Einheitlichen sozialistischen Bildungssystem" gearbeitet. Kinder im Alter von 6/7 Jahren kamen in die zehntklassige, allgemeinbildende polytechnische Oberschule, die noch in verschiedene Stufen unterteilt war. Anschließend konnten einige eine erweiterte Oberschule mit dem Ziel Abitur besuchen.
19ZeitenWende. Gera zwischen 1989 und 1990, S. 49
20 aus: Appel, Reinhard (Hrsg.): Einheit die ich meine. 1990-2000. Verlagsgesellschaft mbH. Köln, 2000. S.274 ff.
21siehe Bildnachweis
22 ebd.
23ebd.
24ebd.
25 ebd.
26ebd.
27ebd.
28 ebd.
29ebd.
30 ebd.
31ebd.
32 ebd.
33ebd.
34 ebd.
35 ebd.
36ebd.
37 ebd.
38ebd.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Sprach-Preview einer Seminarfacharbeit über die Wende in Gera und ihre Auswirkungen. Es enthält das Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung (Vorwort), Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselwörter, einen historischen Abriss, ein Interview, einen Vergleich der Situation vor und nach der Wende, eine Umfrage und ein Resümee.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis listet folgende Punkte auf: Vorwort, Der Weg zur Einheit (mit historischem Abriss und Interview), Direkter Vergleich der Situation damals und heute, Umfrage zur Wende (Vorstellung und Auswertung der Fragebögen), Resümee, Anhang (Bildmaterial, Grafiken) und Quellennachweis.
Was wird im historischen Abriss behandelt?
Der historische Abriss behandelt die Ursachen und Anlässe für den Fall der Mauer sowie die weiteren Geschehnisse nach dem 9. November 1989.
Wer ist Herr Pfarrer Geipel und worum geht es im Interview?
Herr Pfarrer Roland Geipel ist eine wichtige Person im Geraer Wendegeschehen. Das Interview gibt Einblick in seine persönlichen Erfahrungen während der Wendezeit.
Welche Vergleiche werden zwischen der Situation vor und nach der Wende gezogen?
Es werden Vergleiche in Bezug auf soziale und gesellschaftliche Faktoren angestellt, basierend auf Statistiken von 1988 und 2000.
Was beinhaltet die Umfrage zur Wende?
Die Umfrage umfasst eine Vorstellung der Fragebögen, eine Auswertung der Antworten (Ergebnispräsentation und Interpretation) und die Meinungen der Geraer Bevölkerung zur Wende.
Welche Themen werden im Resümee behandelt?
Das Resümee fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen über die Auswirkungen der Wende in Gera.
Welches Bildmaterial ist im Anhang enthalten?
Der Anhang enthält Bildmaterial zur Wende in Gera und in der gesamten DDR, sowie grafische Darstellungen zur Auswertung der Umfragen.
Welche Quellen werden im Quellennachweis aufgeführt?
Der Quellennachweis listet das verwendete Literaturverzeichnis, den Bildnachweis und eine ehrenwörtliche Erklärung.
Was waren die Hauptkritikpunkte an der DDR, die in den Umfragen genannt wurden?
Zu den Hauptkritikpunkten zählten massive Versorgungsprobleme, fehlende Reisefreiheit, die schlechte politische und ökonomische Situation sowie die eingeschränkte Meinungsfreiheit.
Wie erfuhren die meisten Befragten von der Öffnung der Mauer?
Die Mehrheit der Befragten (82,6 %) erfuhr von der Öffnung der Mauer über das Fernsehen.
Welche Meinungen gab es zur Verbesserung des Lebens nach der Wende?
Die Meinungen zur Verbesserung des Lebens nach der Wende waren geteilt. Es gab positive Stimmen, besonders im Bezug auf Finanzen und Freizeitgestaltung, aber viele sahen im Bezug auf die Berufs- und Karrierechancen, die jetzige Situation negativ.
Welche Probleme traten bei der Erstellung dieser Seminarfacharbeit auf?
Zu den Problemen zählten die Zurückhaltung der Menschen bei den Befragungen sowie Schwierigkeiten mit öffentlichen Einrichtungen und Ämtern.
Welches Zitat schließt die Seminarfacharbeit ab?
Die Arbeit endet mit einem Zitat von Dr. Bernhard Vogel, Thüringens Ministerpräsident, zum 10. Jahrestag der Wiedervereinigung.
- Arbeit zitieren
- Lydia Brandl (Autor:in), 2001, Die Wende in Gera und ihre Auswirkungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105476