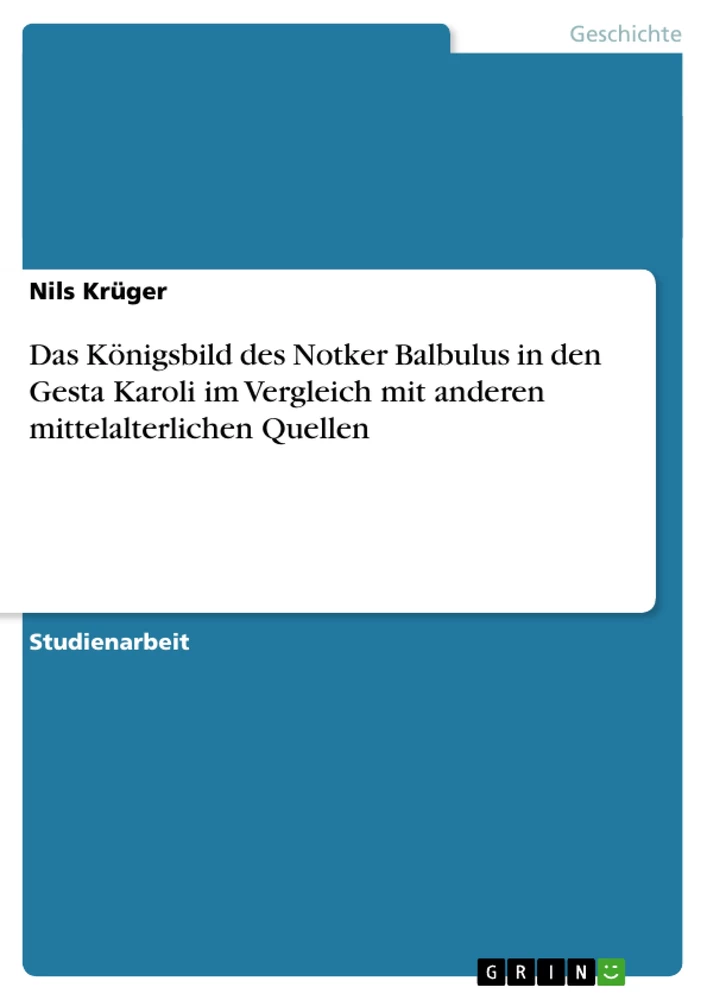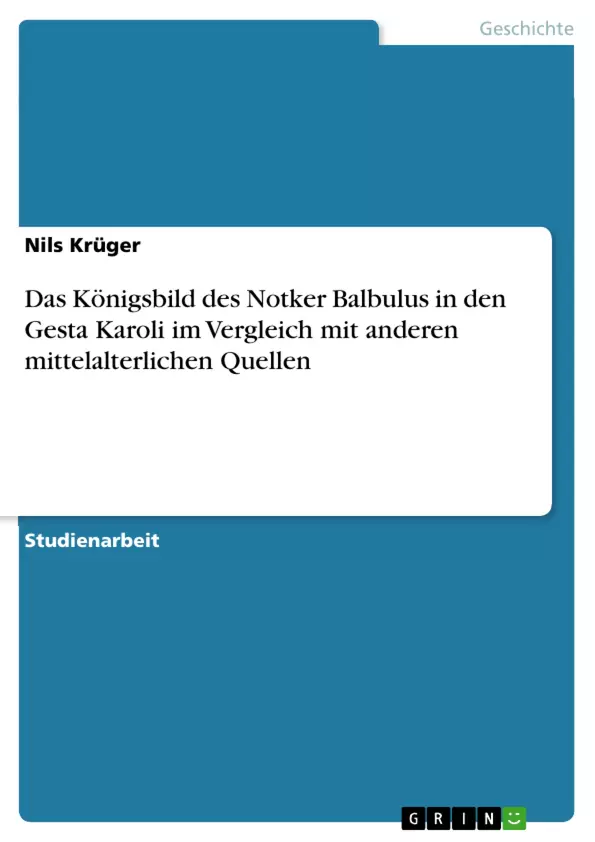Was macht einen König aus? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Karolingerreichs und begeben Sie sich auf eine spannende Spurensuche nach dem idealen Herrscherbild des Mittelalters. Diese tiefgreifende Analyse entschlüsselt die vielschichtigen Vorstellungen von Königtum, die in den Chroniken und Schriften der damaligen Zeit verborgen liegen. Im Zentrum der Betrachtung steht Notker Balbulus' "Gesta Karoli", ein Werk, das ein idealisiertes Porträt von Karl dem Großen und seinen Nachfolgern entwirft. Doch wie realitätsnah war dieses Bild tatsächlich? War der König ein strahlender Held, ein gottesfürchtiger Diener oder doch eher ein machtbewusster Stratege? Durch den Vergleich mit anderen bedeutenden Quellen wie den Annales Fuldenses, der Reginonis Chronica, der Vita Karoli, der Vita Hludowici und den Historiarum Libri IV wird ein facettenreiches Mosaik der mittelalterlichen Königsauffassung enthüllt. Entdecken Sie, wie Autoren wie Einhard, Thegan und Nithard das Bild des idealen Herrschers prägten und welche Rolle dabei Eigenschaften wie Frömmigkeit, Gerechtigkeitssinn, militärische Stärke und Weisheit spielten. Erfahren Sie, ob die Vorstellung vom König als religiöser Leitfigur, Beschützer der Kirche und Garant von Frieden und Ordnung in den unterschiedlichen Quellen einheitlich vertreten wird oder ob sich divergierende Ansichten offenbaren. Diese aufschlussreiche Untersuchung bietet nicht nur einen Einblick in die politische und gesellschaftliche Ordnung des Karolingerreichs, sondern wirft auch ein neues Licht auf die zeitlosen Fragen nach Macht, Führung und der Rolle des Herrschers in der Gesellschaft. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für mittelalterliche Geschichte, politische Philosophie und die Konstruktion von Herrscherbildern interessieren. Lassen Sie sich von den lebendigen Schilderungen und klugen Analysen in eine längst vergangene Epoche entführen und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die Wurzeln unserer heutigen Gesellschaft. Diese Arbeit untersucht das mittelalterliche Königsbild im Karolingerreich anhand verschiedener Quellen, wobei ein Ausschnitt aus Notker Balbulus' "Gesta Karoli" im Mittelpunkt steht. Durch den Vergleich mit den Annales Fuldenses, Reginonis Chronica, Vita Karoli, Vita Hludowici Imperatoris und Historiarum Libri IIII wird analysiert, ob das in der "Gesta Karoli" aufgezeigte Königsbild im Mittelalter allgemeine Gültigkeit besaß oder nur die Vorstellung einer Einzelperson widerspiegelte. Die Analyse zeigt, dass es zwar individuelle Unterschiede in der Darstellung gab, aber auch deutliche Parallelen erkennbar sind, insbesondere der Wunsch nach einem gerechten, menschlichen und tugendhaften Herrscher, der für Sicherheit und Harmonie sorgt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Quelleninterpretation
2.1 Inhaltsangabe
2.2 Das Königsbild des Notker Balbulus
2.3.1 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Annales Fuldenses
2.3.2 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Reginonsis Chronica
2.3.3 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Vita Karoli
2.3.4 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Vita Hludowici
2.3.5 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Historiarum Libri IV
3. Fazit
4. Quellenverzeichnis
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Schon jedes kleine Kind weiß, was ein König ist und tut. In unzähligen Märchen geht es um Königinnen, Könige und Königreiche. Später wird dieses Bild verändert oder noch verstärkt durch die Bildgewalt von (meist amerikanischen) Fernseh- und Kinoproduktionen. Doch wie sah das mittelalterliche Königsbild im Karolinger Reich tatsächlich aus ? Welche Vorstellung hatte die zeitgenössische Bevölkerung von „ihrem“ König? Sahen sie den König eher als mächtigen Kriegsherren, der ruhmreich die Grenzen des Reiches verteidigte und vergrößerte? Oder wünschten sie sich einen menschlichen Herrscher, der ihr Leben durch würdevolle Präsenz bereicherte und das Volk liebte und beschützte ? War der König auch gleichzeitig eine religiöse Leitfigur oder war er vor Gott auch nur eine einfache Seele ?
Um dies zu klären beschäftigt sich diese Hausarbeit mit verschiedenen Quellen der Karolinger Zeit, wobei besonders ein Ausschnitt aus der „Gesta Karoli“1von Notker Balbulus im Mittelpunkt steht. Nach einer ausführlicheren Interpretation dieser soll sich durch den Vergleich mit den anderen ausgewählten Quellen (Annales Fuldenses, Reginonis Chronica, Vita Karoli, Vita Hludowici Imperatoris, Historiarum Libri IIII) zeigen, ob das darin aufgezeigte Königsbild im Mittelalter allgemein Gültigkeit besaß oder nur der Vorstellung einer Einzelperson entspracht.
2. Quelleninterpretation
2.1 Inhaltsangabe
Der vorliegende Ausschnitt aus der „Gesta Karoli“ von Notker Balbulus beginnt mit der Prophezeiung Karls des Großen über seinen Enkel Ludwig, dass „wenn dieser Knabe am Leben bleibt [...] er etwas großes sein [wird]“.2 Gekommen ist es zu dieser Aussage, als Ludwig bei seiner ersten Begegnung mit seinem Großvater, dem Kaiser, erkennt, dass er nicht mehr der Vasall seines Vaters ist, sondern ein Gefährte und Genosse dessen und dementsprechend auch nicht mehr hinter ihn zurücktreten muss.
Notker fährt nach einem Vergleich Ludwigs mit dem heiligen Ambrosius fort mit der Beschreibung des Einsatzes Ludwigs für das Kloster St. Gallus. Da dieses im Gegensatz zu anderen Klöstern keinen Beschützer hatte, erklärte sich Ludwig zu dessen Vogt und vertrat damit offiziell dessen Interessen.
Im letzten Abschnitt beschreibt Notker Ludwigs späteres Aussehen, seine charismatische Ausstrahlung, seinen festen Glauben und den ausgeprägten Gerechtigkeitssinn Ludwigs.
2.2 Das Königsbild des Notker Balbulus
In dem bearbeiteten Ausschnitt aus den „Gesta Karoli“ erwähnt Notker drei Könige: Karl den Großen, dessen Sohn Ludwig den Frommen und wiederum dessen Sohn Ludwig den Deutschen. Obwohl die „Gesta Karoli“ eigentlich eine Aufzählung von Geschichten aus dem Leben Karls des Großen ist3, nimmt dieser nur einen relativ kleinen Teil innerhalb des Ausschnitts ein. Der deutlich größte Teil entfällt auf Ludwig II.. Dessen Vater Ludwig I. findet nur als Randfigur im ersten Abschnitt Erwähnung.
Entsprechend der Anteile lässt sich auch nur wenig über Karl I. und Ludwig I. aussagen. Von Karl dem Großen zeichnet Notker das Bild des „weisen, erhabenen und umsichtigen“4Königs, was aber auch im Zusammenhang mit dem Alter Karls von immerhin 65 Jahren beim beschriebenen Anlass zu sehen sein dürfte. Ludwig I. beschreibt Notker lediglich als „gütig“5.
Anders sieht es bei den Informationen über Ludwig den Deutschen aus. Notker zeigt hier ein sehr ausführliches Bild seiner Vorstellung von einem König auf. Da Notker wahrscheinlich den von ihm beschriebenen Königen nie begegnet ist und sich lediglich auf Erzählungen anderer stützen kann6, dürfen seine Beschreibungen auch nur als idealisierte Vorstellungen verstanden werden. Vor allem auch, da er seine Geschichten vorrangig zur Unterhaltung und nicht zur möglichst korrekten historischen Belehrung niederschrieb7.
Notker beginnt mit der Beschreibung Ludwigs II., als dieser sechs Jahre alt ist. Der Mönch beschreibt das Kind als sorgfältig erzogen und schon in dem Alter als „weiser [...] als sechzigjährige Männer“8. Gleichzeitig berichtet er, dass der kleine Prinz ernsthaft und ehrfurchtsvoll, dabei voller Würde sich seines Platzes schon in dem Alter bewusst seiend war9. Was man heute wohl eher als „eingebildeten, besserwisserischen Fratz“ bezeichnen würde, war für Notker ein Zeichen für einen geborenen König.
In der Quelle geht es weiter mit der Beschreibung Ludwigs als Erwachsener, wobei der Mönch Notker es sich nicht nehmen lässt, den König mit dem heiligen Ambrosius zu vergleichen, einem Bekämpfer des Heidentums und Verfechter der Souveränität der christlichen Kirche10. Typisch für Notker mit seinem übertreibenden Schreibstil11überhöht dieser Ludwig noch über den Heiligen: „ ..., war er [Ludwig] in allem dem heiligen Ambrosius völlig gleich, ja in gewisser Weise noch größer, sowohl an Macht des Königtums als auch an Glaubenseifer, ...“12. Der Mönch betont, dass Ludwig „im Glauben gut katholisch“13und „in der Verehrung Gottes hervorragend“14war. Interessanterweise nennt Notker den König einen „Genosse[n] der Knechte Christi“15, was ihn auch schon nach mittelalterlichem Verständnis zum Teilhaber an Sachen und Rechten der Kirche machte16und damit die intensive Verknüpfung von weltlicher und kirchlicher Macht im Amt des Königs bzw. Kaisers verdeutlicht. Dass diese Rechte natürlich auch mit Aufgaben verbunden waren, zeigt das Lob Notkers, dass Ludwig ein „unermüdlicher Beschützer und Verteidiger“17der Kirche und ihrer Vertreter war und mehrere prächtige „Bethäuser“18bauen ließ.
Dass Ludwig gegen alle Heiden „noch furchtbarer als seine Vorfahren“19vorging, passt nicht so ganz in die Beschreibung vom gütigen, unsagbar gnädigen, großen und hochherzigen Herrscher20und muss wohl wieder eher Notkers Hang zum Erheben in die Potenz zugeschrieben werden. Es verdeutlicht allerdings den Wunsch nach einem König, der nicht nur die Diplomatie beherrscht, sondern im Bedarfsfall auch hart durchzugreifen weiß, ein Wunsch der ja auch im 21. Jahrhundert noch vielerorts präsent ist.
Ein weiterer Hinweis für Notkers Vorstellung von einem gottesgläubigen Herrscher ist die Beschreibung Ludwigs als eifrigen Christen, der betete und fastete und stets „den Herrn im Gebet vor sich zu haben schien“21, sich mit anderen Worten also bei seinen Entscheidungen von Gott leiten lies.
Auch bei der Beschreibung des Aussehens und der Wesenszüge Ludwig des Deutschen hält sich Notker nicht mit Schwärmereien zurück. So schreibt er: „von stattlichem Wuchs und schöner Gestalt, mit Augen, die wie Sterne strahlten, mit einer hellen und durchaus männlichen Stimme, einzigartig an Weisheit“22, welche er durch Lesen beständig weiter ausbaute. Ludwig war laut Notker „immer erfüllt von Heiterkeit und Fröhlichkeit, dass jeder, der betrübt zu ihm kam, allein vom Sehen und von einer noch so geringen Ansprache erfreut abzog“23.
Bereinigt man diesen Satz von seiner Tendenz, so bleibt das Bild eines Königs übrig, der scheinbar stets ein Ohr und einen Moment Zeit für die Sorgen seines Volkes hatte. In einem späteren Satz24verdeutlicht der Autor dies noch, als er davon berichtet, dass der König sich sogar um die Missgeschicke und Streitereien seiner Untertanen persönlich kümmerte. Dass diese Streitigkeiten allein durch Ludwigs Blick geklärt wurden25und damit einer der Sprüche Salomos sich erfüllte, ist für Notker ein weiterer Beweis dafür, dass Ludwig ein von Gott erwählter Herrscher und Richter war.
Zusammenfassend zeichnet Notker also das Bild eines geborenen Herrschers, dem seine Königswürde schon in frühen Jahren anzusehen ist. Ein König, der zugleich mächtiger Bestrafer der Ungläubigen und einfacher Glaubensgenosse im Auftrag des Herrn ist. Ein edler Bauherr wunderbarer Kirchen und ein großzügiger Förderer der Wissenschaft, doch zugleich auch ein eifriger Diener Gottes, der jedem anderen Christen ein Vorbild an Tugend und Glauben ist. Ein weltlicher Herrscher und Richter, stets geleitet von Gott. Doch trotz seiner unsagbaren Macht und Größe immer noch ein König mit Blick fürs Kleine, der für die Sorgen und Probleme seiner Untertanen zu sprechen ist und Streitigkeiten allein durch seine Blicke zu schlichten weiß.
2.3.1 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Annales Fuldenses
Im Vergleich mit dem behandelten Ausschnitt der Gesta Karoli steht bei den Annales Fuldenses26der kriegerische Aspekt sehr viel stärker im Mittelpunkt27. Die zeitliche Nähe der Autoren28zum vorliegenden Ausschnitt hat zwar den Vorteil, dass eine mögliche Sagenbildung noch ausgeschlossen werden kann. Da eine „persönliche Fühlungsnahme mit dem königlichem Hof“29jedoch trotzdem nicht gegeben ist, fallen die Informationen über ein Königsbild gering aus.
Während Kaiser Karl der Dicke in seinem letzten Lebensjahr nur noch als krank30, schwach31, verachtet32und entwürdigt33dargestellt wird, ist sein Nachfolger König Arnulf ein würdevoller34, mächtiger35 Herrscher. Zwar friedliebend36 und freundlich37, doch bereit um sein Land zu kämpfen38.
Die Autoren zeichnen also im Gegensatz zum übermenschlichen Königsbild Notkers ein sehr viel realistischeres, natürlicheres Bild. Die erwähnten Könige sind gewöhnliche Menschen, die erst durch ihr Amt besonders werden. Auch scheinen Entscheidungen eher weltlicher Logik und Diplomatie zu folgen als göttlicher Eingebung. Das Königsamt scheint überhaupt sehr viel weniger stark verknüpft mit der Kirche.
2.3.2 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Reginonsis Chronica
In dem zum Vergleich bearbeiteten Ausschnitt aus der Chronik des Regino von Prüm39werden durch den Zerfall des Kaiserreichs nach der Absetzung Karls des Dicken 887 diverse Könige erwähnt, wobei Regino nur auf Karl, dessen Nachfolger Arnulf und Odo, den 888 erwählten König der Gallier, näher eingeht. Das Königsbild des Autors schwankt dabei bezüglich des Königheils zwischen den beiden oben beschriebenen. Der zwar mächtige und reiche40aber durch seinen unwürdigen Niedergang doch eindeutig menschliche Kaiser verdeutlicht, dass es das Amt war, welches den Regenten so mächtig machte. Andererseits hängt Regino der Idee des Königsheil an, dass Könige also für ihr Amt geboren sein müssen und somit nicht gewöhnlich sein können41.
Auch der Glauben spielt in Reginos Chronik wieder eine deutlich stärkere Rolle, so schreibt er zum Beispiel über Karl, dass dieser „alle Hoffnung und Planung [...] auf die göttliche Schickung [setzte]“42, seine Entscheidungen also weniger irdischer Logik als viel mehr religiösem Glauben folgten. Auch ist es dem Autor sehr wichtig, die Frömmigkeit des Herrschers zu betonen43, die für ihn eine wichtige Rolle spielt. Zu einer Verknüpfung von weltlichem und kirchlichem Amt kommt es jedoch nicht.
Stellvertretend für die grundsätzlichen Eigenschaften, die Regino von Prüm von einem König erwartet, kann seine Beschreibung von Odo, dem König der Gallier, verstanden werden, einem „tatkräftigen Mann, dem vor andern ‚Schönheit der Gestalt, hoher Wuchs und große Kraft und Weisheit’ eigen waren“44.
2.3.3 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Vita Karoli
Die von Einhard geschriebene Vita Karoli45hebt sich stilistisch und inhaltlich deutlich von der Notkeri Gesta Karoli ab. Einhard, der eine Zeit lang als Lehrer Karl des Großen gearbeitet und zu dessen engsten Vertrauten gehörte46, zeichnet ein sehr detailliertes und persönliches Bild des Regenten, dass in seiner Ausführlichkeit und Nähe nur schwer mit dem distanzierten Wunschbild Notkers zu vergleichen ist.
Einigkeit zwischen beiden Quellen gibt es jedoch zum Beispiel bei der Darstellung der Frömmigkeit der beschriebenen Herrscher. So berichtet auch Einhard vom beispielhaften Eifer Karls, seinem Gott zu dienen und ihn zu ehren indem er Kirchen baute47, sich um würdevolle Gottesdienste bemühte48und Almosen an Bedürftige verteilte. Im Umgang mit nicht-christlichen Völkern beschreibt Einhard im vorliegenden Ausschnitt jedoch eher einen diplomatisch handelnden Herrscher49an Stelle von Notkers „grausamen“50Missionar.
Das Interesse an der Wissenschaft ist auch für Einhard ein wichtiger Teil seines Königsbildes und wird von ihm sogar noch weiter ausgebaut51. Auch die von Notker erwähnte Richter-Tätigkeit findet in den Vita Karoli Bestätigung, allerdings kümmert sich der König in dieser Quelle doch eher nur um die Streitigkeiten, welche ohne ihn nicht entschieden werden könnten52.
Als Besonderheit taucht in dieser Quelle zum erstenmal eine Königin auf53, wenn auch nur als Begründung für die Verschwörungen gegen den ansonsten allseits geliebten König54.
2.3.4 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Vita Hludowici
Thegan, mit vollem Namen Theganbert55, beschreibt im vorliegenden Ausschnitt aus seiner Vita Hludowici56Kaiser Karl den Großen und dessen jüngsten Sohn und Nachfolger Ludwig den Frommen.
Dabei stützt er nicht nur Notkers Vorstellung vom geborenen König, sondern baut diese auch noch aus durch seine Betonung des edlen adligen Stammbaums57. Überhaupt ähneln sich das Königsbild Notkers und Thegans recht stark. Beide sehen das Amt des Königs eng verwoben mit der Kirche. Thegan berichtet sogar von der Aufforderung Karls an seinen Sohn, diese zu „leiten“58. Auch der Aspekt der Missionierung von Ungläubigen taucht wieder auf, wenn auch etwas versteckter59. Dass der König natürlich auch ein Vorbild an „Gottesliebe und Gottesfurcht“60, „Barmherzigkeit“61und „Tugend“62sein sollte, muss nicht mehr erwähnt werden.
Abweichend von Notkers Gesta Karoli bleibt im bearbeiteten Ausschnitt aus Thegans Vita Hludowici die Position des Königs als oberster Richter unbeachtet. Auch der von Notker erweckte Eindruck des „Hausvaters, der sich um das Kleinste kümmert“63, wird von Thegan nicht bestätigt.
2.3.5 Notkers Königsbild im Vergleich mit dem der Historiarum Libri IV
Im vorliegenden zweigeteilten Ausschnitt aus den „Vier Bücher Geschichten“64 von Nithard, einem engen Vertrauten Karls des Kahlen65, geht es erstens um Leben und Tod Karls des Großen und zweitens um dessen Söhne, die Königsbrüder Karl den Kahlen und Ludwig den Frommen.
Obwohl auch er ein Mann der Kirche war enthält sein Königsbild, vielleicht desillusioniert durch die Brüderkämpfe seiner Zeit, kaum einen kirchlichen Bezug. Weder Karl der Große, noch dessen Söhne werden als besonders christlich oder glaubenseifrig beschrieben, wie es in den anderen Quellen der Fall war. Überhaupt sagt Nithard wenig über das Amt des Königs aus und beschränkt sich stattdessen auf die Charaktereigenschaften und Taten der Erwähnten. So beschreibt er Karl den Großen als einen Mann, „welcher in jeder Art von Weisheit und Tugend die Menschen seiner Zeit so überragte, dass er allen Bewohnern der Erde furchtbar, der Liebe und zugleich der Bewunderung wert erschien“66, der „ehrenvoll und segensreich“67regierte und vor allem die „Franken und Barbaren [...] bändigte“68.
Die Söhne Karls beschreibt er als „von mittlerer Größe, schön und ebenmäßig gebildet und zu jeder Übung geschickt; beide mutig, freigebig, klug und beredt“69und verbunden durch eine „heilige und verehrungswürdige Einheit“70. Damit widerspricht Nithardt Notkers Königsbild sicherlich nicht, kann aber auch nicht als Stütze dessen angenommen werden.
3. Fazit
Auch wenn man davon ausgeht, dass im Mittelalter genau wie heute jeder sein eigenes individuelles Königsbild besaß, so lassen sich doch zumindest zwischen den untersuchten Quellen-Ausschnitten eindeutige Parallelen entdecken. Beachtet werden muss dabei sicherlich, dass auf Grund der Tatsache, dass praktisch nur Mönche schrieben, keine Quelle frei von einer gewissen kirchlichen Tendenz ist. Die Gesta Karoli ist dabei ein interessanter Vergleichsmaßstab, da der Autor Notker ein so idealistisches, nahezu märchenhaftes71Königsbild beschreibt, dass sich eine Überprüfung dessen geradezu aufdrängt.
Anstatt davon auszugehen, dass nur die Teile die auch in allen anderen Quellen erwähnt werden typisch für das mittelalterliche Königsbild sind, muss wohl davon ausgegangen werden, dass die verschiedenen Autoren oftmals einfach verschiedene Voraus- und Zielsetzungen bei ihrem Werk hatten und deshalb auch über abweichende Aspekte des Königtums schrieben.
Eine zutreffende Collage aus den unterschiedlichen Königsbildern zu bilden, ohne dabei eine Vermischung mit den eigenen Vorstellungen zu riskieren, fällt schwer und würde den Umfang dieser Arbeit sprengen.
Was sich aber auf jeden Fall feststellen lässt, ist der Wunsch nach einem gerechten, menschlichen und im christlichen Sinne tugendhaften Herrscher, der zumindest innerhalb des Reiches für Sicherheit und Harmonie sorgt. Ein Bild, das gar nicht so weit entfernt ist von dem der Märchen, die wir alle kennen.
4. Quellenverzeichnis
Annales Fuldenses, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen
Reichsgeschichte. Teil 3. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 7, Darmstadt 1969, S. 19 - 177, hier S. 144 - 147.
Einhard: Vita Karoli, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen
Reichsgeschichte. Teil 1. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 5, Darmstadt 1966, S. 163 - 211, hier S. 192 - 199.
Nithard, Historiarum Libri IIII, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 5, Darmstadt 1966, S. 386 - 461, hier I, 1, S. 386 - 387 und III, 6, S. 442 - 443.
Notker, Gesta Karoli, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur Karolingischen
Reichsgeschichte, Teil 2, Freiherr von Stein Ausgabe, Band 7, Darmstadt 1973, hier S. 394 - 399.
Reginonsis Chronica, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen
Reichsgeschichte. Teil 3. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 7, Darmstadt 1969, S. 179 - 319, hier S. 276 - 281.
Thegan: Vita Hludowici imperatoris, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur
karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 5, Darmstadt 1966, S. 213 - 253, hier S. 216 - 221.
5. Literaturverzeichnis
Binding G., in: Lexikon des Mittelalters. Band 1, München 1980
Haefele, H.F., Gschwind, Chr., in: Lexikon des Mittelalters. Band 6, München 1993.
Meyers Lexikonredaktion (Hg.): Meyers grosses Taschenlexikon. Band 8, Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich 1998.
Rau, Reinhold: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 5, Darmstadt 1966.
Rau, Reinhold: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte. Teil 3. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 7, Darmstadt 1975.
[...]
1Notker, Gesta Karoli, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte, Teil 2, Freiherr von Stein Ausgabe, Band 7, Darmstadt 1973, hier S. 394 - 399.
2Ebenda, S. 395, Zeile 35 und 36.
3Reinhold Rau: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte. Teil 3. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 7, Darmstadt 1975, S. 13.
4Notker, S. 395, Zeile 11, 23 und 28.
5Ebenda, S. 395, Zeile 14.
6Rau, S. 13.
7Ebenda, S.13.
8Notker, S. 395, Zeile 13 und 14.
9Ebenda, S 395, Zeile 17, 25 und 31 - 34.
10G. Binding, in: Lexikon des Mittelalters. Band 1, München 1980, S. 524.
11Rau, S. 13.
12Notker, S. 397, Zeile 2 - 4.
13Ebenda, S. 397, Zeile 4.
14Ebenda, S. 397, Zeile 5.
15Ebenda, S. 397, Zeile 5.
16Meyers Lexikonredaktion (Hg.): Meyers grosses Taschenlexikon. Band 8, Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich 1998, S. 66.
17Notker, S. 397, Zeile 6.
18Ebenda, S. 399, Zeile 10.
19Ebenda, S. 397, Zeile 32.
20Ebenda, S. 397, Zeile 19.
21Ebenda, S. 399, Zeile 3 und 5 - 6.
22Ebenda, S. 397, Zeile 24 - 26.
23Ebenda, S. 399, Zeile 20 - 22.
24Ebenda, S. 399, Zeile 22 - 29.
25Ebenda, S. 388, Zeile 24 und 25.
26Annales Fuldenses, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Teil 3. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 7, Darmstadt 1969, S. 19 - 177, hier S. 144 - 147.
27Rau, S. 5.
28Ebenda, S. 3.
29Ebenda, S. 5.
30Annales Fuldenses, S. 145, Zeile 12 und 26.
31Ebenda, S. 145, Zeile 12 und 23 - 40.
32Ebenda, S. 147, Zeile 6.
33Ebenda, S. 147, Zeile 7.
34Ebenda, S. 145, Zeile 13.
35Ebenda, S. 147, Zeile 23 - 26.
36Ebenda, S. 147, Zeile 33.
37Ebenda, S. 147, Zeile 39.
38Ebenda, S. 147, Zeile 29 - 30 und 35.
39Reginonsis Chronica, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Teil 3. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 7, Darmstadt 1969, S. 179 - 319, hier S. 276 - 281.
40Ebenda, S. 277, Zeile 23.
41Ebenda, S. 279, Zeile 25.
42Ebenda, S. 279, Zeile 11 - 12.
43Ebenda, S. 279, Zeile 8 - 11.
44Ebenda, S. 281, Zeile 9 -11.
45Einhard: Vita Karoli, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 5, Darmstadt 1966, S. 163 - 211, hier S. 192 - 199.
46Reinhold Rau: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 5, Darmstadt 1966, S. 157.
47Einhard, S. 197, Zeile 37 ff.
48Ebenda, S. 199, Zeile 3 - 14.
49Ebenda, S. 199, Zeile 19 - 22.
50Notker, S. 397, Zeile 32.
51Einhard, S. 197, Zeile 22 - 32.
52Ebenda, S. 197, Zeile 10 - 13.
53Ebenda, S. 193, Zeile 13.
54Ebenda, S. 193, Zeile 18.
55Reinhold Rau: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1.
56Thegan: Vita Hludowici imperatoris, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 5, Darmstadt 1966, S. 213 - 253, hier S. 216 - 221.
57Ebenda, S. 217, Zeile 3 - 14.
58Ebenda, S. 219, Zeile 34.
59Ebenda, S. 219, Zeile 38 und 39.
60Ebenda, S. 219, Zeile 33.
61Ebenda, S. 219, Zeile 37.
62Ebenda, S.220, Zeile 3.
63Reinhold Rau: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte. Teil 3, S. 13.
64Nithard, Historiarum Libri IIII, ed. Reinhold Rau, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1. Freiherr von Stein Gedenkausgabe. Band 5, Darmstadt 1966, S. 386 - 461, hier I, 1, S. 386 - 387 und III, 6, S. 442 - 443.
65 Reinhold Rau: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte. Teil 1, S. 383. 10
66Nithard, S. 387, Zeile 20 - 23.
67Ebenda, S. 387, Zeile 23 - 24.
68Ebenda, S. 387, Zeile 27 - 28.
69Ebenda, S. 443, Zeile 20 - 22.
70Ebenda, S. 443, Zeile 23.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Hausarbeit über das mittelalterliche Königsbild im Karolinger Reich?
Diese Hausarbeit untersucht das mittelalterliche Königsbild im Karolinger Reich anhand verschiedener Quellen, insbesondere eines Ausschnitts aus der „Gesta Karoli“ von Notker Balbulus. Ziel ist es, herauszufinden, welche Vorstellung die zeitgenössische Bevölkerung von ihrem König hatte und ob das Königsbild in den Quellen übereinstimmt oder von Einzelvorstellungen geprägt ist.
Welche Quellen werden in der Hausarbeit analysiert und verglichen?
Neben der "Gesta Karoli" von Notker Balbulus werden folgende Quellen analysiert und verglichen: Annales Fuldenses, Reginonis Chronica, Vita Karoli, Vita Hludowici Imperatoris und Historiarum Libri IIII.
Was ist die "Gesta Karoli" von Notker Balbulus?
Die "Gesta Karoli" ist eine Sammlung von Geschichten aus dem Leben Karls des Großen, geschrieben von Notker Balbulus. Sie dient in dieser Hausarbeit als Hauptquelle zur Untersuchung des Königsbildes.
Welches Königsbild zeichnet Notker Balbulus in der "Gesta Karoli"?
Notker zeichnet ein idealisiertes Bild von Ludwig dem Deutschen als einem weisen, gottesfürchtigen und gerechten Herrscher. Er beschreibt ihn als einen geborenen König, der sich sowohl um die weltlichen als auch um die religiösen Angelegenheiten seines Volkes kümmert. Er wird mit dem heiligen Ambrosius verglichen und als Beschützer der Kirche und Förderer der Wissenschaft dargestellt.
Wie unterscheidet sich das Königsbild in den Annales Fuldenses von dem in der "Gesta Karoli"?
Im Gegensatz zu Notkers idealisiertem Königsbild betonen die Annales Fuldenses den kriegerischen Aspekt und zeichnen ein realistischeres Bild von den Königen als gewöhnliche Menschen. Die Annales Fuldenses legen mehr Wert auf weltliche Logik und Diplomatie als auf göttliche Eingebung.
Welche Rolle spielt der Glaube in den verschiedenen Quellen bezüglich des Königsbildes?
In den meisten Quellen, einschließlich der "Gesta Karoli", der Vita Karoli und der Vita Hludowici, spielt der Glaube eine wichtige Rolle. Die Könige werden als gottesfürchtig, fromm und als Beschützer der Kirche dargestellt. Die Reginonis Chronica betont auch die Frömmigkeit des Herrschers, während die Historiarum Libri IV von Nithard kaum einen kirchlichen Bezug aufweisen.
Welche Eigenschaften werden in den Quellen von einem idealen König erwartet?
Die Quellen zeigen den Wunsch nach einem gerechten, menschlichen und tugendhaften Herrscher, der für Sicherheit und Harmonie im Reich sorgt. Er soll sowohl mächtig und furchteinflößend gegenüber Feinden als auch gütig und barmherzig gegenüber seinem Volk sein. Ein Interesse an Wissenschaft und Bildung, sowie die Förderung der Kirche und die Wahrung des Glaubens sind ebenfalls wichtige Eigenschaften.
Was ist das Fazit der Hausarbeit?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass es zwar individuelle Unterschiede im Königsbild gab, aber dennoch eindeutige Parallelen in den untersuchten Quellen erkennbar sind. Besonders deutlich wird der Wunsch nach einem gerechten, menschlichen und im christlichen Sinne tugendhaften Herrscher, der für Sicherheit und Harmonie sorgt.
Welche weiteren Informationen sind in den Quellenverzeichnissen enthalten?
Die Quellenverzeichnisse enthalten detaillierte Angaben zu den verwendeten Originalquellen in den Reihen "Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte", Freiherr von Stein Gedenkausgabe, herausgegeben von Reinhold Rau. Diese Angaben umfassen die genauen Seitenzahlen der verwendeten Textauszüge.
- Quote paper
- Nils Krüger (Author), 2001, Das Königsbild des Notker Balbulus in den Gesta Karoli im Vergleich mit anderen mittelalterlichen Quellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105492