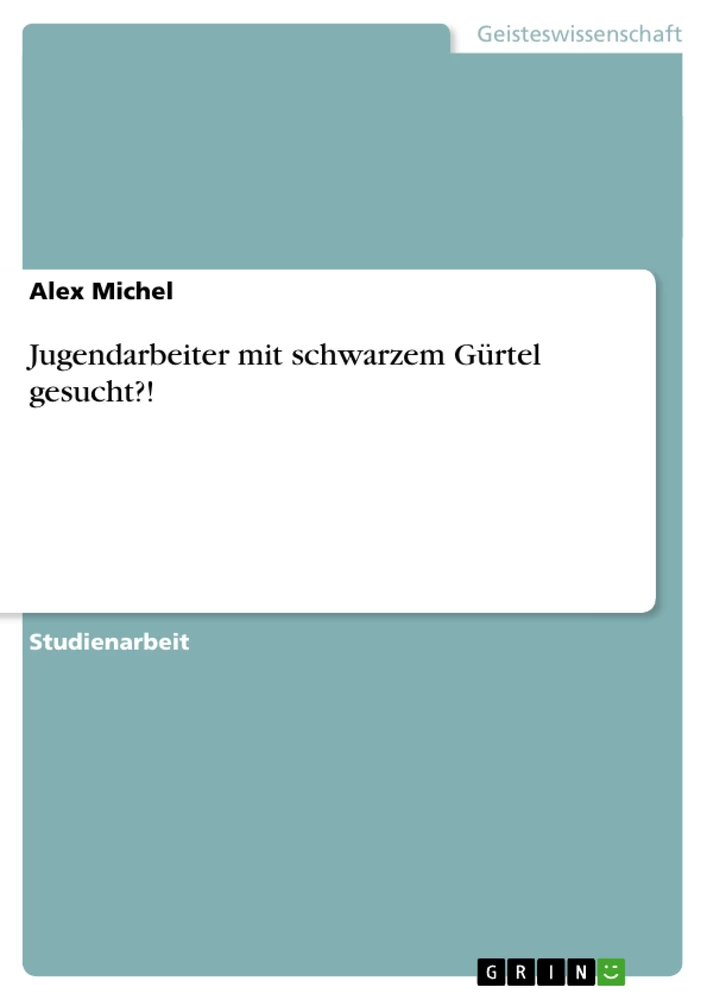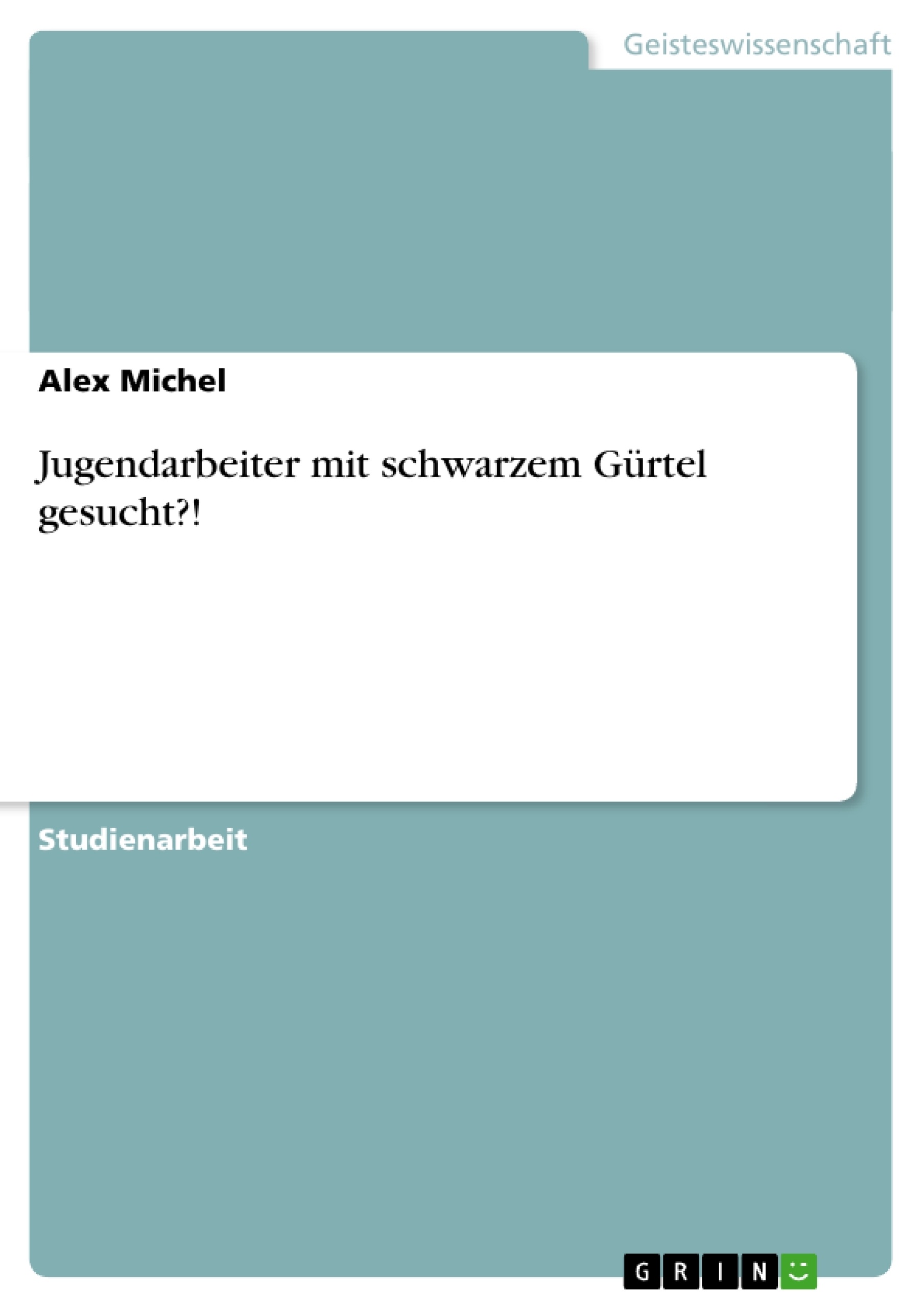Gliederung:
1. Einleitung
2. Begriffserklärung/Überblick
3. Grundlagen des Konfliktmanagements
4. Prävention
4.1. Mediation
4.2. Polizeieinsatz in der Prävention
4.2.1. Ablauf eines Anti-Gewalt-Trainings
4.3. Konfrontative Pädagogik
4.3.1. Coolness - Training
4.3.1.2. Die Methoden des CT
4.3.1.3. Voraussetzungen für ein langfristiges CT
4.3.1.4. Interventionsvoraussetzungen
4.4. Weitere Projekte und Hilfestellungen
5. Schlußbemerkung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung:
Wer in der Jugendarbeit beschäftigt ist tut gut daran, praktische Erfahrung in einer, besser mehreren Selbstverteidigungssportarten zu haben. "Solche und ähnliche Thesen machen an Unis bundesweit vielen angehenden bzw. im Beruf stehenden PädagogInnen den Einstieg in die Jugendarbeit schwerer, zunehmend nicht mehr nur in sozialen Brennpunkten. Ängste werden geschürt und der gewaltige Druck der Medien, die jede Gewalttat möglichst live und in Farbe dokumentieren, fachen Diskussionen über die ,,neue Gewalt - Generation" an. Fragwürdige Konzepte von überforderten Justiz- aber auch Jugenddezernenten wie nächtliche Ausgangssperren und umfassende Kameraüberwachung in Innenstädten sowie eine "Null Toleranz" - Haltung in einigen Jugendgerichten sollen hier Abhilfe schaffen. Steigt man allerdings etwas tiefer in das Thema Aggression und Jugendgewalt ein, wird schnell ersichtlich, daß mit diesen Methoden nur die auffälligsten Symptome mediengerecht bekämpft werden, eine Hilfe für die betroffenen Jugendlichen (bzw. für die PädagogInnen) stellen sie nicht dar.
Langsam stellen sich jedoch immer mehr Ideen ein, dieser Jugend-Gewalt-Welle konstruktiv, innovativ und zeitgemäß zu begegnen. Muß man ein Chuck Norris sein um in der Jugendarbeit zu bestehen? Können auch Ledergurtträger mit Konzepten wie deeskalierende Verhaltenstrainings, Anti-Gewalt-Programmen, Coolness-Training und Mediation in der Jugendarbeit tätig sein?
Die Ursachen und agressionstheoretischen Hintergründe der Gewalt sind nicht zentrales Thema dieser Arbeit, vielmehr stehen hier Konzepte für das ,,Erreichen" der Jugendlichen, die praktische Umsetzbarkeit und die Effektivität der Projekte im Vordergrund. Dennoch sei hier gesagt, daß fast alle Schriften zum Thema Jugendgewalt den Medien und ihren permanenten Gewaltdarstellungen einen ebenso hohen Stellenwert einräumen wie der selbst erfahrenen häuslichen Gewalt.
Zunächst will ich kurz den derzeitigen Stand der Dinge in Sachen Jugendgewalt aufzeigen. Gewalt ist nicht gleich Gewalt und muß daher, um deutliche Unterscheidungen treffen zu können, in verschiedene Formen der Gewalt klassifiziert werden.
Anschließend will ich einen kleinen Überblick geben welche Ideen und pädagogische Lösungsvorschläge zu diesem Bereich angeboten und entwickelt werden. Diese Übersicht soll auch verdeutlichen, daß wir der Jugendgewalt keinesfalls schutz- oder gar hilflos gegenüberstehen. Wenn man bezüglich seines Handelns in Konfliktsituationen in Übung bleibt, findet man immer mehrere Möglichkeiten sich pädagogisch sinnvoll zu verhalten. Jedoch verlangen die neuen Methoden neue Sichtweisen von und für alle Beteiligten. Einige wichtige Projekte und Methoden werde ich nachfolgend skizzieren.
2. Überblick: Was ist (Jugend-) Gewalt und in welchen Formen stellt sie sich heute dar?
Die öffentliche Diskussion über Gewalt von Kindern und Jugendlichen ist seit einiger Zeit wieder aufgeflammt: immer neue Schreckensnachrichten suggerieren einen brutalen (Schul-) Alltag für Kinder und Jugendliche, doch dieser Eindruck ist nur bedingt richtig. Durch das jahrelange Dauerbombardement von realen Gewalttaten und fiktiven Gewaltdarstellungen in den Medien ist die Sensibilisierung gesellschaftsweit gestiegen. Manche heutigen Gewaltdelikte wären noch vor 10 Jahren als ,,Dummer-Jungen-Streich" bezeichnet worden. Zusätzlich hat jeder Mensch auch noch eigene, mehr oder weniger klar gefaßte Vorstellung davon, wo Gewalt beginnt. Deshalb ist eine genaue Festlegung einer Definition unerläßlich. In der wissenschaftlichen Forschung wird inzwischen in allen Disziplinen zwischen körperlicher, psychischer, verbaler und sexueller Gewalt unterschieden.
Körperliche Gewalt ist die Schädigung und Verletzung eines anderen durch physische Kraft und Stärke.
Psychische Gewalt ist die Schädigung und Verletzung eines anderen durch Abwendung, Ablehnung, Abwertung, Entzug von Vertrauen, Entmutigung und emotionales Erpressen (,,Mobbing").
Verbale Gewalt ist die Schädigung und Verletzung eines anderen durch beleidigende erniedrigende Worte, die manchmal schärfer sein können als körperliche Attacken.
Sexuelle Gewalt schließlich ist die Schädigung und Verletzung eines anderen durch erzwungene intime Körperkontakte und andere sexuelle Handlungen, die dem Täter eine Befriedigung eigener Bedürfnisse ermöglicht.
Alle Untersuchungen in den letzen Jahren versuchen sehr sorgfältig, diese Formen von Gewalt getrennt auszuweisen. Dabei zeigt sich, daß vor allem körperliche und sexuelle Gewalt in erster Linie von Jungen und jungen Männern ausgeübt wird, während es bei der psychischen und verbalen Gewalt teilweise einen ebenso hohen Anteil von Mädchen und jungen Frauen unter den Täterinnen und Tätern gibt.
Aggressionen und Gewalt sind immer ein Zeichen mangelnder Integration und für unbefriedigte Bedürfnisse der Selbstentfaltung.
Forschungen zur Sozialgeschichte der Jugendgewalt (Hafeneger 1994; Kiebel 1989; Simon 1996) belegen, daß die Annahme ,,die Ausprägung der aktuellen von Kindern und Jugendlichen verübten Gewalttaten erreiche nie gekannte Ausmaße" so nicht der Wahrheit entspricht. Auch durch frühere Jugendkulturen zieht sich konstant die latente und manifeste Gewaltbereitschaft (Teds, Mods, Rocker,...). Nach anfänglichen gewalttätigen Auseinandersetzungen unter den Cliquen, die sich offensichtlich zunächst an lokalen Zusammenhängen entzünden, dehnen sich die Konflikte auf andere Sozialräume bzw.
Jugendkulturen aus und führen schließlich zu einer öffentlich wahrgenommenen Gewaltwelle, die (mit oder ohne staatliche bzw. polizeiliche Intervention) auch wieder verebbt.
3. Grundlagen zur Konfliktbearbeitung - Das Harvard - Konzept:
Ein Forschungsteam der Harvard - Universität, das sog. ,,Harvard Negotiation Project", beschäftigte sich jahrelang mit einfachen Alltagsproblemen bis hin zu schwierigsten Verhandlungen auf höchster Ebene, mit Verkaufsgesprächen in orientalischen Basaren bis zur Tarifverhandlung der Gewerkschaften. Ziel der Forscher war es, Methoden und Strategien für Konfliktfälle zu entwickeln, die nicht nur helfen sollen unterschiedliche Positionen durch Verhandeln zu überwinden, sondern auch aus verfahrenen Situationen herauszukommen. Das Buch ,,Getting to Yes"(deutscher Titel: Das Harvard - Konzept), 1981 erstveröffentlicht, war ursprünglich für Anwälte, Manager und Diplomaten konzipiert, um sachgerechter und erfolgreicher verhandeln zu können. Darüber hinaus beinhaltet es viele grundlegende Erkenntnisse über Konfliktbearbeitung, die für die pädagogische Arbeit ebenso zutreffend sind.
Einige bedeutsame Überlegungen seien hier kurz erwähnt:
Zwischen Mensch und Problem unterscheiden
Konstruktive Konfliktbearbeitung bedeutet, eine Lösung für das Problem zu suchen ohne die Person anzugreifen. In Konflikten gibt es zwei Grundinteressen: eins bezieht sich auf den Streitgegenstand und eins auf die persönliche Beziehungsebene. Für ein umfassendes Verständnis ist es wichtig, eigene Emotionen und die Gegenseite als berechtigt anzuerkennen, sie in der Bearbeitung des Konflikts aber von der Sache zu trennen.
,,Hart in der Sache, aber sanft zu den beteiligten Menschen" ist der zentrale Grundsatz der ,,principled negotiation", des ,,sachgerechten Verhandelns" des Harvard - Konzepts.
Zwischen Positionen, Interessen und Bedürfnissen unterscheiden
Unter Interessen verstehen wir Wünsche, Ängste und Sorgen. Sie sind die Beweggründe hinter den Positionen, die wir in Verhandlungen und Konflikten vertreten. Von der einmal bewußt eingenommenen Haltung kann der Einzelne oft nur schwer abgehen. Das dahinterliegende Interesse kann aber meist durch mehrere mögliche Positionen befriedigt werden.
Das heißt für den Umgang mit Konflikten, daß es wichtig ist, die Konfliktparteien zu bewegen, ihre Interessen klar zu formulieren, um alternativen zu festgefahrenen Positionen zu finden. Wenn auch noch die Interessen und Bedürfnisse der Gegenseite als legitim angesehen werden, wird es leichter, eine Lösung zu finden.
Die verschiedenen Ebenen eines Konflikts beachten
Oft geht es in Konflikten gar nicht um den vordergründigen Streitgegenstand, sondern um etwas ganz anderes - um lange zurückliegende unbearbeitete Konflikte, Mißverständnisse, Machtkämpfe oder unterschiedliche Wertvorstellungen. Wenn die verschiedenen Ebenen eines Konflikts getrennt behandelt werden können, ist es sehr viel leichter, den Konflikt zu bearbeiten.
Die Kommunikation im Konflikt aufrechterhalten oder wiederherstellen
Je weiter ein Konflikt eskaliert, desto ungenauer und vorurteilsbeladener wird die Kommunikation unter den Beteiligten. Dennoch ist es wichtig, die Kommunikation irgendwie aufrechtzuerhalten. Denn die ,,Kosten" bei einem frühzeitigen Abbruch der Beziehung sind meist größer als die Mühe, eine noch so niedrigschwellige Kommunikationsebene bestehen zu lassen. Dabei kann eine dritte Person sehr hilfreich sein.
Nach ,,WinWin" - Lösungen suchen
Für viele Konflikte gibt es nicht nur die Lösung der einen oder anderen Partei, sondern vielleicht eine ganz andere. Das Zauberwort heißt ,,WinWin" - also Lösungen, bei denen beide Seiten gewinnen. Oft ist schon viel erreicht, wenn die Konfliktparteien sich darauf einlassen, gemeinsam nach anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen, statt all ihre Kraft darauf verwenden, ihre ursprünglich eingenommenen Positionen durchzusetzen.
4. Prävention
"Der rei ß ende Strom wird gewaltt ä tig genannt, aber das Flu ß bett, das ihn einengt, nennt keiner gewaltt ä tig." B. Brecht
Auf der Suche nach geeigneter Literatur zum Thema ,,Deeskalation" im Bezug auf Jugendgewalt stellte ich fest, daß bedeutend mehr Auswahl an Werken zur Präventionsarbeit vorhanden ist. Auch in den wenigen zutreffenden Veröffentlichungen nimmt Prävention eine wichtige Position ein.
M. Schwabl beschreibt in seinem Standardwerk ,,Eskalation und De - Eskalation in Einrichtungen der Jugendhilfe" ein dreistufiges Modell:
1. Primärprävention
2.Sekundärprävention
3. Tertiärprävention
Bei primärer Prävention geht es darum, zu verhindern, daß überhaupt Probleme mit Gewalt entstehen, während sekundäre Prävention verhindern will, daß sich erste Anzeichen verfestigen und tertiäre Prävention bereits aufgetretene Gewaltvorfälle so bearbeiten will, daß sie sich in dieser Form nicht wiederholen.
Zwei Prozesse sollten Gruppenpädagogen immer wieder anregen:
- einen Prozeß des ,,geführten Aushandelns" von Regeln, mit denen sich die Jugendlichen zumindest ansatzweise identifizieren können.
- aktions - und körperbetonte Erlebnisse und Aufgabenstellungen bieten, an denen Prozesse wie gemeinsames Planen, koordiniertes Vorgehen, gemeisterte gemeinsame Belastungen ausprobiert und hautnah er-lernt und er-lebt werden können.
4.1. Mediation - Konflikte selber lösen:
Grundgedanke ist, daß nicht der Konflikt im Vordergrund steht sondern die Art und Weise wie wir damit umgehen. Konflikte sind eher etwas Positives. Sie zeigen uns, daß etwas nicht stimmt: daß es unterschiedliche Interessen, Wünsche und Wahrnehmungen gibt. Gewalt und Leid gehen oft auf ungelöste Konflikte zurück und gerade bei Kindern und Jugendlichen sind es Zeichen dafür, daß sie keinen anderen (Aus-)Weg wissen. Formen konstruktiver Konfliktbearbeitung zu vermitteln ist daher eine wesentliche Forderung an die moderne Erziehung.
Allerdings wissen wir, daß es für die am Konflikt Beteiligten oft sehr schwer ist, im direkten Gespräch eine Lösung für ihren Streit zu finden. Zu sehr sind sie emotional verstrickt und zu sehr hemmt sie die Angst, das Gesicht zu verlieren. In dieser Situation kann eine dritte Person, die von beiden Seiten akzeptiert wird, helfen tragbare Kompromisse zu finden. Diese Unterstützung durch eine neutrale dritte Person (StreitschlichterIn, Konfliktlotsen,...) ist der Grundgedanke von Mediation.
Interessen, Regeln/Recht und Macht sind die drei Grundelemente in Konfliktsituationen. Daraus ergeben sich drei Wege zur Lösung eines Konflikts:
Die Konfliktparteien können:
1. ihre Interessen ausgleichen und gemeinsam eine beide Seiten befriedigende Lösung finden.
2. sich auf anerkennende Regeln, Normen oder Rechtspositionen berufen und daraus ableiten oder bestimmen lassen, wer im Recht ist.
3. ihre jeweilige Machtposition einsetzen, um ihre Interessen durchzusetzen (Oder eine übergeordnete Instanz beendet den Streit durch ein ,,Machtwort").
Mediations - oder Streitschlichterprogramme in Schulen oder Gruppen einzuführen heißt zuerst einmal alle Beteiligten möglichst umfassend aufzuklären. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich zu StreitschlichterInnen bzw. KonfliktlotsenInnen ausbilden lassen und sollten regelmäßige Supervisionsmöglichkeiten bekommen.
4.2. Polizeieinsatz in der Prävention:
Die Bürger vor Straftaten zu bewahren ist die Hauptaufgabe der Polizei, doch ist in Zeiten der meßbaren Statistiken das Augenmerk der Polizei in immer stärkerem Maße auf die Strafverfolgung gerichtet worden. In den 70`er und 80`er Jahren war der Kontakt der Polizei zu Schulen und Jugendeinrichtungen auf ein Minimum beschränkt. Seit Anfang der 90`er macht sich die Polizei vermehrt Gedanken zur Kriminalprävention und führt Projekte und Verhaltenstrainings in Kooperation mit lokalen Einrichtungen durch. Wie auch allen pädagogischen Präventivmaßnahmen fehlt hier die statistische Belegbarkeit nicht begangener Straftaten. Es bleibt zu hoffen, daß Stimmen aus der Polizei helfen, die Gesellschaft und die Politik für dieses substanzielle Problem zu sensibilisieren.
Polizeiliche Prävention hat den Auftrag, Gefahren zu erkennen und von den Menschen abzuwenden. Dazu ist es notwendig, mit allen Menschen zu reden und möglichst frühzeitig damit anzufangen. Hier ist nötig über den Sinn von Gesetzen zu sprechen und allgemein akzeptierte Werte, zu denen auch Gewaltfreiheit, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage zählt, deutlich zu machen. Es gilt bei denen, die diese Werte ablehnen Zweifel über ihr Verhalten zu wecken und jenen, die diese Werte für erstrebenswert halten, Bestätigung für ihre Haltung zu geben. In vielen Städten bieten besondere Dienststellen auf Anfrage sog. Anti-Gewalt-Trainings in Schulen bzw. Jugendeinrichtungen an.
Bei diesen Veranstaltungen stehen keine Zahlen, Daten und Statistiken im Vordergrund. Es geht auch nicht um präzise juristische Bewertungen von Tatbeständen und Verhaltensweisen. Intention ist mit, nicht über Jugendliche, in offenes Gespräch zu kommen. Das Nachdenken über wichtige Werte wie Gewaltfreiheit, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit soll im Gespräch mit Erwachsenen, die nicht die eigenen Lehrer sind, angeregt werden. Dabei soll bei denen, die diese Werte ablehnen Zweifel über ihr Verhalten zu wecken und jenen, die diese Werte für erstrebenswert halten, Bestätigung für ihre Haltung zu geben. Um einerseits diesen Zielen den nötigen Nachdruck und die Ernsthaftigkeit zu verleihen und andrerseits ein freundschaftlicheres Umgehen und Verständnis füreinander zu entwickeln ist es m.E. positiv zu bewerten, daß die Polizei diese Aufgabe übernimmt.
4.2.1. Ablauf eines Anti - Gewalt - Trainings der Berliner Polizei (Muster):
Die nachfolgenden Themenschwerpunkte werden in allen Veranstaltungen bearbeitet. Die Reihenfolge ist nicht festgelegt, auch gehen die Themenbereiche teilweise ineinander über. Dies hängt insbesondere vom Verlauf der angewendeten kleinen Rollenspiele und Verhaltenstrainings ab und von den Gedanken, die von den Mitspielern eingebracht werden.
- Vorstellungsrunde
- eigene Gewalterfahrungen
- Was ist Gewalt?
- Ursachen der Gewalt
- Häusliche Gewalt
- Schule, Schulhof und Schulweg
- Politisch motivierte Gewalt
- Wie kann man Opfer werden?
- Gewalt in öffentlichen Verkehrsmitteln
- Sachbeschädigung, Graffiti
- Notwehr und Nothilfe
- Hilfeverhalten, Hilfe leisten
- Hilfe suche
- Bewaffnung
- Anzeige und Täterbeschreibung
- Einhalten von Regeln
Einige Punkte werden aufgrund ihrer Relevanz gesondert betrachtet:
Vorstellungsrunde:
Um die erste Kontaktaufnahme zu erleichtern stellt sich im Stuhlkreis jeder, auch Beamte/r und LehrerIn, mit Namen, Alter, Klasse und - wichtig - Beispielen eigener Freizeitgestaltung vor. Hier werden erste Gemeinsamkeiten gefunden , die Umgebung und die vielen Menschen wirken eher vertrau t, die Atmosph ä re wird gel ö ster, beispielsweise 4 - 8 Stunden t ä glicher Fernsehkonsum, Rumh ä ngen mit Kumpels, usw...
Eigene Gewalterfahrung:
Das Thema wird genannt und nach Vorerfahrung Vorstellung gefragt. Die Beamten geben den ausdrücklichen Hinweis, daß niemand etwas preiszugeben braucht, was er nicht möchte. Interessant ist hierbei, daß die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler keine eigenen Gewalterfahrungen hat. In Ruhe werden die Beiträge besprochen. Gewalt in Familien ist den meisten Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Erscheinungsformen durchaus bekannt.
Die meisten Gewalterfahrungen bringen die jungen Menschen jedoch aus dem täglichen Fernsehkonsum mit.
Was ist Gewalt?
Anhand des ,,Gewaltstrahls" soll verdeutlicht werden , daß Gewalt eigentlich überall dort beginnt, wo ein anderer Mensch körperlich oder seelisch verletzt wird. Für das Einordnen der Straftaten in den ansteigenden Gewaltstrahl sind weniger die juristischen Feinheiten als vielmehr das Gefühl der Schülerinnen und Schüler von Bedeutung. Rollenspiele werden als Hilfe zur Suche nach den Ursachen der Gewalt eingesetzt.
Hier legen die Beamten Wert darauf, viele Meinungen aus der Gruppe zu hören, sie zusammenzufassen und auf eine oder zwei Ursachen zurückzukommen, die dann exemplarisch betrachtet werden. Diese Betrachtung soll nur dem besseren Verständnis dafür dienen, daß das Auftreten von Gewalt seine Ursachen in vielfältigen Bedingungen hat, die in der Gesellschaft, in der Erziehung, in der Familie, in der Arbeitswelt, im Freizeitverhalten zu suchen sind. Hier muß durch die jeweilige Lehrkraft, wie auch zu anderen Themenkomplexen, notfalls intensiv nachbearbeitet werden.
Häusliche Gewalt
Dies ist naturgemäß ein Thema, zu dem fast alle Schülerinnen und Schüler beitragen können. Aus eigenem Erleben und aus dem Erleben von Mitschülern und Freunde wird intensiv gesprochen und diskutiert.
Hier taucht oft die Frage auf ob es denn erlaubt sei, daß Eltern ihre Kinder schlagen. Hier ist ganz klar der Gesetzgeber gefordert. Auch können hier Fragen über sexuelle Gewalt besprochen werden.
Politisch motivierte Gewalt
Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Nationalsozialismus sind wichtige Themenkreise, die in den Schulen eingehend besprochen und evtl. auch behandelt werden müssen. Die Beamten gehen bei diesen kurzen Veranstaltungen nur in der Weise ein, daß sie den Jugendlichen etwa folgende Informationen geben:
- Orte meiden, an denen sich erkennbar Rechtsradikale, ,,Glatzen" oder Gruppen, die sich radikal verhalten
- Vermeiden eines Zusammentreffens mit solchen Gruppen, insbesondere wenn man selber oder Begleiter dunkelhäutig oder fremdländisch aussieht.
- An fremden Orten die örtliche Polizei anrufen und sich über potentiell gefährliche Stellen und Verhaltensregeln informieren. Um Scheu vor Behörden und Polizei abzubauen, kann ein solcher Anruf auch als Rollenspiel durchgespielt werden. Den jungen Menschen soll klar sein:
- ,, Ich bin bei meinem Anruf kein Bittsteller." Die Polizei ist ein Dienstleistungsunternehmen. Sie erbringt einen Service. Sollte sich wider Erwarten eine Dienststelle stur stellen und auf ein berechtigtes Anliegen nicht reagieren, sollte man den Fall nicht auf sich beruhen lassen, sondern sich beim Vorgesetzten oder der vorgesetzten Dienststelle beschweren.
4.3. Konfrontative Pädagogik
Der Entwurf der konfrontativen Pädagogik ist aus der Erkenntnis entstanden, daß der akzeptierende und entschuldigende Ansatz der letzten Jahre nicht sehr geeignet für den Umgang mit aggressiven Kindern und Jugendlichen erscheint. Wie sich die Sichtweise und gängige Praxis gewaltpräventiver Arbeit im Laufe der Jahre veränderten, wird aus folgender Entwicklung deutlich:
Von der ,,verstehenden, entschuldigenden P ä dagogik" (jedwede Regel- und Normenverletzung wird den Klienten nachgesehen, wenn ihre individuelle Sozialisation nur schwer genug war)
über ,,Jugend und Gewalt - verstehen, aber nicht einverstanden sein"
zu ,,Konfrontation als Hilfe".
Das Konzept einer würdigenden Konfrontation hat O. Hagedorn vom Berliner Institut für Lehrerfort - und Weiterbildung und Schulentwicklung in ihren Unterrichtsideen ,,Konfliktlotsen" ( Hagedorn 1994) auf die Formel ,,Akzeptanz + Konfrontation = soziale Entwicklung" gebracht.
Konfrontative Pädagogik ist geführte Gruppenintervention, letztlich klassische soziale Kontrolle im Gewand der Peer-Group-Education. In diesem Prozeß ist die ,,Gruppe der Gleichen" im Idealfall der eigentliche Machtfaktor. Im CT (Coolness-Training, s.u.) wird vom Gruppenleiter ein Gruppenprozeß initiiert, der ,,lediglich" Verhaltensänderung herbeiführen soll. Es geht nicht um Persönlichkeitsveränderungen im Sinne eines therapeutischen Ansatzes. Von manchen Pädagogen wird die Peer-Group-Education vor allem unter negativen Vorzeichen (schlechter Einfluß) wahrgenommen. Zahlreiche Kinder und Jugendliche sind jedoch in der Lage, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler positiv zu beeinflussen verantwortungsvoll untereinander Streit zu schlichten. Sie verstehen es mindestens ebensogut, wenn nicht besser, Opfern und Tätern ihre Hilfe anzubieten, um die aktuellen Konflikte zu lösen.
4.3.1. Coolness - Training
Aufgrund der konfrontativ-prophylaktischen Ausrichtung wird es vor allem in Schulen und Jugendeinrichtungen durchgeführt.
Das Coolness-Trainig (CT) ist für gewaltbereite Kinder und Jugendliche konzipiert, richtet sich allerdings auch an deren potentielle und tatsächliche Opfer und an die scheinbar unbeteiligten Zuschauer.
Im Handlungsviereck von Täter, Opfer, Gruppe (Zuschauer) und Einrichtung (Schule), die alle auf ihre spezifische Weise und in vernetzter Form für die Bedingungen der Gewaltereignisse verantwortlich sind, werden im CT Verhaltensalternativen erarbeitet. Die Täter, die hauptsächlich Jungs sind, haben in der Regel verschiedene Formen der persönlichen Benachteiligung erfahren und begonnen, ihrem Umfeld mit wachsender Abwehrhaltung und Feindseligkeit zu begegnen. Die Illusion, Gewalt löse Probleme wird vor allem von der Reaktion der Opfer und der scheinbar unbeteiligten Zuschauer gespeist. Im CT wird die Abwehr und Feindseligkeit reduziert. Dabei spielen Rituale und Strukturen der Begegnung im öffentlichen Raum eine bedeutsame Rolle. Diese Strukturen werden analysiert, in Phasen zerlegt und im Rollenspiel inszeniert. Kinder und Jugendliche arbeiten während dieser Phase mit gesteigertem Interesse. Hier ist Action angesagt.
Die Opfer tragen häufig zur Entstehung und Verschärfung von Gewaltereignissen bei. Sie geraten oft in die Opferrolle, weil sie:
- bestimmte Verhaltensmuster in der Klasse oder Gruppe nicht durchschauen,
- über keinen ausreichenden Selbstschutz verfügen,
- nicht in der Lage sind, in Konfliktsituationen Handlungsstrategien zu entwerfen,
- sich durch Körpersprache immer wieder ins Spiel bringen.
Die Gruppe begünstigt häufig die Faktoren ,,Auslöser und Gelegenheit".
Gruppendynamische Prozesse beeinflussen die unmittelbare Situation und tragen zur Entstehung von Gewaltereignissen bei. Zahlreiche Gewalttaten ließen sich verhindern, wenn die anwesende Gruppe , die vor Angst und Hilflosigkeit gelähmt ist, über ein Handlungskonzept verfügen würde.
Die Pädagogen in der Einrichtung bzw. Schule, aber auch die Eltern werden von den Tätern und oft auch von den Opfern ausgegrenzt. Es fällt immer wieder auf, wie wenig z.B. Lehrer von Erpressungen und Körperverletzungen wahrnehmen. Dies ist in der Strategie der Täter begründet, vor allem aber einer zeitweise kollektiven Problemverleugnung seitens der Pädagogen zuzuschreiben. Die Ausgrenzung des Lehrkörpers wird durch den mangelnden Einblick in die Vernetzung begünstigt. Die jugendlichen Täter sind die einzigen, die umfassende Kenntnisse haben und in gewisser Weise vernetzt sind.
Bei der Durchführung des CT hat folgender Leitsatz oberste Priorität: ,,Niemand hat das Recht, den anderen zu beleidigen, zu verletzen oder auszugrenzen. Geschieht dies dennoch erfolgt Konfrontation."
Die Konfrontation, ausgeübt in verschiedenen Levels und Härtegraden, muß im Sinne von O. Hagedorn (s.o.) stets wohlwollend erfolgen.
4.3.1.1. Die Methoden des CT:
Körperbetonte (Kampf-)Spiele:
Die Teilnehmer lernen aggressive Anteile und körperliche Reaktionen bewußt wahrzunehmen. Gewalt fasziniert, sie muß aber durch Akzeptanz und Toleranz kultiviert werden.
Deeskalation - sinnvolles Verhalten in schwierigen Situationen:
Effizientes und sinnvolles Verhalten kann erprobt und eingeübt werden. Durch aktive Kommunikation kann das Opfer die zugeschriebene Rolle verlassen oder gar nicht erst annehmen.
Konfrontation auf dem heißen Stuhl:
Täter werden mit nicht akzeptierten Verhalten konfrontiert. Sie müssen sich inhaltlich damit auseinandersetzen und die z.T. recht harten Konfrontationen mit Gleichaltrigen aushalten.
Entwicklung von Opferperspektive:
Täter müssen sich mit der Befindlichkeit von Opfern auseinandersetzen. Dies geschieht durch Rollentausch, Opferbrief, Filme über Opfer und durch Berichte von Unfallärzten.
Rollenspiele
Interaktionspädagogische Übungen
Visualisierungstechniken
Entspannungs - und Vertrauensübungen:
Die Verbesserung der individuellen Körperwahrnehmung durch Entspannung und Erfahrungen mit der Gruppe verändern die Atmosphäre positiv und führen zu einer besseren individuellen Befindlichkeit.
4.3.1.2. Voraussetzungen für ein langfristiges CT
Um ein länger andauerndes, konfrontatives Coolness - Training (3 bis 5 Monate, 2 bis 3 Schulstunden pro Woche) in Schulklassen und Jugendgruppen durchführen zu können, müssen die Bedingungen stimmen. Schulen und Jugendeinrichtungen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, bzw. Bedingungen eingehen:
- Das CT ist keine ,,medikamentöse Eingabe", die zukünftig alle Konflikte verhindert. Es ist ein Angebot an PädagogInnen, sich neue Zugänge zu ihrer Klasse/Gruppe zu erschließen. Die Teilnahme der Pädagogen und der Wille zur dauerhaften Begleitung der neuen Prozesse ist grundsätzlich Voraussetzung zur Durchführung des Trainings.
- Zwischen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften muß ein zumindest im Ansatz belastbares Verhältnis bestehen, daß auf gegenseitigem Interesse begründet ist. Das Training scheiterte immer dann, wenn sich bei den Schülern und Schülerinnen der Eindruck eines neuen ,,pädagogischen Tricks!" von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer aufdrängte. Die Einschätzung ihrer Beziehung zu ihrer Klasse ist für die Lehrer ein wichtiger Aspekt.
- Die Schülerinnen und Schüler müssen eine Mindestmotivation für das Training haben. Erfahrungen zeigen, daß dies keine nennenswerte Hürde darstellt. ,,Alles ist besser als Schule".
- Für die Schülerinnen und Schüler muß klar sein , worum es thematisch geht und daß möglicherweise neue Anforderungen und Zumutungen auf sie zukommen. Die jugendspezifische Interpretation von ,,Cool-Sein" meint Durchsetzung, Souveränität, Erfolg und Sicherheit. Aus dieser Grundannahme ergibt sich bei den Jugendlichen manchmal eine falsch interpretierte Faszination für das Coolness - Training.
4.3.1.3. Die Interventionsvoraussetzungen
Die Trainer haben im Coolness - Training nicht das Recht, die Widerstände der Teilnehmer niederzuwalzen.
Die Teilnahme ist immer freiwillig. Im konfrontativen Umgang mit den Kindern und Jugendlichen benötigen die Coolness - Trainer daher mehrere Interventionsberechtigungen:
1. Die grundsätzliche Bereitschaft der Einrichtung zur Durchführung des Trainings mit seinen besonderen Prinzipien.
2. Die Bereitschaft der Gruppe oder Klasse, das Training mitzumachen.
3. Das Einverständnis der Eltern, die im Rahmen eines Info-Abends zum Thema Gewaltprävention informiert und auf die besonderen Inhalte des CT hingewiesen werden.
4. Die situative Interventionberechtigung des Teilnehmers oder Teilnehmerin unmittelbar vor der Konfrontation.?
Die situative Interventionsberechtigung des Teilnehmers/der Teilnehmerin nimmt neben dem Einverständnis der Eltern eine bedeutsame Stellung ein. Keiner der Teilnehmer ist verpflichtet mitzuarbeiten. Das Angebot ist eine freiwillige Teilnahme. Die Schülerinnen und Schüler wissen jedoch, daß sich die Trainer sich in bestimmten Situationen konfrontativ verhalten werden und somit belastend für sie sein können. Es gibt daher die Möglichkeit, wenn es zuviel wird, auszusteigen. Für das Coolness - Training gilt:
,,Kinder und Jugendliche k ö nnen nicht immer tun, was sie wollen, aber sie m ü ssen wollen, was sie tun."
J. Piaget
4.5. Weitere Projekte und Hilfestellungen
Das Konzept und die Methode die Klienten zu erreichen kann keine Erfolgsgarantie geben. Ansätze könnten sein:
- Beziehungsarbeit/Angebote
- Lehrstellenvermittlung
- Schulvermittlung
- Maßnahmenbegleitung nach Strafverfahren
- Erlebnispädagogik
- Medienpädagogik
- Peer Support
- Jugendbildungsarbeit
- Aktivierung von Jugendlichen für den Stadtteil
- Projekt: ,,Faustlos", wird an 21 Grundschulen in HD und MA durchgeführt
- ,,Trainingsraum" an der Theodor - Heuss - Schule in Sinsheim
- Jugendinitiative Step 21
- usw...
5. Schlußgedanken
Mit der Vielfalt der neuen Methoden, der Vielzahl an (zumindest kommunalen) erfolgreichen Projekten und nicht zuletzt durch die digitale Vernetzung ist meiner Meinung nach ein Pool an pädagogischen Interventionsmöglichkeiten gegeben, der es Interessierten ermöglicht, Hilfen und Anregungen für sein spezielles Problem zu finden.
Neue Entwicklungen in der Lebenswelt Kinder und Jugendlicher stellen neue Anforderungen an die Pädagogen. Was in diesen Ausführungen deutlich werden sollte ist, daß auf allen Feldern der Pädagogik und vor allem in deren Kombinationen Möglichkeiten erkannt, analysiert, benutzt, bewertet und ausgetauscht werden.
Es kommt also nicht darauf an, möglichst viel Kampfsporterfahrung in dieses Berufsfeld mitzubringen, sondern vielmehr darum, die Bereitschaft und die Motivation zu entwickeln, sich auf sein Klientel ,,einzuarbeiten". Methoden und Verhaltensmuster können und müssen auch von den Pädagoginnen und Pädagogen erlernt werden.
Eine flächendeckende Einführung des Wahlpflichtfaches ,,Konstruktive Konfliktbearbeitung" an den Schulen, die in Verbindung mit einem lebendigen, flexiblen Netzwerk steht, dem alle Jugendhilfeeinrichtungen, Behörden und relevante Firmenkontakte angeschlossen sind, wäre aus pädagogischer Sicht sicherlich wünschenswert. Dies in die Wege zu leiten dürfte für die kommenden Jahre ein Hauptthema für alle Beteiligten sein.
6. Literaturverzeichnis:
bsj-Marburg (Hg.): Bambule - Dokumentation der Fachtagung Gewalt im Kontext von Jugendhilfe und Jugendpsychatrie. Marburg 1996
Engel, U./Hurrelmann, K.: Was Jugendliche wagen. 2. Auflage. Weinheim/München 1994 Gall, R. :Warum es gut sein kann, böse Menschen schlecht zu behandeln! Coolness- Training® für gewaltbereite Kinder und Jugendliche - ein Konzept zur konfrontativen Pädagogik. Aus Lernende Schule, Heft 13, 2001)
Hurrelmann, K.: Schule und Gewalt - die gegenwärtige Diskussion. Aus Lernende Schule, Heft 13, 2001)
Müller, W.: Konzept für die Anti - Gewalt - Veranstaltungen der Berliner Polizei mit Schulklassen und Gruppen. Aus Texte zur Inneren Sicherheit: Bestandsaufnahme, Präventionsstrategien und Modellprojekte gegen rechtsextremistische Jugendgewalt, hrsg. vom Bundesministerium des Inneren (Band I/00)
Nolting, H.-P.: Lernfall Aggression. 19.Auflage. Hamburg 2000
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit behandelt Konfliktmanagement und Prävention von Jugendgewalt, mit einem Fokus auf praktische Konzepte und Methoden zur Erreichung von Jugendlichen und die Effektivität verschiedener Projekte.
Welche Formen von Gewalt werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen körperlicher, psychischer, verbaler und sexueller Gewalt.
Was ist das Harvard-Konzept und wie wird es im Kontext der Konfliktbearbeitung angewendet?
Das Harvard-Konzept ist eine Methode zur Konfliktbearbeitung, die auf der Unterscheidung zwischen Mensch und Problem, Positionen, Interessen und Bedürfnissen basiert. Es zielt darauf ab, Win-Win-Lösungen zu finden und die Kommunikation im Konflikt aufrechtzuerhalten.
Was sind die drei Stufen der Prävention nach M. Schwabl?
Die drei Stufen der Prävention sind: Primärprävention (Verhinderung des Entstehens von Gewaltproblemen), Sekundärprävention (Verhinderung der Verfestigung erster Anzeichen) und Tertiärprävention (Bearbeitung bereits aufgetretener Gewaltvorfälle, um Wiederholungen zu vermeiden).
Was ist Mediation und wie wird sie zur Konfliktlösung eingesetzt?
Mediation ist ein Verfahren, bei dem eine neutrale dritte Person (Mediator) den Konfliktparteien hilft, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, indem sie ihre Interessen ausgleichen und tragbare Kompromisse schließen.
Welche Rolle spielt die Polizei in der Prävention von Jugendgewalt?
Die Polizei führt präventive Projekte und Verhaltenstrainings in Kooperation mit lokalen Einrichtungen durch, um Gefahren zu erkennen, über den Sinn von Gesetzen zu sprechen und Werte wie Gewaltfreiheit, Toleranz und Zivilcourage zu vermitteln.
Was ist konfrontative Pädagogik und wie unterscheidet sie sich von anderen Ansätzen?
Konfrontative Pädagogik ist ein Ansatz, der im Gegensatz zu akzeptierenden und entschuldigenden Ansätzen steht und auf der Konfrontation mit aggressivem Verhalten basiert, um Verhaltensänderungen zu bewirken.
Was ist Coolness-Training (CT) und an wen richtet es sich?
Coolness-Training (CT) ist ein konfrontativ-prophylaktisches Training für gewaltbereite Kinder und Jugendliche, deren Opfer und scheinbar unbeteiligte Zuschauer. Es zielt darauf ab, Verhaltensalternativen zu erarbeiten und die Dynamik von Gewaltereignissen zu verstehen.
Welche Methoden werden im Coolness-Training eingesetzt?
Zu den Methoden im Coolness-Training gehören körperbetonte Spiele, Deeskalationstraining, Konfrontation auf dem heißen Stuhl, Entwicklung von Opferperspektiven, Rollenspiele, Visualisierungstechniken sowie Entspannungs- und Vertrauensübungen.
Welche Voraussetzungen sind für ein langfristiges Coolness-Training notwendig?
Für ein langfristiges Coolness-Training sind die Teilnahme der Pädagogen, ein belastbares Verhältnis zwischen Schülern und Lehrkräften, eine Mindestmotivation der Schüler und eine klare thematische Ausrichtung erforderlich.
Was sind die Interventionsvoraussetzungen im Coolness-Training?
Die Interventionsvoraussetzungen im Coolness-Training umfassen die Bereitschaft der Einrichtung, der Gruppe oder Klasse, das Einverständnis der Eltern und die situative Interventionsberechtigung des Teilnehmers vor der Konfrontation.
Welche weiteren Projekte und Hilfestellungen werden erwähnt?
Weitere Projekte und Hilfestellungen umfassen Beziehungsarbeit, Lehrstellenvermittlung, Schulvermittlung, Maßnahmenbegleitung nach Strafverfahren, Erlebnispädagogik, Medienpädagogik, Peer Support, Jugendbildungsarbeit und die Aktivierung von Jugendlichen für den Stadtteil.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit ist, dass es eine Vielzahl an pädagogischen Interventionsmöglichkeiten gibt und die Bereitschaft und Motivation zur Einarbeitung in das Klientel wichtiger ist als reine Kampfsporterfahrung. Eine flächendeckende Einführung des Wahlpflichtfaches ,,Konstruktive Konfliktbearbeitung" an den Schulen wird als wünschenswert angesehen.
- Quote paper
- Alex Michel (Author), 2001, Jugendarbeiter mit schwarzem Gürtel gesucht?!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105598