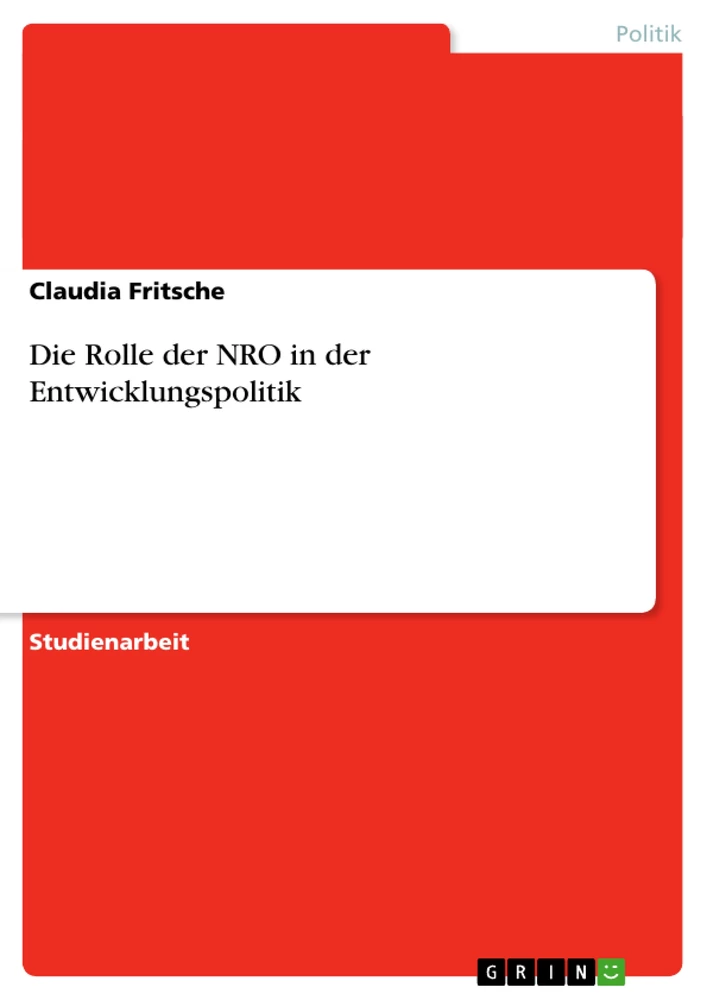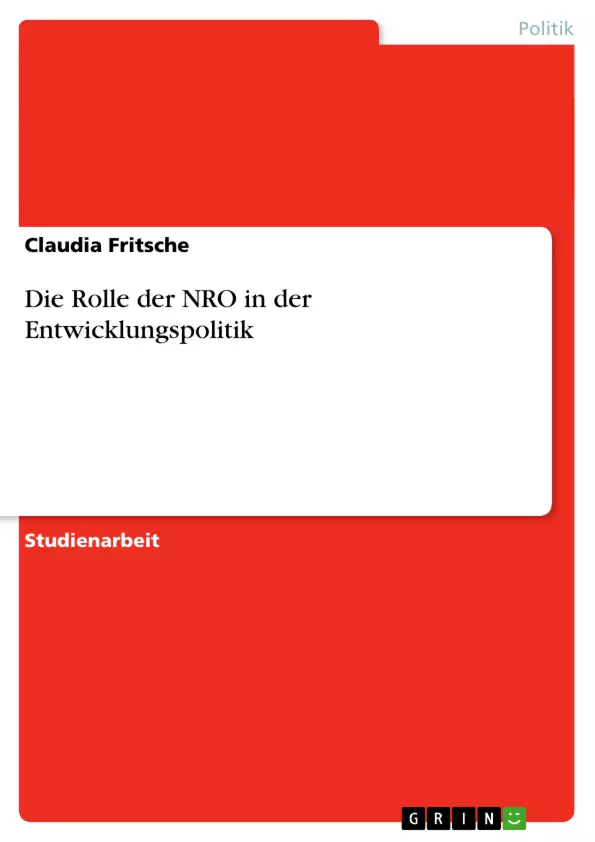Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionsversuch von Non-Governmental-Organizations
2.1. Begriffliche Unklarheit
2.2. Definition
3. Typologie nach gesellschaftlichen Anschlußmuster
3.1. NGOs aus etablierten Großorganisationen
3.1.1. Kirchliche Hilfswerke
3.1.2. Politische Stiftungen
3.2 NGOs aus neuen sozialen Bewegungen
3.3 Honoratioren-NGOs
3.4 Berufsspezifische Zusammenschlüsse zu NGOs
3.5 Dienstleistungs-NGOs und QUANGOs
4. Vorteile der NGO-Arbeit im Bereich Entwicklung
4.1. Gesellschaftliche Anbindung
4.2. Unabhängigkeit
4.3. Flexibilität
4.4. Motivation
5. Grenzen und Probleme der NGOs in der Entwicklungspolitik
5.1. Verhältnis zu „Süd-NGOs“/ Partnerorganisationen
5.2. Interessengebundenheit
5.3. Ressourcenbeschaffung
5.4. Professionalität
6. Über die Notwendigkeit weiterer Zusammenarbeit
6.1. Zusammenarbeit mit dem Staat
6.1.1. Formen der Zusammenarbeit
6.1.2. Förderung durch das BMZ
6.1.3 Gefahren der Zusammenarbeit mit dem Staat
6.2 Zusammenarbeit miteinander
6.2.1. Probleme gemeinschaftlicher Arbeit
6.2.2. VENRO
7. Fazit: Perspektiven der NGO-Entwicklungszusammenarbeit
1. Einleitung
Nicht erst seit Gestern wird in der politikwissenschaftlichen Diskussion von einer Legitimitätskrise der staatlichen Entwicklungspolitik gesprochen. Diese geht soweit, daß der staatlichen Entwicklungspolitik manchmal sogar jegliche Wirkung abge- sprochen wird. Aufgrund ihrer für den ausführenden Staat strategischen Orientie- rung gehe sie an den wirklichen Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung vorbei und sei zudem unzureichend geplant und schlecht durchgeführt. Es werden alter- native und wirkungsvollere Ansätze, neue Strategien, Methoden und Ziele gefor- dert. Andere bemängeln zudem das zu geringe Ausmaß der staatlichen Entwick- lungshilfe (ODA, official development assistance), das in Deutschland weit unter der Maßgabe des Development Assistance Committee (DAC) von 0,7% des Brut- tosozialproduktes liegt.1Außerdem wird die Beschränkung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf nur ausgewählte Länder, und das sind nicht immer die Ärmsten der Armen, kritisiert. (Vgl.: Karp, 1998: 78f)
Seit einigen Jahren werden nun im Zuge der Diskussion um eine Weltzivilgesell- schaft vor allem die Non-Governmental-Organizations (NGOs) als Alternativen der staatlichen und auch kommerziellen Zusammenarbeit genannt. Denn der als ent- wicklungsfördernd propagierte Welthandel scheint den Entwicklungsländern nur begrenzt zu Gute zu kommen, weist also erhebliche Defizite auf. Nachdem sie lange Zeit nicht wirklich ernst genommen wurden, sind sie heute zu den neuen Hoffnungsträgern der entwicklungspolitischen Szene avanciert. (Vgl.: Nuscheler, 1996: 498)
Diese Arbeit soll nun das breite Spektrum der NGOs untersuchen, um festzustellen, inwiefern Non-Governmental-Organizations tatsächlich eine Alternative für die Entwicklungzusammenarbeit sein können. Dabei wird nach einem Definitionsver- such zunächst eine Typologie nach gesellschaftlichem Anschlußmuster erstellt. Daraufhin werden Möglichkeiten und Grenzen der NGOs erläutert, um anschließend die Frage zu diskutieren, ob bestehende Probleme durch weitere Zusammenarbeit untereinander oder mit dem Staat gelöst werden können. Im Fazit sollen schließlich die Perspektiven der nicht-staatlichen Entwicklungszusammenarbeit vorgestellt werden.
2. Definitionsversuch von Non-Governmental-Organizations
2.1. Begriffliche Unklarheit
Non-Governmental-Organizations, Non-Profit-Organizations, Privat-Voluntary-Or- ganizations: dies sind nur einige der vielen Begriffe die das breite Spektrum von Organisationen, Gruppen und Zusammenschlüssen benennen, die in dieser Arbeit untersucht werden sollen. Diese Begriffe greifen jedoch nur meist nur einen Aspekt auf. So fassen Non-Governmental-Organizations ja formal auch Unternehmen, und bei Non-Profit-Organizations ist der Schwerpunkt zwar auf die Abgrenzung von marktwirtschaftlichen Organisationen gesetzt, aber die Grenze zu Regierungs- oder regierungsnahen Organisationen fällt schwer. Des Weiteren sagen die Begriffe Non- Profit-Organization und Non-Governmental-Organization zwar aus, was die gemeinten Organisationen nicht sind, eine positive Füllung der Begriffe ist jedoch nicht vorhanden. (Vgl.: Glagow, 1993: 307)
In dieser Arbeit wurde Non-Governmental-Organization als Begriff gewählt, da er sich zum einen in der Forschung etabliert hat, zum anderen auf die Abgrenzung zum Staat aber auch besonders Bezug genommen werden soll. Daher ist es aber nun als Basis notwendig, den hier verwendeten Begriff „Non-Governmental-Orga- nization“ mit Inhalt zu besetzen.
2.2. Definition
Non-Governmental-Organizations gelten als dritter Sektor zwischen Markt und Staat. Sie leisten gesellschaftliche Integration, indem Kollektivgüter produziert werden. Ihr Steuerungsmodus ist dabei die Solidarität, während Staat und Markt durch die Steuerungsmodi Hierarchie und Tausch definiert sind. (Vgl.: Ebd.: 309) Diese Solidarleistungen werden nun von der Gesellschaft erbracht. Dies geschieht entweder in Form finanzieller Zuwendungen, gemeint sind Spendengelder, personeller Zuwendungen, also (ehrenamtlicher) Mitarbeit, oder auch durch legitimatorische Zuwendungen, die die Gründungsidee und die ihr zugrunde liegenden Wertvorstellungen verteidigen. . (Vgl.: Ebd.: 305)
Non-Governmental-Organizations sind in fast allen denkbaren Bereichen tätig, z.B. auch in Umwelt und Entwicklung. (Vgl.: Ebd.: 304) Die Besonderheit der entwick- lungspolitisch tätigen NGOs besteht darin, daß sie nicht für ihre Mitglieder, sondern für eine andere Zielgruppe tätig werden, nämlich die Bevölkerung in den Entwicklungsländern. (Vgl.: Ebd.: 308)
Eine schlüssige Definitionsformel stammt von Manfred Glagow:
„NRO [i.e. Nicht-Regierungs-Organisationen] sind formalisierte Gebilde außerhalb von Markt und Staat, die ihre Ressourcen aus Solidaritätsbeiträgen der Gesellschaft auf der Basis von Freiwilligkeit erhalten und sie zur Bearbeitung von gesellschaftlichen Pro- blemlagen in Kollektivgüter umformen. Soweit das NRO des Nordens tun, handelt es sich bei dem Transfer um einen länderübergreifenden und transkulturellen Vorgang.“ (Ebd.: 311)
Eine aussagekräftige Selbstdefinition liefert VENRO, der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nicht-Regierungsorganisationen e.V. (cf. Kapitel 6.2.2.):
„Entwicklungspolitische NRO sind ein wichtiger Bestandteil der Zivilgesellschaft. Sie erheben Einspruch und mischen sich ein, setzen auf Dialog und Kooperation. In den NRO formieren sich Verantwortungsbewußtsein und Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, das in hohem Maße ehrenamtlich geleistet wird.“ (www.venro.de)
3. Typologie nach gesellschaftlichen Anschlußmuster
Aus der Vielfalt der Möglichkeiten, das breite Spektrum der Non-Governmental-Or- ganizations zu typologsieren, wurde hier die Typologie nach dem gesellschaftlichen Anschlußmuster gewählt. Diese Typologie ist besonders dazu geeignet, die spezifi- schen Handlungsspielräume der einzelnen Organisationen aufzuzeigen und leistet somit schon eine Struktur zur Beschreibung der NGOs. (Vgl.: Glagow, 1993: 312)
3.1. NGOs aus etablierten Großorganisationen
Unter diese Non-Governmental-Organizations fallen die kirchlichen Hilfswerke und die politischen Stiftungen. Diese Organisationen sind über ihre Mutterorganisation mit der Gesellschaft verknüpft. So können sie von deren Status und Prestige profitieren. Hinzu kommt die intensive finanzielle und auch politische Unterstützung, die von der Mutterorganisation gewährleistet wird.
Die kirchlichen Hilfswerke und politischen Stiftungen sind fest in der sozialen und politischen Arena der Interessengruppen in der pluralistischen Bundesrepublik ein- gebunden. Ihr politischer Einfluß ist dementsprechend hoch einzuschätzen. Jedoch können sich durch die Bindung an die Mutterorganisation Probleme erge- ben. Die Mutterorganisation kann nämlich auch erheblichen Einfluß auf die jewei- lige Organisation ausüben, und im Ernstfall sogar Sanktionen erheben, also ihre Unterstützung zurückziehen. Dies ist bei den Kirchen ebenso denkbar, wie bei den politischen Stiftungen, die durch parteipolitische Zwänge eingeschränkt werden können. (Vgl.: Glagow, 1993: 312)
Nun sollen die kirchlichen Hilfswerke und die politischen Stiftungen näher vorgestellt werden.
3.1.1. Kirchliche Hilfswerke
Die kirchlichen Hilfswerke begründen sich vor allem im christlichen Gebot der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe. Diese wohl zu einfache Vorstellung für kon- zeptionelle Arbeit in der Entwicklungspolitik wurde aber im Laufe der langjährigen Erfahrung durchaus modifiziert. Dieser interne Lernprozeß hat zu wirklichen ent- wicklungspolitischen Konzepten geführt, die sich unter dem Schlagwort „Hilfe zur Selbsthilfe“ zusammenfassen lassen. Die Kirchen sind die größten Hilfswerke, die über große bürokratische Apparate verfügen. Außerdem sind ihre Mitarbeiter ähn- lich professionell wie die des BMZ. (Vgl.: Nuscheler, 1996: 306f)
In den Entwicklungsländern können die kirchlichen Hilfswerke oft über dort ansäs- sige Kirchen örtliche Strukturen nutzen und bauen aus demselben Grunde oft eine erhebliche Nähe zu der betroffenen Bevölkerung auf. Über ihre ebenfalls starke Anbindung an die Gesellschaft in Deutschland erhalten die kirchlichen Hilfswerke bedeutende, natürlich auch finanzielle Unterstützung. So können sie wohl um 1 Milliarde DM pro Jahr an Eigenmitteln stellen. Hinzu kommen im erheblichen Maße die Fördersummen des BMZ (cf. Kapitel 6.1.2.). (Vgl.: BMZ, 2000: 141)
Verschiedene Werke der evangelischen und katholischen Kirche teilen sich dabei die Arbeitsfelder. So fühlen sich die Caritas und die Diakonie vor allem für die hu- manitäre Nothilfe zuständig, während Adveniat und Missio mehr Missions- und Pa- storalshilfe leisten.2Miserior und Brot für die Welt stehen für armutsorientierte Ent- wicklungshilfe, andere, wie die Kindernothilfe bearbeiten spezifische Bereiche. (Vgl.: Nuscheler: 1996: 306)
Wie schon erwähnt kann die Mutterorganisation teilweise zum Problem werden. Besonders die katholischen Hilfswerke gerieten mit den konservativen Bischöfen in Konflikt. Die Ergebnisse ihres Lernprozesses wurden, wohl auch linksverdächtig, heftig kritisiert, und es bedurfte eines erheblichen Durchhaltevermögens, sie doch noch durchzusetzen. (Vgl.: Ebd.: 307)
Trotz der Anerkennung an Professionalität und Umfang der geleisteten Hilfe kommt Franz Nuscheler im „Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik“ zu folgendem kritischem Urteil:
„Die staatsnahen Hierarchien der beiden Kirchen bremsen die verändernde Kraft, die die Kirchen als einflußreiche Interessengruppen in der Entwicklungspolitik ent- wickeln könnten. [...] Sie pflegen einen Schmusekurs, um die Subsidien und Privi- legien nicht zu gefährden, die ihnen aus dem staatlichen Füllhorn reichlich zuflie- ßen. Vor frommen Reden brauchen sich aber die politischen Entscheidungsträger nicht zu fürchten.“ (Ebd.: 509)
3.1.2. Politische Stiftungen
Jede große Partei hat ihre formell unabhängige Stiftung. So rechnet man die Kon- rad-Adenauer-Stiftung (KAS) zur CDU, die Hans-Seidel-Stiftung (HSS) zur CSU, die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zur SPD und die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) zur FDP. Der grünennahe Stiftungsverband Regenbogen heißt jetzt Heinrich-Böll- Stiftung (HBS) und die am 1. Januar 2000 gegründete Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) steht der PDS nahe. (Vgl.: Nuscheler, 1996: 500; BMZ, 2000: 141)
„Die Stiftungen betonen grundlegende Übereinstimmungen in den (freilich sehr vagen) entwicklungspolitischen Zielsetzungen. Sie konkurrieren nicht miteinander, kooperieren auch nicht in gemeinsamen Projekten, stehen aber in informellem Erfahrungsaustausch in Bonn und an den Einsatzorten ihrer Auslandsmitarbeiter. Ihre Tätigkeit fällt in den Konsensbereich der Parteien in der BRD, der durch Wahlen und Regierungswechsel nicht tangiert wird.“ (Nohlen, 1998: 637)
Die politischen Stiftungen erhielten im Jahr 1999 302,6 Millionen DM für Vorhaben in Entwicklungsländern. 230 Experten (davon 94 von der Friedrich-Ebert-Stiftung) waren im gleichen Jahr weltweit tätig. (Vgl.: BMZ, 2000: 142)
Die Stiftungen erhalten in erheblichem Maße Förderung durch das BMZ und „ihre“ Parteien. Mit natürlich unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Gewichtungen arbeiten sie dennoch in ähnlichen Bereichen. Den politischen Stiftungen geht es vornehmlich um die Festigung demokratischer Strukturen in den Entwicklungs- ländern. Die Partizipation der Bevölkerung am politischen Entscheidungsprozess soll gefördert werden. Die Förderung wirtschaftlicher Eigenständigkeit, eben nicht nur der Länder selbst, sondern gerade auch der Bevölkerung ist eine weitere Aufgabe, die sich die Stiftungen gesetzt haben. Schwerpunkte der Förderung können besonders auch die Stärkung von Gewerkschaften, Parteien, freier Medien und ge- sellschaftspolitischer Erwachsenenbildung sein. (Vgl.: Ebd.)
3.2 NGOs aus neuen sozialen Bewegungen
Zu dieser Gruppe gehören Entwicklungshilfeorganisationen wie die Deutsche Wel- thungerhilfe, terre des hommes, aber auch zahlreiche kleine bis kleinste Dritte- Welt-Gruppen. Sie formierten sich vor allem Ende der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre, viele im Gefolge der Studentenbewegungen und auch als Reaktion auf den Vietnamkrieg. Sie sind gesellschaftlich eher randständig angesiedelt, was der Aquirierung von Spendengeldern, dem Unterstützungspotential natürlich Gren- zen setzt. Diese Non-Governmental-Organizations sind gewöhnlich durch eine große Arbeitsintensität gekennzeichnet. Des Weiteren handelt es sich bei den Mit- arbeitern meist um hochmotivierte, idealistische Personen, die sogar meist ehren- amtlich oder nur gegen ein geringes Gehalt tätig sind. Aufgrund der relativ geringen Größe der meisten dieser Organisation ist oft eine starke Homogenität der Mitglieder festzustellen, die interne Entscheidungsprozesse sicherlich erleichtert. Jedoch sind diese meist nur gering bürokratisiert, die Etablierungsschwäche kann durch die genannten Vorteile kaum ausgeglichen werden. (Vgl.: Glagow, 1993: 312)
3.3 Honoratioren-NGOs
Honaratioren-NGOs sind von einzelnen Menschen initiiert. Ein bekanntes Beispiel ist „Menschen für Menschen“, eine Organisation, die von Karlheinz Böhm gegründet wurde. (Vgl: Nuscheler, 1996: 500) Diese Non-Governmental-Organizations sind allerdings vom Wirken und Schaffen einzelner Personen, eben einzelner Ho- noratioren abhängig. Hier herrscht dementsprechend eine hohe Folgebereitschaft zu den Leitbildern vor: ein Vorteil bezüglich interner Entscheidungsfindung. Was aber beim Abtreten der Honoratioren passiert, ist unklar. Ohne Leitbilder erweisen sich die eher kleinen Organisationen nämlich als äußerst instabil. (Vgl.: Glagow, 1993: 312)
3.4 Berufsspezifische Zusammenschlüsse zu NGOs
Eines der bekanntesten Beispiele für berufsspezifische Zusammenschlüsse sind sicherlich die „Ärzte ohne Grenzen“. Hier sind besonders das Organisationsziel und die fachliche Kompetenz und Qualität geklärt. Jedoch finden sich in diesen Organi- sationen Personen mit solch unterschiedlichen politischen Ziel- und Strategievor- stellungen zusammen, daß es intern zu erheblichen Konflikten kommen kann.
Letztendlich bleibt daher der Integrationsmechanismus disziplinär und sehr be- grenzt. (Vgl.: Ebd.: 313)
3.5 Dienstleistungs-NGOs und QUANGOs
Diese Organisationen sind letztendlich nicht zu vernachlässigen. Die Dienstlei- stungs-NGOs führen die Projekte und Aufgaben lediglich für andere aus. QUANGOs (Quasi-Non-Governmental-Organizations) sind nicht wirklich von der Regierung abzugrenzen, wenn sie fast ausschließlich durch diese finanziert werden. Sie bewegen sich in den Grauzonen zu Markt und Staat, können jedoch auf eine hohe fachliche Kompetenz und Spezialisierung verweisen. In diesem Sinne lassen sich die Durchführungsorganisationen des BMZ wie die Gesellschaft für technische Zu- sammenarbeit (GTZ) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beiden Katego- rien zuordnen. Sie sind insofern von den anderen NGOs zu unterscheiden, als sie nicht die gleiche Unabhängigkeit, die gleiche Motivation und gesellschaftliche An- bindung besitzen. (Vgl.: Ebd.)
Diese Eigenschaften machen nämlich das Potential der meisten NGOs aus, die im nächsten Kapitel diskutiert werden sollen.
4. Vorteile der NGO-Arbeit im Bereich Entwicklung
Vor allem aufgrund der Legitimationskrise der staatlichen Entwicklungspolitik können die Non-Governmental-Organizations auf ein immer höheres Prestige verweisen. Da Staat und Markt den Entwicklungsländern nicht helfen zu können scheinen, stellt sich die Frage, ob nicht die Zivilgesellschaft, die auf den Prinzipien Freiwilligkeit und Solidarität beruht, in Form von NGOs die staatliche Entwicklungspolitik ergänzen oder gar ersetzen können. (Vgl.: Nuscheler, 1993: 498)
„Die Mobilisierung von Selbsthilfepotential, Solidarität und kollektiven Aktionen eröffnet einen politischen Spielraum in der Interessenauseinandersetzung um vorhandene Ressourcen, in der Durchsetzung von Gerechtigkeit und vorhandenen Gesetzen, im Kampf um gerechtere Löhne oder Land. Diese Auseinandersetzung findet dezentral und auf lokaler Ebene statt, in den Dörfern, dort wo die Masse der Menschen lebt...“ (Jessen/Störmer, 1989: 63f)
Nun weisen NGOs tatsächlich eine Reihe von Vorteilen auf, die sie durchaus für die spezifischen Anforderungen der Entwicklungszusammenarbeit qualifizieren.
4.1. Gesellschaftliche Anbindung
Dies ist der entscheidende Faktor, denn Non-Governmental-Organizations kommen aus der Gesellschaft selbst.
„NRO werden von vielen entwicklungspolitischen Fachleuten als das Herz der Zivil- gesellschaft angesehen, von einigen gar als fünfte Säule der Demokratie. Dies gilt auch und besonders für die NRO der Entwicklungszusammenarbeit.“ (BMZ, 2000: 138)
Sie sind durch ihre auch wechselnden Mitglieder direkt an die Gesellschaft gebun- den, was ihnen entscheidende Legitimitätsvorteile verschafft. Sie sind also vom Prinzip her basisorientiert und an Partizipation interessiert. So können sie vor allem Projekte zur Selbsthilfe besonders gut organisieren und vor allem auch im Geber- land für Mobilisierung von Ressourcen, Bewußtwerdung der Problematik und Legi- timation der Entwicklungshilfe insgesamt sorgen. (Vgl.: Nuscheler, 1996: 503)
4.2. Unabhängigkeit
Die Entwicklungshilfe des BMZ ist nicht nur finanzpolitischen, sondern auch außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik unterworfen. Eine solche Abhängigkeit ist bei den NGOs nicht festzustellen.3Sie sind nämlich unabhängig von diesen Interessen und können somit ausgleichend zur staatlichen Entwicklungshilfe tätig sein. Sie können in Staaten, die aus finanziellen oder auch politischen Gründen vom BMZ nicht gefördert werden, vor allem humanitäre Nothilfe leisten. (Vgl.: Karp, 1998: 113)
Während des Ost-West-Konflikts wurden zum Beispiel die geförderten Staaten nach der Orientierung am „eigenen“ Block ausgewählt, unabhängig davon, ob es sich dabei um brutale Diktaturen handelte4, die die Hilfe nicht an die Bevölkerung weitergaben. Das Ende des Konfliktes machte diese Art der Selektion natürlich überflüssig.5(Vgl: Nuscheler, 1996: 388)
Der ergänzende Charakter der Arbeit von NGOs bleibt aber wichtig. Werden nun diktatorische und autoritäre Staaten nicht unterstützt, ginge eine gänzliche Absage der Entwicklungshilfe auf Kosten der ärmsten Teile der Bevölkerung. Die Entwick- lungsarbeit der NGOs, die allgemein eher armutsorientiert ist, kann so die Strategie des BMZ unterstützen. (Vgl.: Glagow, 1993: 305)
4.3. Flexibilität
Der Vorteil der Flexibilität gilt vor allem für die hohe Anzahl kleiner NGOs, die weniger bürokratisiert und weniger formalisiert sind. Zwar verlangsamen sich in den großen6NGOs die Verfahren durch die Bürokratisierung, die bei der steigenden Formalisierung der Organisation auftritt, eine ähnlich starke Bürokratisierung wie bei staatlichen Organisationen ist jedoch nicht festzustellen.
Diese Flexibilität macht Non-Governmental-Organizations mobiler. Sie können auf Veränderungen, wie sie nicht nur in den Entwicklungsländern sondern auch in der Diskussion über Theorie und Praxis ständig stattfinden, wesentlich schneller einge- hen. Sie können sich den vorherrschenden Bedingungen besser anpassen, da sie nicht durch formalisierte Verfahren systemischen Zwängen unterworfen sind. (Vgl.: Karp, 1998: 102f)
4.4. Motivation
Da sich Non-Governmental-Organizations ja besonders durch ihren moralischen Anspruch definieren und auch auszeichnen, ist bei ihnen im Allgemeinen eine hö- here Motivation festzustellen, als bei staatlichen Trägern der Entwicklungzusam- menarbeit. Aufgrund ihrer hohen Motivation arbeiten die Mitarbeiter oft ehrenamt- lich oder unterbezahlt, opfern sich gar für den Motivationszweck auf. Außerdem weisen die Mitarbeiter vor allem auch durch starkes persönliches Engagement, durch persönliche Anteilnahme hohe soziale Kompetenzen auf, die positiv in die Entwicklungszusammenarbeit einfließen können. Ob diese Motivation allerdings Fachkompetenz und Professionalität ersetzen kann, ist eher zweifelhaft. (cf. Kapitel 5.4.) (Vgl.: Glagow, 1993: 319)
5. Grenzen und Probleme der NGOs in der Entwicklungspolitik
Nach der Vorstellung der genannten Stärken der Non-Governmental-Organizations, ist sicherlich die Frage zu stellen, warum nicht die Entwicklungszusammenarbeit ganz auf die NGOs übertragen wird. Der Staat könnte nur noch als Förderer der NGOs fungieren, so sein Geld sinnvoller nutzen, auch zum Beispiel durch Ein- sparung von Personal. (Vgl.: Ebd.: 321)
Jedoch stellen die besagten Vorteile nur eine sehr einseitige Sicht der Non-Go- vernmental-Organizations dar, aber ihre spezifischen Charakteristika stellen sie vor einige Problemstellungen, die das positive Bild der NGOs relativieren.
So stellte Manfred Glagow klar: „NRO sind anders aber keineswegs besser! Das sollte man bei der Frage nach den Potentialen von NRO als Alternative zu den staatlichen und marktorientierten Akteuren berücksichtigen.“ (Ebd.: 323)
Vier dieser Problemstellungen sollen nun näher erörtert werden.
5.1. Verhältnis zu „Süd-NGOs“/ Partnerorganisationen
Non-Governmental-Organizations entstammen der Gesellschaft gehen aus dieser hervor. Doch können und dürfen NGOs aus Industrieländern die Aufgaben der Zi- vilgesellschaft in Entwicklungsländern übernehmen und dermaßen beeinflussen? Ob dieser Transfer über kulturelle Grenzen hinweg immer möglich oder auch ge- wollt ist bleibt fraglich.
Im Hinblick auf die Gesellschaft der Entwicklungsländer stellt sich aber heute noch eine andere Problematik. Denn auch in der sogenannten „Dritten Welt“ bringt die Zivilgesellschaft mehr und mehr Non-Governmental-Organizations hervor. Es ist vorstellbar und durchaus schlüssig, daß diese für die Entwicklungshilfe, die dann ja zur Selbsthilfe wird, besser geeignet sind als die sogenannten „Nord-NGOs“. Jedoch sind die NGOs in Entwicklungsländern in einem noch erheblicheren Maße der Finanzproblematik ausgesetzt als die deutschen NGOs (cf. Kapitel 5.3.), und daher auf finanzielle Unterstützung durch letztere angewiesen. (Vgl.: Glagow, 1993: 315, 322)
Das Verhältnis dieser beiden Partner ist nun aber kritisch zu beleuchten.
Während des NGO-Booms war eine wahre Zugriffsjagd auf die „Süd-NGOs“ zu beobachten, die zum Teil auch künstlich geschaffen wurden. Diese sind finanziell natürlich stark von den Non-Governmental-Organizations der Geberländer abhängig. Und eben das ist der Kritikpunkt, denn zeichnen sich NGOs nicht gerade durch ihre Unabhängigkeit aus, basisorientiert Selbsthilfe zu organisieren?
„Es zeichnet sich das absurde Bild ab, daß die Süd-NRO aufgrund ihrer eigenen Identität für prädestiniert gehalten werden, Entwicklungsbemühungen voranzutreiben, und man alle Anstrengungen, deren Entwicklungsexperten der Geberländer fähig sind, dafür einsetzt, daß die Süd-NRO nun genau diese Eigenheiten durch umfassende ‚Strukturhilfe‘ verlieren.“ (Ebd.: 316)
Dennoch ist das Verhalten der Nord-NGOs nachvollziehbar. Zum einen müssen sie ja die Verwendung ihrer Gelder nachhalten. Dies gilt besonders für Gelder aus staatlichen Zuschüssen (cf. Kapitel 6.1.2.1.), aber auch für eigene Gelder. Um die Spendenbereitschaft aufrecht zu erhalten, muß auch für die Förderer der Nachweis für die Verwendung der Gelder erbracht werden.
5.2. Interessengebundenheit
Denn, auch wenn die Non-Governmental-Organizations von außenwirtschaftlichen und außenpolitischen Interessensstrukturen, wie sie ja die staatliche Entwicklungspolitik betreffen, relativ unabhängig sind, gänzlichen Handlungsspielraum, völlige Unabhängigkeit haben sie nicht.
Sie sind nämlich durch die Abhängigkeit von der finanziellen, materiellen und legitimatorischen Unterstützung durch ihre Förderer sehr wohl auch an diese und deren Interessen gebunden. (Vgl.: Ebd.: 322)
Des Weiteren sind NGOs aus etablierten Großorganisationen wie die kirchlichen Hilfswerke und die politischen Stiftungen an die Interessen ihrer Mutterorganisatio- nen wenn nicht gebunden, so doch von diesen abhängig. Denn von ihnen erhalten sie enorme finanzielle Zuwendungen und ihren festen Platz in der sozialen und po- litischen Arena der pluralistischen Gesellschafts- und Entscheidungsstruktur der Interessengruppen in der Bundesrepublik Deutschland. (Vgl.: Ebd.: 312)
5.3. Ressourcenbeschaffung
Eng mit dem oben genannten Problem der Interessengebundenheit ist die Finan- zierungsproblematik der Non-Governmental-Organizations verbunden. Zwar ist die Spendenbereitschaft der deutschen Bevölkerung im Vergleich relativ hoch7, aber der Druck Spender zu halten und auch neue zu gewinnen ist groß. Dabei ist die schwierige Balance zwischen den Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und der Investitionen in Projekte, ja den Organisationszweck zu halten. Bringt die Öf- fentlichkeitsarbeit ihre Ausgaben zumindest wieder ein? In diesem Zusammenhang stehen auch Marktforschungsprojekte für die sogenannten Spendenprofile, da bei ihnen, wie auch bei der Öffentlichkeitsarbeit der Nutzen ja schwer genau defi- nierbar, genau bezifferbar ist. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß sich übertriebene Sparsamkeit in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit trotz legitimatorischer Probleme negativ auswirkt. (Vgl.: Ebd.: 318)
5.4. Professionalität
Der Vorwurf übertriebener Sparsamkeit kann auch in Bezug auf das Personal er- hoben werden, denn letztendlich trägt Unterbezahlung wohl kaum zur Motivation bei. Und trotz des hohen Stellenwertes ehrenamtlicher Arbeitskraft im NGO-Sektor, sind gerade im Bereich Entwicklungszusammenarbeit Fachkräfte unentbehrlich. Und es ist mehr als fraglich, ob Fachkräfte dauerhaft unterbezahlt anwerbbar sind. Engagement kann Sachkunde eben doch nur begrenzt ersetzen. Aus der Not eine Tugend zu machen, und mehr auf Partner im Süden zu setzen, kann besonders bei finanziellen Fragen risikoreich sein. (Vgl.: Nuscheler, 1996: 502)
„Der [...] wahrscheinlich größere Teil der Dritte Welt-Bewegten ist angezogen von Exotik, von Revolutionsromantik, von scheinbar einfachen Lösungen für scheinbar einfache Probleme, arbeitet für kurze Zeit in diesem Feld und verläßt das Thema wieder, wenn die vorgängigen Vorstellungen nicht bestätigt oder gar enttäuscht werden.“ (Bräuer, 1994: 37)
Oft fehlt es den Mitarbeitern der Non-Governmental-Organizations an naturwissenschaftlichem und technischem Know-how, um den wirklichen Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer zu entsprechen. Guter Wille allein ist nicht ausreichend, wie die Geschichte der Entwicklungspolitik zur Genüge gezeigt hat. Die Kritik mangelnder Professionalität kann jedoch nicht unbegrenzt erhoben werden, denn die kirchlichen Hilfswerke oder auch die Deutsche Welthungerhilfe, setzen durchaus Fachkräfte ein. Daß sie diese auch angemessen bezahlen können, liegt sicherlich nicht zuletzt an der Größe und dem finanziellen Potential der genannten Organisationen. (Vgl.: Glagow, 1993: 322)
6. Über die Notwendigkeit weiterer Zusammenarbeit
Das vorherige Kapitel hat nun ein vielfältiges Bild der entwicklungspolitisch tätigen Non-Governmental-Organizations gezeigt. Zum einen weisen sie durchaus Vorteile gegenüber der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit auf, zum anderen sind aber auch essentielle Schwachstellen feststellbar. Dabei sind die NGOs unterei- nander wiederum stark zu differenzieren, wobei für die großen NGOs einerseits be- stimmte Vorteile nicht gelten, wie zum Beispiel die Flexibilität, sie dafür aber auch weniger mit Problemstellungen wie der mangelnden Professionalität zu kämpfen haben. (Vgl.: Nuscheler, 1996: 305)
Daher stellt sich einerseits die Frage nach einer Zusammenarbeit mit dem Staat, anderseits aber auch nach einer Zusammenarbeit untereinander, um die jeweils spezifischen Probleme zu minimieren und Komplementaritätseffekte zu nutzen.
6.1. Zusammenarbeit mit dem Staat
Auch der Staat, genauer das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung trägt der Bedeutung der Non-Governmental-Organizations in der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung.
„Der Bedeutungszuwachs der national die international agierenden NRO stammt aus ihrem Image von Sachkompetenz, Flexibilität, hoher Motivation und selbstlo- sem Idealismus mit dem Ergebnis hoher Akzeptanz bei Medien und Bevölkerung. [...] Die Bundesregierung begrüßt deshalb die bisher erfolgreiche Kooperation und den konstruktiven Dialog zwischen den staatlichen und privaten Trägern der Ent- wicklungszusammenarbeit und anerkennt den gesellschaftlichen und politischen Beitrag der NRO zur Unterstützung auch ihrer entwicklungspolitischen Ziele.“ (BMZ, 2000: 139)
6.1.1. Formen der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit schlägt sich nicht nur in beachtlichen finanziellen Zuschüssen (cf. Kapitel 6.1.2.) nieder, sondern vor allem auch immer mehr in Dialog und Infor- mationsaustausch. Man will -zumindest auf dem Papier- voneinander profitieren. Es ist denkbar, daß Non-Governmental-Organizations gerade deshalb unterstützt werden, weil sie von außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Imperativen rela- tiv unabhängig sind, und daher staatliche Entwicklungshilfe ergänzen können. Dies gilt natürlich für Staaten, in denen staatliche Entwicklungszusammenarbeit aus politischen Gründen nicht durchgeführt wird, besonders weil sich NGOs ja gerade auch basisnah an den Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerung orientieren wollen. Dieser ergänzende und komplementäre Effekt zeigt sich vor allem auch an der Armutsorientierung vieler NGOs und gewinnt bei der Konzentration der deut- schen Entwicklungspolitik auf weniger Schwerpunktländer an immer mehr Bedeu- tung. (Vgl.: Ebd.: 140f)
6.1.2. Förderung durch das BMZ
„Zu den Nichtregierungsorganisationen, deren eigene Entwicklungsarbeit die Bun- desregierung seit rund 40 Jahren fördert, gehören insbesondere die Kirchen, politi- schen Stiftungen und andere fachlich, personell und finanziell leistungsfähige Trä- ger mit langjährigen Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit.“ (BMZ, 2000: 140) Die Förderung durch BMZ-Mittel betrug in den Jahren 1962 - 1999 circa 14,6 Mrd.
DM. Im Jahr 1999 wurden etwa 10% der Gesamtausgaben8an entwicklungspolitisch tätige Non-Governmental-Organizations gezahlt, das entspricht einer Summe von 776 Millionen DM (1998: 761 Mio. DM). (Vgl.: Ebd.)
6.1.2.1 Bedingungen für eine Förderung
Um eine Förderung des BMZ für Programme und Projekte in Anspruch nehmen zu können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Erstens muß die die durchführende Organisation den steuerlichen Status der Gemeinnützigkeit innehaben und ihr Sitz muß in Deutschland sein. Zweitens muß Erfahrung in der Zusammenarbeit mit leistungsfähigen, nicht gewinnorientierten Partnerorganisationen in Entwicklungsländern und fachliche und administrative Kompetenz nachgewiesen werden. Schließlich muß das fragliche Projekt die wirtschaftliche und/ oder soziale Lage armer Bevölkerungsschichten unmittelbar verbessern oder zur Beachtung der Menschenrechte beitragen. (Vgl.: Ebd.: 143)
Im Einzelnen wurden die NGO-Gruppen im Jahr 2000 so gefördert: Die kirchlichen Hilfswerke erhielten etwa 275 Millionen DM, die politischen Stiftungen 302,6 Mio. DM und andere private Träger 84,2 Mio. DM. (Vgl.: Ebd.: 141f) Die Förderkriterien und die genannten Fördersummen lassen darauf schließen, daß eher etablierte Non-Governmental-Organizations Förderung erhalten, deren Entwicklungszusammenarbeit vielleicht ähnlich bürokratisiert ist, wie die des Staa- tes, bei denen die Professionalität allerdings auch höher einzuschätzen ist. Die Be- ratungs- und Hilfsstelle bengo, die im nächsten Abschnitt behandelt wird, soll nun auch gerade kleineren NGOs die Möglichkeit verschaffen, BMZ-Fördermittel zu be- kommen.
6.1.2.2 bengo als Beratungs- und Hilfsstelle
Seit 1988 arbeitet bengo, die Beratungsstelle für private Träger in der Entwick- lungszusammenarbeit, im Auftrag des BMZ. bengo hat die Aufgabe deutsche pri- vate Träger und Non-Governmental-Organizations bei der Antragstellung um BMZ- Fördermittel zu beraten und zu unterstützen. Auch engagierte Gruppen und Initiati- ven soll so der Zugang zu öffentlichen Fördermitteln erleichtert werden. (Vgl.: Ebd.: 144)
Das BMZ selbst beschreibt die Tätigkeit des bengo folgendermaßen:
„Die Beratungsstelle, die sich in der Trägerschaft des Paritätischen Wohlfahrtsver- bandes befindet, gibt den NRO Hilfestellung bei der Beantragung öffentlicher Mittel für Projekte in Entwicklungsländern sowie bei der Durchführung und späteren Ab- rechnung. bengo unterstützt insbesondere kleinere und ehrenamtlich tätige NRO bei der Erarbeitung des fach- und sachspezifischen Wissens für den Umgang mit verfahrenstechnischen, administrativen und sonstigen durchführungsrechtlichen Fragen.“ (Ebd.)
Außerdem hat bengo die Aufgabe, die gestellten Förderanträge für eine Förderung aus dem BMZ-Titel 686 06 (Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben privater deutscher Träger in Entwicklungsländern) auf ihre Richtigkeit und die Erfüllung der formalen Förderkriterien hin zu überprüfen. Seit dem Herbst 1999 leistet bengo auch Hilfestellung zur Erlangung von Fördermitteln der Europäischen Kommission, indem Seminare zur Antragstellung, Durchführung und Berichterstattung von EU- Projekten veranstaltet werden. Schließlich informiert bengo auch NGOs aus Ent- wicklungsländern über die Struktur der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. (Vgl.: Ebd.)
6.1.3 Gefahren der Zusammenarbeit mit dem Staat
Nicht alle Non-Governmental-Organizations sind bereit, staatliche Fördergelder an- zunehmen, sie vertreten den Grundsatz der Selbstbeschränkung. Aufgrund der la- tenten Finanznot der NGOs scheint dieses Verhalten zunächst erstaunlich, so bietet staatliche Unterstützung doch eine Erweiterung des Finanzrahmens und eröffnet neue Handlungschancen. Bei näherer Betrachtung erschließen sich jedoch die Gründe dieses Verhaltens. Denn der staatliche Geber kann mit seiner Förderpolitik ja durchaus einzelne Organisationen so fördern, daß diese ihre Organisation er- weitern und sich in Abhängigkeit des Staates begeben, da sie das erreichte Orga- nisationsniveau aufrechterhalten wollen. Die Annahme staatlicher Gelder stellt also eine Gefahr für die Autonomie und Unabhängigkeit der NGOs dar. Und diese ist ja gerade eine Besonderheit, ein Grundprinzip, das die Effektivität und Leistungsfä- higkeit der Organisationen ausmacht. Es ist aber anzunehmen, daß solange sich die NGOs dieser Gefahr bewußt sind, die Ablehnung von Zuschüssen eher eine Beschneidung der eigenen Möglichkeiten bedeutet. (Vgl.: Glagow, 1993: 320f)
6.2 Zusammenarbeit miteinander
Die Vielfalt der Non-Governmental-Organizations sollte eher ein Vorteil sein. Denn so können sie sich ergänzen und Probleme ausgleichen. Dies ist aber nur mit Dia- log und Absprachen untereinander, also durch eine starke Zusammenarbeit mög- lich. Und das ist auch die Grundsatzidee einer Zusammenarbeit der entwicklungs- politischen NGOs untereinander, um so unter einem Dach stärker und effizienter zu arbeiten. Außerdem könnte so vielleicht eine wirksamere Entwicklungslobby ge- schaffen werden, die effektiv Druck auf die Regierung ausübt. (Vgl.: Nuscheler, 1996: 505)
6.2.1. Probleme gemeinschaftlicher Arbeit
Die Zusammenarbeit gestaltet sich jedoch schwieriger als angenommen. So ist die Vielfalt der Non-Governmental-Organizations zwar ein Vorteil, bringt aber auch starke ideologische und organisatorische Differenzen mit sich. Das Spektrum denkbarer Differenzen reicht von kleinen basisdemokratischen Dritte-Welt-Gruppen bis zu den größten NGOs mit starken auch hierarchisch geprägten bürokratischen Apparaten, von kirchlichen Hilfswerken zu Organisationen aus neuen sozialen Be- wegungen etc.
Das größere Problem ist aber wohl auch die erhebliche Konkurrenz untereinander. Die Konkurrenz um Zuschüsse und vor allem die Konkurrenz um Spendengelder auf dem zwar großen aber begrenzten Spendenmarkt. (Vgl.: Glagow, 1993: 314)
6.2.2. VENRO
„VENRO [Verband Entwicklungspolitik deutscher Nicht-Regierungsorganisationen e. V.] ist ein freiwilliger Zusammenschluss von rund 100 deutschen Nicht-Regie- rungsorganisationen (NRO), von denen die meisten bundesweit tätig sind. Lokale Initiativen werden in dem Verband durch die NRO-Landesnetzwerke repräsentiert, die ebenfalls VENRO-Mitglieder sind und etwa 2000 große, mittlere und kleine NRO vertreten.“ (http://www.venro.de)
Die Mitglieder vertreten eine Vielfalt von privaten und kirchlichen Non-Governmen- tal-Organizations, die in der Nothilfe, sowie der entwicklungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Ein Grundprinzip des Dachverbandes, der im Dezember 1995 gegründet wurde und seinen Sitz in Bonn hat, ist die Autonomie der Mitgliedsorganisationen. (Vgl.: Nohlen, 1998: 791)
VENRO tritt für mehr Gerechtigkeit in der „Einen Welt“ ein, will die Armut bekämp- fen, die Menschenrechte verwirklichen, und die natürlichen Lebensgrundlagen be- wahren helfen. Dabei bezieht VENRO sich auf das Ziel der Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21, das „den Ausgleich zwischen den Reichen und den Armen der Welt, zwischen den Geschlechtern und den Generationen anstrebt.“
(http://www.venro.de)
Seine Hauptaufgaben sieht VENRO darin, den Stellenwert der Entwicklungspolitik zu fördern, auf eine alle Politikbereiche einbeziehende, kohärente Entwicklungspolitik hinzuwirken, den Dialog zwischen staatlichen und privaten Trägern der Entwicklungszusammenarbeit zu stärken und den gesellschaftlichen und politischen Beitrag der entwicklungspolitischen NRO zu intensivieren. (Vgl.: BMZ, 2000: 144) Diese Ziele will VENRO durch eine Bündelung der Erfahrungen der Non-Govern- mental-Organizations, durch eine Intensivierung des Dialogs untereinander, durch einen Austausch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, durch gemeinsame Aktionen, Positionspapiere, Studientage etc. erreichen.
Im „VENRO Kodex“ verpflichten sich die Mitgliedsorganisationen unter anderem auf Prinzipien wie Toleranz, Wahrheit, Transparenz, die Effizienz und Redlichkeit der Mittelbeschaffung und Professionalität. (Vgl.: http://www.venro.de)
7. Fazit: Perspektiven der NGO-Entwicklungszusammenarbeit
Trotz aller Vorteile der Non-Governmental-Organizations, die sie ja zum Beispiel bei kleinräumigen Selbsthilfeprojekten geeigneter machen, als staatliche Vorhaben (Vgl.: Nuscheler, 1996: 512), ist „NGO comperative advantage [...] more a myth than a reality.“ (Vgl.: Marcussen, 1996: 279)
Ihre spezifischen Problemstellungen sind der Grund, daß sie staatliche Entwicklungshilfe nicht ersetzen, aber doch ergänzen und korrigieren können. So gilt es die Zusammenarbeit mit dem Staat zu intensivieren und voneinander zu profitieren. In diesm Sinne könnten die NGOs ihr Druckpotential aber noch erheblich verbessern, indem sie vor allem untereinander kompromißfähiger werden und Bündnisse mit anderen gesellschaftlichen Gruppen suchen. (Vgl.: Glagow, 1993: 314) Die Entwicklung von VENRO ist hier besonders zu beachten.
Abschließend ist die Frage nach der spezifischen Stellung der NGOs in Industrieländern zu stellen.
„Wenn NGO die Entwicklungspolitik der eigenen Staaten verändern wollen, müssen sie eine doppelte Aufgabe übernehmen: die nach außen gerichtete Projektarbeit, für die sie Spenden einwerben, und eine politische ‚Inlandsarbeit‘: Es geht [...] nicht nur darum, die Wunden derer zu verbinden, die unter die Räuber gefallen sind, sondern auch darum, die Strukturen der Räuberei aufzudecken und zu verändern. Sie müssen sich zunehmend mit der Frage beschäftigen: Wer entwickelt den Norden?“ (Nuscheler, 1996: 512)
Literaturliste
- BMZ: Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2000, Berlin, 2000.
- Bräuer R., 1994: Zwischen Provinzialität und Globalismus, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, 3/94, 63-75.
- Glagow, Manfred: Die Nicht-Regierungsorganisationen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, in: Nohlen, Dieter; Nuscheler,Franz (Hrsg.): Handbuch Dritte Welt, Band 1, 3. Aufl., Bonn, 304-326.
- Jessen, B./Störmer. M., 1989: Entwicklung oder Staat, in: Jahrbuch Dritte Welt 1990, München, 51-64.
- Karp, Markus: Leistungsfähigkeit und Politikgestaltung von Nicht-Regierungsor- ganisationen im Rahmen der internationalen Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit: ein polit-ökonomische Analyse anhand ausgewählter Organisationen, Frankfürt am Main, 1998.
- Marcussen, Henrik S.: Comperative Advantages of NGO: Myths and Realities.
In: Stokke, Olav: Foreign Aid Towards the Year 2000: Experiences and Chal- langes, London, 1998.
- Nohlen, Dieter (Hrsg.): Lexikon Dritte Welt, Reinbeck bei Hamburg, 1998.
- Nuscheler, Franz: Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, Bonn,1996.
- URL: http://www.venro.de (Stand: 1. Mai 2001)
[...]
11999 betrug die ODA 10,118 Mrd. DM (1998: 9,819 Mrd. DM), ein Anteil am Bruttosozialprodukt von 0,26% (1998: 0,26%). (Vgl.: BMZ, 2000: 306)
2Diskussionswürdig ist, inwieweit Missionshilfe als Entwicklungshilfe zu rechen ist. (Vgl: Nuscheler, 1996: 508)
3Zur Abhängigkeit vom Staat, siehe Kapitel 6.1.3.
4Autoritäre Systeme werden (z.B. China) aber auch heute noch, eben aus anderen strategischen Gründen, gestützt.
5Die erwartete Friedensdividende, daß Einsparungen aus Rüstungsetats nun der Entwicklung zu Gute kommen sollten, blieb allerdings aus. (Vgl.: Wulf, Herbert: Wo ist die Friedensdividende geblieben? In: Nuscheler, Franz: Entwicklung und Frieden im Zeichen der Globalisierung, Bonn, 2000.)
6Die Grenzen zwischen kleinen bürokratisierten und großen formalisierten NGOs sind natürlich fließend und nicht allgemein angebbar.
7Mehr als 70% der deutschen Bevölkerung spenden regelmäßig oder gelegentlich zur Linderung fremder Not. Dies ergibt ein Spendenaufkommen von circa. 2-3 Mrd. DM jährlich. (Vgl.: Glagow, 1993: 316)
Häufig gestellte Fragen
Was sind Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und wie werden sie definiert?
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gelten als dritter Sektor zwischen Markt und Staat. Sie leisten gesellschaftliche Integration, indem Kollektivgüter produziert werden. Ihr Steuerungsmodus ist die Solidarität. Sie erhalten ihre Ressourcen aus Solidaritätsbeiträgen der Gesellschaft auf der Basis von Freiwilligkeit und formen diese zur Bearbeitung von gesellschaftlichen Problemlagen in Kollektivgüter um. Entwicklungspolitische NGOs sind ein wichtiger Bestandteil der Zivilgesellschaft. Sie erheben Einspruch und setzen auf Dialog und Kooperation. In den NRO formieren sich Verantwortungsbewußtsein und Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, das in hohem Maße ehrenamtlich geleistet wird.
Welche Typen von NGOs gibt es gemäß dem gesellschaftlichen Anschlußmuster?
Es gibt verschiedene Typen von NGOs, darunter:
- NGOs aus etablierten Großorganisationen (z.B. kirchliche Hilfswerke, politische Stiftungen)
- NGOs aus neuen sozialen Bewegungen (z.B. Deutsche Welthungerhilfe, terre des hommes)
- Honoratioren-NGOs (z.B. "Menschen für Menschen")
- Berufsspezifische Zusammenschlüsse zu NGOs (z.B. "Ärzte ohne Grenzen")
- Dienstleistungs-NGOs und QUANGOs (Quasi-Non-Governmental-Organizations)
Welche Vorteile haben NGOs im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit?
NGOs haben mehrere Vorteile, darunter:
- Gesellschaftliche Anbindung: Sie kommen aus der Gesellschaft und haben Legitimitätsvorteile.
- Unabhängigkeit: Sie sind unabhängig von außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Interessen.
- Flexibilität: Sie können sich schnell an Veränderungen anpassen.
- Motivation: Mitarbeiter sind oft hochmotiviert und arbeiten ehrenamtlich.
Welche Grenzen und Probleme haben NGOs in der Entwicklungspolitik?
NGOs haben auch Grenzen und Probleme, darunter:
- Verhältnis zu „Süd-NGOs“/ Partnerorganisationen: Abhängigkeit von Nord-NGOs kann Eigenheiten der Süd-NGOs gefährden.
- Interessengebundenheit: Abhängigkeit von finanziellen und legitimatorischen Unterstützern.
- Ressourcenbeschaffung: Schwierige Balance zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Projektinvestitionen.
- Professionalität: Mangel an Fachkompetenz und Know-how kann die Effektivität beeinträchtigen.
Wie können NGOs ihre Arbeit verbessern und welche Art der Zusammenarbeit ist notwendig?
NGOs können ihre Arbeit durch Zusammenarbeit mit dem Staat und untereinander verbessern. Die Zusammenarbeit mit dem Staat kann finanzielle Unterstützung und Informationsaustausch beinhalten. Die Zusammenarbeit untereinander kann Komplementaritätseffekte nutzen und eine wirksamere Entwicklungslobby schaffen. Allerdings erschweren ideologische Differenzen und Konkurrenz um Spenden die Zusammenarbeit.
Welche Rolle spielt VENRO (Verband Entwicklungspolitik deutscher Nicht-Regierungsorganisationen e. V.)?
VENRO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von rund 100 deutschen Nichtregierungsorganisationen. Sie ist ein Dachverband, der sich für mehr Gerechtigkeit in der „Einen Welt“ einsetzt, Armut bekämpfen, die Menschenrechte verwirklichen und die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren helfen will.
Was sind die Perspektiven der NGO-Entwicklungszusammenarbeit?
NGOs können die staatliche Entwicklungshilfe ergänzen und korrigieren, aber nicht ersetzen. Es gilt, die Zusammenarbeit mit dem Staat zu intensivieren und voneinander zu profitieren. Die NGOs könnten ihr Druckpotential verbessern, indem sie untereinander kompromißfähiger werden und Bündnisse mit anderen gesellschaftlichen Gruppen suchen. Sie müssen nicht nur die Wunden derer verbinden, die unter die Räuber gefallen sind, sondern auch die Strukturen der Räuberei aufzudecken und zu verändern. Sie müssen sich zunehmend mit der Frage beschäftigen: Wer entwickelt den Norden?
- Arbeit zitieren
- Claudia Fritsche (Autor:in), 2000, Die Rolle der NRO in der Entwicklungspolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105700