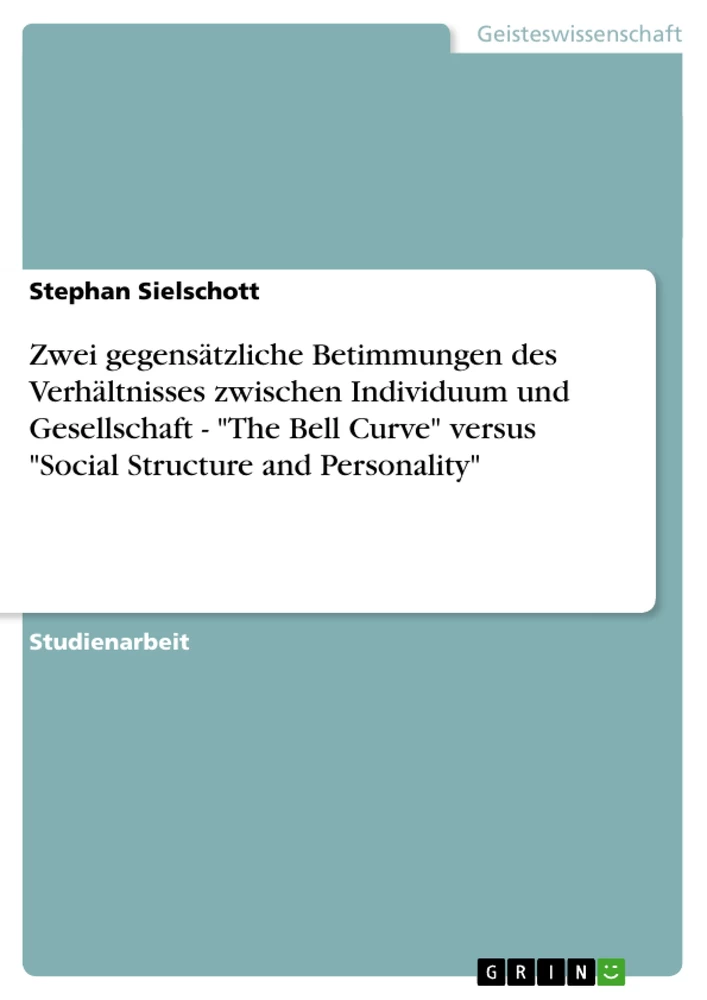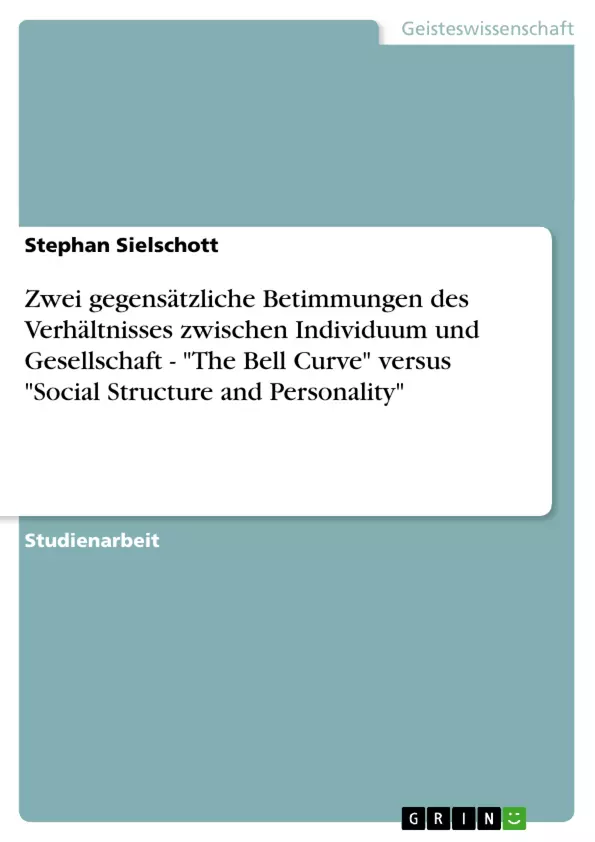Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Genetisch bedingte Intelligenzunterschiede zwischen Ethnien
1. Der Versuch ethnische Differenzen in Bezug auf kognitive Fähigkeiten nachzuweisen
2. Die Argumentation für einen genetisch-biologischen Determinismus kognitiver Fähigkeiten
3. Propagierte genetisch bedingte ethnische Intelligenzunterschiede und die gesellschaftlich-politischen Implikationen
II. Intelligenz als die sozialstrukturelle Position bestimmende Variable
III. Die Wirkungen der Sozialstruktur auf die Persönlichkeitsentwicklung
1. Die Sozialstruktur
2. Arbeitsbedingungen prägen die Persönlichkeit
3. Altersunabhängige Reziprozität von Sozialstruktur und psychologischem Apparat
Resümee
Abbildungen
Literaturverzeichnis
Einführung
Das Thema meines Referates hieß „ethnisch bedingte Intelligenzunterschiede“ und sollte in das im Seminarplan vorgesehene Oberthema „Armut als individuelles Versagen“ einführen. Doch besteht überhaupt ein Zusammenhang zwischen beiden Überschriften? Verweist der Begriff Ethnie nicht implizit auf gesellschaftliche Großgruppen als Bezugs- ebene, während das Oberthema, Armut als Komplex individuell, letztlich kognitiv regulierter Phänomene ausweist? Auf dieses Problem werde ich abschließend erst im Resümee eingehen. In jedem Fall widmen sich Richard Herrnstein und Charles Murray in ihrem 1994 veröffentlichten Buch „The Bell Curve“ der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. Diese Themenstellung ist sicherlich viel zu allgemein gehalten, weshalb ich sie in eine präzisere Fragestellung transformiere.
Welchem Mechanismus, bzw. welchem Gesetz folgt die Verteilung der Individuen in eine hierarchisch gegliederte Gesellschaft?
In meiner Arbeit möchte ich aufzeigen, wie Herrnstein und Murray diese Frage in Bezug auf die USA beantworten. Im ersten Kapitel meiner Hausarbeit beziehe ich mich wie im Referat auf chapter 13, „Ethnic Differences In Cognitive Ability“. In einem ersten Arbeitsschritt werde ich den Versuch Herrnsteins und Murrays nachvollziehen, die Existenz ethnischer Differenzen in Bezug auf kognitive Fähigkeiten zu beweisen. Danach rekonstruiere ich die Argumentation der Autoren für die Existenz einer genetisch-biologischen Determiniertheit unterschiedlicher Intelligenzniveaus. Am Ende des ersten Teils kläre ich, welche Konsequenzen sich aus der Anerkennung ethnisch bedingter Intelligenzunterschiede für die gesellschaftliche und politische Praxis ergeben.
Im zweiten Kapitel erweitere ich das Themenfeld „Rasse und Ethnie“ um das in chapter 5 von Herrnstein und Murray eingeführte Phänomen der „Armut“. Wie andere soziale Probleme (z.B. Schulversagen oder Arbeitslosigkeit) setzen die Autoren „Armut“ als zu erklärende Variable, während „Intelligenz“ als unabhängige Variable fungiert. Auf der individuellen Ebene verharrend, erklären die Autoren wer abhängig von der Intelligenz welche Position in der Sozialstruktur besetzt. Um dem gegenüber die Wirkungen der Sozialstruktur auf die Persönlichkeitsentwicklung offenzulegen, konfrontiere ich den Ansatz von Herrnstein und Murray im dritten Kapitel mit der von Melvin L. Kohn erarbeiteten Perspektive „social structure and personality“.
I. Genetisch bedingte Intelligenzunterschiede zwischen Ethnien
1. Herrnsteins und Murrays Versuch ethnische Differenzen in Bezug auf kognitive Fähigkeiten nachzuweisen
Die Argumentation in „The Bell Curve“ basiert auf dem Vergleich von Intelligenzwerten verschiedener Populationen. Herrnstein und Murray definieren Intelligenz in Anlehnung an Spearman als „general mental ability“1. Ihre Alternativhypothese postuliert einen Zusammenhang zwischen Rasse und Intelligenz, wobei Rasse als unabhängige und Intelligenz als zu erklärende Variable fungiert. Um Scheinkorrelationen der beiden Variablen auszuschließen, müßten idealtypisch sämtliche Drittvariablen kontrolliert werden. In einer ersten Annäherung an das Problem der Drittvariablenkontrolle2läßt sich fragen, ob Intelligenzwerte vergleichbar sind, die zu verschiedenen Zeitpunkten, unter Menschen verschiedenen Alters, in unterschiedlichen kulturellen Umgebungen und in verschiedenen sozioökonomischen Verhältnissen gemessen wurden.
Abhängig von der Drittvariablenkontrolle variiert die Stärke des Zusammenhanges zwischen Rasse und Intelligenz in verschiedenen Untersuchungen.
Ein von Harold Stevenson bei ostasiatischen und amerikanischen Kindern durchgeführter Test mentaler Fähigkeiten3, bei dem sozioökonomische und demographische Merkmale als Drittvariablen kontrolliert wurden, ergab keinen ethnisch bedingten, signifikanten Unterschied. Als Gegenbeispiel wird ein Vergleich ostasiatischer, amerikanischer und britischer Schüler und Studenten hinsichtlich verschiedener I.Q.-Komponenten angeführt4, bei dem deutliche Vorteile für Ostasiaten eruiert wurden.
Herrnstein und Murray zeigen deutlich auf, wie die Qualität der Drittvariablenkontrolle Ergebnisse bestimmt und lehnen entsprechend ihre Alternativhypothese (s.o.) die Kontrolle des SES (Social Economic Status) bei der Messung von I.Q.-Differenzen ab. Auf diese Weise die Wirkungen sozialökonomischer Faktoren auf die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten ausblendend, folgern die Autoren einen höheren I.Q.-Mittelwert der Ostasiaten im Vergleich zur weißen Rasse.5
Die durchschnittliche Differenz zwischen I.Q.s schwarzer und weißer Amerikaner beträgt laut Autorenduo 16 I.Q.-Punkte oder 1,08 Standardabweichungen. Diese Durchschnittswerte ergeben sich aus der Zusammenführung aller 156 zwischen 1918 und 1990 in den USA durchgeführten Intelligenztests.6Die starke Streuung der Resultate reflektiert die differierend konstruierten Tests. Nach dem Motto „so viele Forscher können sich nicht irren“ nehmen Herrnstein und Murray die Ergebnisse in ihren Kanon vermeintlicher Beweise der „Rasse bestimmt Intelligenz - Hypothese“ auf. Sie geben diesem Befund den Anschein unmittelbarer Aktualität, erwähnen aber nicht wie sich die Studien im Zeitraum von 72 Jahren verteilen. Beispielsweise ist eine bedeutende Verringerung der „Black-White Difference“ auf Grundlage der vorliegenden Verteilung weder nachzuweisen noch auszuschließen. Der „Armed Forces Qualification Test“ (AFQT), als jüngste von Herrnstein und Murray zitierte Studie, explizierte 1980 eine noch größere Differenz von 1.21 Standardabweichungen. Allerdings erfüllt die Stichprobe (6502 Weiße, 3022 Schwarze) nicht den Anspruch der Repräsentativität, da in den USA ca. 6 mal mehr Weiße als Schwarze leben.7In der zur ethnischen Zusammensetzung der US-Bevölkerung proportionalen Häufigkeitsverteilung8belegen Schwarze und Weiße in ähnlichem Ausmaß die unteren Ränge der I.Q.-Verteilung. In der oberen Hälfte der aus dem AFQT generierten Verteilung plazieren sich dagegen fast ausschließlich Weiße.
Im Zusammenhang mit dem AFQT stellt sich aber die Frage, ob der Test wirklich wie behauptet Intelligenz im Sinne der kulturell unabhängigen Fähigkeit logischen Denkens mißt. Die folgende Analyse eines für Intelligenztests typischen Items9läßt mich an einer dem Kriterium der Validität verpflichteten Operationalisierung der Variable „Intelligenz“ zweifeln.
RUNNER : MARATHON
(A) envoy : embassy
(B) martyr : massacre
(C) oarsman: regatta
(D) referee : tournament
(E) horse : stable
Die richtige Antwort lautet „oarsman : regatta“. Das Lösen dieser Aufgabe erfordert wohl weniger Intelligenz als die Fähigkeit, das Begriffspaar inhaltlich dem Bereich “sportlicher Wettkampf“ zuordnen zu können. Da sich die Erfahrungswelt vieler Schwarzer auf das großstädtische Ghetto reduziert, in dem Bootswettfahrten eher selten sind, wird ersichtlich, daß die Kenntnis des Begriffes „Regatta“ kultur-und schichtspezifisch vermittelt wird. Das Item mißt also eher kulturell bedingtes und schichtspezifisches Wissen als Intelligenz. Herrnstein und Murray begegnen Kritik dieser Art mit dem Hinweis, Weiße erzielten sowohl bei leichten als auch bei schweren Items bessere Ergebnisse als Schwarze.10Sie sehen ihre Hypothese bestätigt und gehen im weiteren implizit von der Annahme aus, Tests zur Messung kognitiver Fähigkeiten bewiesen ethnische Differenzen bezüglich der Intelligenz.
Im wissenschaftlichen Feld divergieren die Definitionen von Intelligenz. Während Herrnstein und Murray Spearmans Model der allgemeinen Intelligenz (g) anwenden, erweitert z.B. Robert Sternberg „g“, das bei ihm „Analytische Intelligenz“ heißt, um die Aspekte „Kreativer Intelligenz“ und „Praktischer Intelligenz“.11Kreative und praktische Intelligenz bezeichnen hier notwendiges Anpassungsvermögen, das in unterschiedlichen Situationen situationsspezifisches Verhalten erfordert. Um diese Definition angemessen zu operationalisieren, sind also kultur- und schichtspezifische Items zu verwenden. Die jeweilige Definition von Intelligenz bestimmt die Konstruktion des Erhebungsinstrumentes und somit letztlich auch das Ergebnis.
2. Die Argumentation für einen genetisch-biologischen Determinismus kognitiver
Fähigkeiten
Nachdem die folgenreichen Entscheidungen Herrnsteins und Murrays für eine allgemeine
Intelligenzdefinition und gegen die Drittvariablenkontrolle erörtert wurden, frage ich nun ob die unterstellten unterschiedlichen Intelligenzniveaus genetisch-biologisch bedingt sind oder gesellschaftlich-kulturell vermittelt werden.
Herrnstein und Murray greifen zunächst die Vermutung auf, die ethnischen
Intelligenzunterschiede seien ein Ausdruck sozioökonomischer Disparitäten. Mit Bezug auf den NLSY12stellen sie fest, die Kontrolle des sozioökonomischen Status als Drittvariable reduziere die I.Q.-Durchschnittsdifferenz um ca. 1/3. Diese Drittvariablenkontrolle bereitet ihnen einige Kopfschmerzen, da die Kontrolle des sozioökonomischen Status auch die Variable der sozialen Position determinierenden Intelligenz kontrolliere. Deshalb kontrollieren sie nur den elterlichen sozioökonomischen Status, was ihrer Annahme entspricht, die soziale Umwelt beeinflusse individuelle kognitive Fähigkeiten wenn überhaupt, dann nur in der frühen Kindheit.
Herrnstein und Murray zeigen sich im folgenden bemüht eine relative Gewichtung genetischer und gesellschaftliche Determinanten von Intelligenz vorzunehmen. Um Ihre These der genetischen Bedingtheit von I.Q.-Unterschieden zu untermauern, führen sie zwei Beispiele an:
Angenommen die I.Q.-Differenz zwischen Schwarzen und Weißen beträgt 15% und der I.Q. ist zu 60% genetisch bedingt. Um die I.Q.-Differenzen ausschließlich mit Umwelteinflüssen erklären zu können, müßte die durchschnittliche Umwelt der Weißen in extremen Ausmaß fruchtbarer sein als die der Schwarzen. Da solche Umweltdisparitäten unrealistisch seien, könne der I.Q.-Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen nicht ausschließlich auf Umwelteinflüsse zurückgeführt werden.13Die Beweiskraft diese Rechnung ist allerdings zweifelhaft, da der genetische Faktor a priori mit 60% gewichtet wird und die Argumentation mit dieser zu beweisenden Annahme steht und fällt.
Das zweite Beispiel rekapituliert differierende I.Q.-Profile von Weißen und Ostasiaten.
Sowohl Ostasiaten, die in China, Japan usw. leben, als auch die schon seit mehreren Generationen in den USA beheimateten Ostasiaten, weisen demnach einen deutlich höheren naturwissenschaftlichen IQ auf, als die amerikanische Durchschnittsbevölkerung. Sprachliche und kulturelle Einflüsse könnten den unverändert hohen Durchschnittswert der Einwanderer nicht mehr erklären. Herrnstein und Murray empfehlen also, die gemeinsame genetische Prägung der Ostasiaten, in Abgrenzung zu Veranlagungen der europäischen Rasse, die im Bereich verbaler Fähigkeiten überlegen sei, als auslösendes Moment zu sehen.14Diese Erklärung homogener I.Q.-Profile der räumlich getrennten Ostasiaten verkennt, daß sich kulturspezifische Denk- und Verhaltensweisen auch in einer gewandelten Umwelt über lange Zeiträume erhalten.15Dies gilt verstärkt unter der Bedingung der in us-amerikanischen Großstädten zu beobachtenden Ghettobildung ( z.B.“Chinatown“ ).
Die Soziologin Jane Mercer erklärt die Entwicklung unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten aus der sozialen Stratifikation. Während Herrnstein und Murray die USA als weitgehend egalitäre Gesellschaft beschreiben, produziere die heterogene Gesellschaftsstruktur nach Mercer I.Q.-Unterschiede abhängig von den subkulturellen Bildungsniveaus. Bei Kontrolle soziokultureller Variablen „der häuslichen Umgebung“ tendiere die I.Q.-Differenz zwischen Latinos und Nicht-Latinos gegen null. Auch diesen die schichtspezifische Sozialisation kontrollierenden Ansatz kritisieren die Autoren von „The Bell Curve“, da das elterliche Intelligenzniveau den IQ des Kindes und somit auch seine sozialstrukturelle Positionierung bestimme.
Herrnstein und Murray betrachten ihre Hypothese abschließend als verifiziert, bestimmen ethnische Intelligenzunterschiede also als das Produkt eines Mischverhältnisses aus genetischen und gesellschaftlichen Faktoren , wobei die genetische Komponente mit
40 - 80 % gewichtiger erscheint. Der Psychophysiologe Manfred Velden kritisiert den Versuch Erblichkeitsschätzungen vorzunehmen, „weil die Variabilität der kulturellen Umwelt keine natürliche Größe ist und darüber hinaus auch für eine spezifische Bevölkerung in keiner Weise ( in Relation zu anderen Populationen ) bezifferbar ist. (...) Diese Auseinandersetzung, bei der es um die relative Gewichtung von biologischen im Gegensatz zu soziokulturellen Determinanten menschlichen Lebens geht, ist letztlich gar keine Wissenschaftliche, sondern eine solche um das Bild vom Menschen.16
3. Propagierte genetisch bedingte ethnische Intelligenzunterschiede und die gesellschaftlich-
politischen Implikationen
Herrnstein und Murray sehen sich herausgefordert, ihre These der „erbbiologisch verankerten ethnischen Intelligenzunterschiede“ gegen den Vorwurf des Rassismus zu verteidigen. Methodisch unterscheiden sie zu diesem Zweck die Ebene der ethnisch bestimmten Großgruppen von der individuellen Ebene. Ihrer Argumentation folgend legitimiere die genetische Bedingtheit von Intelligenz keine Urteilsbildung über individuelle Intelligenz, da ethnische Differenzen sich ausschließlich auf Großgruppen bezögen. Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen veränderten sich nicht durch das Wissen um ethnisch bedingte Intelligenzunterschiede.
Diese Überlegungen widersprechen den historischen Erfahrungen im Nationalsozialismus. Realpolitisch wurden individuelle Zuschreibungen doch gerade der übergeordneten Rassentheorie entlehnt. Die Stufenleiter der Wertigkeit der einzelnen Rassen war nicht „nur“ Grundlage staatlicher Politik, sondern bestimmte auch die alltäglichen Diskriminierungen des Juden durch den Arier. Reziprok stabilisierten die Vorurteile der Menschen das Regime, während die ideologische Propaganda die rassistischen Vorurteile des Individuums verstärkte. Herrnstein und Murray bringen ihre dem Anspruch nach wissenschaftlichen Ergebnisse in den politischen Meinungsbildungsprozeß ein und sprechen politische Empfehlungen aus. So führe die Annahme Intelligenz sei hauptsächlich genetisch bedingt, also nicht formbar, zu der Schlußfolgerung , sozialpolitische Interventionen hätten keinen oder einen geringen Einfluß auf individuelle Fähigkeiten.17In der Konsequenz werden soziale Ungleichheiten innerhalb dieser Perspektive als genetisch bedingt, also naturgewollt gerechtfertigt. Die unterprivilegierte Positionierung der Schwarzen in der us-amerikanischen Sozialstruktur wird von Herrnstein und Murray durch die genetische Prädestination erklärt.
II. Intelligenz als die sozialstrukturelle Position bestimmende Variable
Im ersten Teil meiner Arbeit bildete das Phänomen der Intelligenz die zu erklärende Variable. Die Rasse als genotypische Konzeption fungiert bei Herrnstein und Murray als unabhängige Variable. Doch auch der Gemeinschaft der amerikanischen Weißen attestieren die Autoren, freilich auf vergleichsweise hohem Niveau, eine Heterogenität in der Verteilung von Intelligenz. Innerhalb ihrer Konzeption der Beziehung von Individuum und Gesellschaft wird Intelligenz zur unabhängigen Variable, die erklärt wen soziale Probleme betreffen.
In chapter 5 versuchen Herrnstein und Murray den Leser zu überzeugen, daß Intelligenz als Armut verursachende Variable wichtiger ist, als der sozioökonomische Hintergrund des von Armut Betroffenen.18Die Frage in ihren empirischen Analysen lautet immer, ob der I.Q. weiter einen statistisch signifikanten Effekt auf die abhängige Variable ausübt, wenn der SES statistisch kontrolliert wird. Wie beim Intelligenzvergleich der Rassen wird nicht der SES des Betroffenen selbst, sondern der seiner Eltern kontrolliert. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus der Hypothese eines ab dem 10. Lebensjahr über die gesamte Lebensspanne konstant bleibenden I.Q.s. Eine umstrittene Prämisse dieser Bedeutung bedarf meiner Meinung nach eines Nachweises, da durch einen schlichten Verweis auf einschlägige Forschungen ( ohne Literaturhinweis ) der Eindruck entsteht, die methodischen Entscheidungen der Autoren werden im Dienste der Verifizierung ihrer Hypothese getroffen. Im Verfahren der Operationalisierung legen Herrnstein und Murray Beruf, Schulabschluß und Einkommen als Indikatoren der Zieldimension SES fest.
In einem Kurvendiagramm19vergleichen sie die Auswirkungen von I.Q. und elterlichem SES, indem die Wahrscheinlichkeit unter der Armutsgrenze20zu liegen, in Abhängigkeit jeweils einer unabhängigen Variablen bestimmt wird. Die andere unabhängige Variable unterliegt jeweils statistischer Kontrolle, wird also auf mittlerem Niveau konstant gehalten. Die Autoren konstatieren einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen elterlichem SES und der Armutswahrscheinlichkeit, schätzen die Bedeutung des I.Q. als Armut determinierende Variable aber als deutlich gewichtiger ein. Ihrer Ansicht nach birgt niedrige Intelligenz ein höheres Armutsrisiko als niedriger SES:„If a white child of the next generation could be given a choice between being disadvantaged in socioeconomic status or disadvantaged in intelligence, three is no question about the right choice.21“
II1. Die Wirkungen der Sozialstruktur auf die Persönlichkeitsentwicklung
1. Die Sozialstruktur
Schon der Untertitel von „The Bell Curve“ , der da heißt „Intelligence and Class Structure in American Life“, verweist auf den Anspruch der Autoren, die Interdependenzen dieser Konzepte offenzulegen. Im letzten Abschnitt habe ich am Beispiel der Armutsproblematik gezeigt, daß „The Bell Curve“ keine gleichberechtigte gegenseitige Abhängigkeit von „Intelligence“ und „Class Structure“ postuliert, sondern die Positionierung in der sozialen Schichtung in Abhängigkeit vom Intelligenzniveau deutet.
Melvin L. Kohn widmet sich dem gleichen Thema, versucht aber schwerpunktmäßig Wirkungen der Sozialstruktur auf die Persönlichkeitsentwicklung nachzuweisen, ohne aber reziproke Effekte auszublenden. Um Mißverständnisse im Rahmen der Übersetzung zu vermeiden verwende ich bei der Erklärung von Kohns Konzept der „social structure“ teilweise die englischen Begriffe.
Zunächst differenziert Kohn zwischen social classes und social stratification. Social classes sind demnach Gruppen, die abhängig von ihrer Beziehung zu Besitz und Kontrolle von Produktionsmitteln und über Arbeitskraft definiert sind. Nominal skaliert, können die Merkmale dieser kategorialen Variablen lediglich im Hinblick auf Gleichheit oder Ungleichheit unterschieden werden, weisen also keine Reihenfolge auf. Kohn unterscheidet sechs social classes, differenziert auf der Basis von ownership, supervisory position und innerhalb der nonsupervisory employees von manual and nonmanual work. Kohn verweist auf eigene Forschungsarbeiten, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen social classes und intellektuellen Fähigkeiten sowie Wertorientierungen zeigten.22Der Begriff social stratification wird als kontinuierliche Variable behandelt, als ordinal skalierte Reihenfolge hierarchisch gegliederter Positionen. Die Effekte dieser Dimension der Sozialstruktur auf Persönlichkeit und Verhalten von Individuen schätzt Kohn im Vergleich zu den Effekten der social classes als noch stärker ein23. Die Stärke des Zusammenhanges sei aber abhängig von der Operationalisierung der Vaiablen social stratification. Während Herrnstein und Murray die Position der Familie in der hiearchischen Gliederung der Bevölkerung zur unabhängigen Variable machen, hält Kohn die Position des Betroffenen selbst für aussagekräftiger. Wie Herrnstein und Murray verwendet Kohn die Indikatoren Berufsstatus, Ausbildungsabschluß und Einkommen zur Messung der individuellen Position innerhalb der sozialen Schichtung.24
Die Einbettung des Menschen in die Sozialstruktur ist Kohns Meinung nach unmittelbar mit spezifischen Lebensbedingungen verknüpft, deren wichtigste Form die Arbeitsbedingungen seien. Die wechselseitigen Effekte von Erwerbsarbeit und intellektueller Entwicklung untersuchten Kohn und Schooler in einer Längsschnittstudie.25
2. Arbeitsbedingungen prägen die Persönlichkeit
Wer eine privilegierte sozialstrukturelle Position einnimmt, kann mit steigender Komplexität seiner Arbeit selbstbestimmter arbeiten, was intellektuelle Flexibilität fördert. Auf Basis dieser Alternativhypothese ließen Kohn und Schooler im Jahr 1964 Interviews mit einer repräsentativen Auswahl abhängig beschäftigter Männer durchführen. 10 Jahre später wurde das Interview mit einem repräsentativen Subsample der ehemals Befragten wiederholt. Insgesamt lieferten 687 Männer, die zweimal interviewt wurden, die Daten zur Analyse. Sieben Indikatoren sollen die Komplexität der individuellen Arbeit messen und werden in einem qualitativen Interview erhoben. Als Indikatoren fungieren:
1. das Ausmaß der Komplexität in der Behandlung von Gegenständen
2. das Ausmaß der Komplexität im Umgang mit Daten und Ideen
3. das Ausmaß der Komplexität im Umgang mit Menschen
4. das höchste Ausmaß von Komplexität in einem der drei Bereiche
5.-7. die in die drei Bereiche investierte Arbeitszeit
Intellektuelle Flexibilität als zu erklärende Variable wird nicht, wie Herrnstein und Murray es vorziehen, in I.Q.-Tests erhoben, sondern ebenfalls mit der Methode des qualitativen Interviews. Als Indikatoren fungieren:
1. das Lösungsvermögen bei kognitiven Problemstellungen
2. die Fähigkeit die Beziehung zwischen dem Ganzen und dessen Bestandteilen zu erkennen
3. die Zustimmungsbereitschaft bei entsprechenden Entscheidungsfragen
4. die subjektive Einschätzung der Intelligenz durch den Interviewer Kohn geht von der Annahme aus, jeder dieser Indikatoren erfasse die intellektuelle Fähigkeit des Arbeiters, komplexe Situationen zu bewältigen. Keinem der Indikatoren schreibt Kohn vollständige Validität zu, was das Ergebnis aber nicht beschädige, solange jeder Indikator einen Teil der Zieldimension, nicht aber alle vier Indikatoren den Identischen erfaßten. Die Korrelation zwischen der 1964 und der zehn Jahre später gemessenen intellektuellen Flexibilität beträgt 0.93. Auf den ersten Blick wird Herrnsteins und Murrays Hypothese des nahezu unveränderlichen I.Q.s durch den hohen Korrelationswert bestätigt. Während die Stabilität in The Bell Curve aber ursächlich mit genetischer Prädetermination erklärt wird, interpretiert Kohn die Korrelation als Ausdruck der reziproken Beziehung zwischen der Komplexität des Arbeitsprozesses und der intellektuellen Flexibilität. Soziale Bedingungen erklären demnach nicht nur den kleinen Anteil veränderter intellektueller Flexibilität (0,07), sondern wirken zudem stabilisierend auf intellektuelle Fähigkeiten, beeinflussen also auch die Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter.
Diese Annahme ist mir zwar höchst plausibel, der empirische Nachweis wird jedoch in der Darstellung Kohns nicht geführt oder von mir nicht als solcher erkannt.26Die Schlußfolgerung läßt sich nach Kohn nicht auf die Variablen Komplexität der Arbeit und intellektuelle Flexibilität reduzieren, da sowohl die sozialstrukturellen Bedingungen als auch die Persönlichkeit weitere wichtige Facetten beinhalteten. Da Lebens- und Arbeitsbedingungen sich abhängig von der individuellen Positionierung im hierarchischen Gliederungssystem verteilten, sei eine generelle Wechselwirkung zwischen Sozialstruktur und psychischem Apparat zu unterstellen.
Auf methodischer Ebene läßt sich zusammenfassend feststellend, daß Kohn keine Variable ausschließlich als unabhängige oder zu erklärende Variable behandelt. Die Beziehung zwischen Persönlichkeit und Sozialstruktur wird innerhalb seiner Perspektive als reziprokes Verhältnis verstanden. Inwieweit diese Ambivalenz die gesamte Lebensspanne prägt zeige ich im Folgenden.
3. Altersunabhängige Reziprozität von Sozialstruktur und psychologischem Apparat
Die oben angeführte Längsschnittstudie bezieht sich in 27Durchführung und Interpretation auf eine repräsentative Auswahl männlicher Arbeitnehmer und nicht auf Alterskohorten. Kohn vermutet aber, die Wechselwirkungen zwischen Sozialstruktur und Persönlichkeit ließen sich altersunabhängig auch in Bezug auf Jugendliche und Alte nachweisen. Miller, Slomczynski und Kohn analysierten deshalb getrennt für junge, alte und mittelalte männliche Arbeitnehmer den Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und intellektuellem Prozeß. Konkret wurden die Auswirkungen der Arbeitskomplexität, der Dichte der Überwachung und der „routinization“ auf intellektuelle Flexibilität und Aufgeschlossenheit der Arbeitnehmer gemessen. Die Analysen zeigten starke Effekte der Arbeitsbedingungen, besonders der Arbeitskomplexität auf intellektuelle Flexibilität und Aufgeschlossenheit der Arbeitnehmer. Dies gilt nach Kohn in gleichem Maße für alle drei Alterskohorten. Leider gewährt Kohn dem Leser an dieser Stelle keinen Einblick in den Verlauf des Forschungsprozesses. Während diese Analyse ausschließlich reguläre Beschäftigungsverhältnisse fokussierte, bestätigten Mortimer, Lorence und Kumka Kohns Ergebnisse 1996 auch für teilzeitbeschäftigte High School Studenten. Miller, Schooler und Kohn erweiterten das Konzept der beruflichen Selbstbestimmung auf den Bereich des schulischen Lernens. Durch das Auswerten von Interviews entwickelten sie analog zur Messung von beruflicher Selbstbestimmung ein Meßinstrument für schulische Selbstbestimmung. Die Ergebnisse, des im weiteren nicht näher erläuterten Forschungsprozesses, belegen nach Kohn reziproke Effekte von selbstbestimmtem Lernen und Persönlichkeitsentwicklung. Die von Kohn angeführten Untersuchungen bestätigen seine Hypothese der altersunabhängigen Persönlichkeitsprägung durch soziale Bedingungen, bzw. sind zumindest nicht geeignet seine Hypothese zu falsifizieren.
In III.2 und 3 habe ich somit zwei Argumentationsstränge nachvollzogen, die sich in ihren Ergebnissen gegen Herrnstein und Murray richten. Erstens führt Kohn vor, daß soziale Bedingungen die Persönlichkeitsentwicklung entscheidend beeinflussen, wenn auch im Sinne wechselseitiger Einwirkung. Zweitens gelte dies altersunabhängig und nicht nur in der Phase der Sozialisation.
Resümee
Armut ist innerhalb Herrnsteins und Murrays Standpunkt nicht primär ein Resultat individuellen Versagens. Sowohl die unterprivilegierte Stellung der Schwarzen in der amerikanischen Gesellschaft, als auch die Armut unter den amerikanischen Weißen, erscheint innerhalb ihrer Perspektive als fatalistisches Faktum, das man hinzunehmen hat.
„The issue is not simply how people who are poor through no fault of their own can be made not poor but how we - all of us, of all abilities and income levels - can live together in a society in which all of us can pursue happiness.“28
Das Konzept der genetischen Prädestination richtet sich erstens gegen die theoretische Figur des freien Individuums, das im freien Wettbewerb jede Position erreichen kann. Zweitens negiert es die Funktion der Sozialstruktur, Individuen in Abhängigkeit zu ihrer Position in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu beeinflussen. Wie Herrnstein und Murray interpretiert auch Kohn die Gesellschaft als eine Struktur hierarchisch gegliederter Positionen. Die individuelle Statuszuweisung vollzieht sich bei Kohn weder im freien Wettbewerb der Individuen, noch auf Grundlage genetischer Vorbestimmungen. In der Beziehung von Individuum und Gesellschaft arbeitet Kohn ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis heraus. Die sozialstrukturelle Position beeinflußt verschiedene Aspekte der Persönlichkeit, konstituiert sich aber andererseits in Abhängigkeit zu ihr. Diese Reziprozität ist dem Leser bedauerlicherweise schwerer zu kommunizieren, als die vergleichsweise einfache Botschaft Herrnsteins und Murrays. Wahrscheinlich ist dies ein Ursache der Popularität von „The Bell Curve“. Wichtiger erscheint mir aber, daß rassistische und sozialdarwinistische Vorurteile anscheinend auch im akademischen Feld wirken und in den Medien anschlußfähig sind. Ich bin nun aber froh, „The Bell Curve“ zur Seite legen zu können.
Literaturverzeichnis
- Bourdieu, Pierre: „Die Logik der Felder“ und „Habitus, illusio und Rationalität“
aus: Reflexive Anthropologie
- Herrnstein, Richard J. und Murray, Charles: „The Bell Curve - Intelligence and Class Structure in American Life“; USA, 1994
- Kohn, Melvin L.: „Two Visions of the Relationship Between Social Structure and Personality: The Bell Curve Versus Social Structure ans Personality“ aus: A Nation Divided: Divesity, Inequality and Community in American Society; Ithaca, 1999 (www.soc.jhu.edu/mlkwilliam.pdf. - Stand: 27.12.2002)
- Sternberg, Robert: Sceptic Magazine Interview With Robert Sternbeg on The Bell Curve aus: Sceptic vol. 3, no. 3, 1995, pp. 72-80 (www.sceptic.com/03.3.about-miele.html Stand: 27.12.2002)
- Velden, Manfred: Psychophysiologie - Eine kritische Einführung; München 1994
[...]
1 Vgl. Herrnstein und Murray: 304
2 Ebd. 273f.
3 Ebd. 274
4 Ebd. 274
5 Ebd. 276
6 Vgl. Anhang, Abb. 1
7 Vgl. auch die Kritik Sternbergs bezüglich der nicht gegebenen Repräsentativität: 5
8 Vgl. Anhang, Abb. 2
9 Vgl. Herrnstein und Murray: 281
10 Vgl. Herrnstein und Murray: 282
11 Vgl. Sternberg: 1f.
12 NLSY heißt: National Longitudinal Survey of the Labor Market Experience of Youth
13 Vgl. Herrnstein und Murray: 298f.
14 Vgl. Herrnstein und Murray: 300f.
15 Vgl. Pierre Bourdieu: 260: über den „Hysteresis“- Effekt15
16 Vgl. Manfred Velden:
17 Vgl. Herrnstein und Murray: 314
18 Vgl. Herrnstein und Murray: 127
19 Vgl. Anhang, Abb.3
20 Die Armutsgrenze wird in Abhängigkeit zu einem bestimmten, hier aber nicht angegebenen Familieneinkommen bestimmt
21 Vgl. Herrnstein und Murray: 135
22 Vgl. Kohn: 12
23 Vgl. Kohn 13
24 Ebd. Kohn: 12
25 Ebd. 14ff. ( Reciprocity of Effects )
26 Vgl. Kohn: 15
27 Vgl. Kohn: 18f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text befasst sich mit dem Thema "ethnisch bedingte Intelligenzunterschiede" und untersucht die Beziehung zwischen Intelligenz, Sozialstruktur und Persönlichkeitsentwicklung. Der Text analysiert insbesondere das Buch "The Bell Curve" von Herrnstein und Murray kritisch.
Welche Argumentation verfolgen Herrnstein und Murray in "The Bell Curve" bezüglich ethnischer Intelligenzunterschiede?
Herrnstein und Murray versuchen, die Existenz ethnischer Differenzen in Bezug auf kognitive Fähigkeiten zu beweisen. Sie argumentieren für eine genetisch-biologische Determiniertheit unterschiedlicher Intelligenzniveaus und diskutieren die gesellschaftlich-politischen Implikationen.
Wie definieren Herrnstein und Murray Intelligenz?
Herrnstein und Murray definieren Intelligenz in Anlehnung an Spearman als "general mental ability".
Welche Kritik wird an Herrnsteins und Murrays Methodik geübt?
Kritisiert wird insbesondere, dass sie die Kontrolle von Drittvariablen wie sozioökonomischem Status (SES) vernachlässigen und eine allgemeine Intelligenzdefinition anwenden, die kulturelle und schichtspezifische Einflüsse nicht ausreichend berücksichtigt.
Welche Rolle spielt der sozioökonomische Status (SES) in Herrnsteins und Murrays Analyse?
Herrnstein und Murray kontrollieren hauptsächlich den elterlichen SES, da sie davon ausgehen, dass die soziale Umwelt individuelle kognitive Fähigkeiten nur in der frühen Kindheit beeinflusst. Sie argumentieren, dass Intelligenz als Armut verursachende Variable wichtiger ist als der sozioökonomische Hintergrund.
Welche alternative Perspektive zur Wirkung der Sozialstruktur auf die Persönlichkeitsentwicklung wird vorgestellt?
Die Perspektive "social structure and personality" von Melvin L. Kohn wird vorgestellt. Kohn betont die wechselseitigen Effekte von Sozialstruktur und Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere die prägende Wirkung von Arbeitsbedingungen auf die intellektuelle Flexibilität.
Wie unterscheidet sich Kohns Ansatz von dem von Herrnstein und Murray?
Kohn betont die Reziprozität zwischen Sozialstruktur und Persönlichkeit, während Herrnstein und Murray die Positionierung in der sozialen Schichtung primär in Abhängigkeit vom Intelligenzniveau sehen. Kohns Ansatz berücksichtigt die soziale Determination von Intelligenz stärker als Herrnstein und Murray.
Welche Ergebnisse lieferte die Längsschnittstudie von Kohn und Schooler?
Die Studie zeigte, dass komplexere Arbeitsbedingungen die intellektuelle Flexibilität fördern und dass soziale Bedingungen nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung in der Kindheit beeinflussen, sondern auch im Erwachsenenalter stabilisierend wirken.
Welche Kritik äußert der Text an der Vorstellung von genetisch bedingten Intelligenzunterschieden?
Der Text kritisiert, dass die Annahme genetisch bedingter Intelligenzunterschiede zu der Schlussfolgerung führen kann, dass sozialpolitische Interventionen keinen oder nur geringen Einfluss auf individuelle Fähigkeiten haben. Dies kann soziale Ungleichheiten rechtfertigen.
Welche Konsequenzen haben Herrnsteins und Murrays Thesen für die politische Praxis?
Die Autoren sprechen politische Empfehlungen aus, die auf der Annahme basieren, dass Intelligenz hauptsächlich genetisch bedingt ist. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass sozialpolitische Interventionen wenig bewirken und soziale Ungleichheiten gerechtfertigt sind.
- Quote paper
- Stephan Sielschott (Author), 2002, Zwei gegensätzliche Betimmungen des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft - "The Bell Curve" versus "Social Structure and Personality", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105824