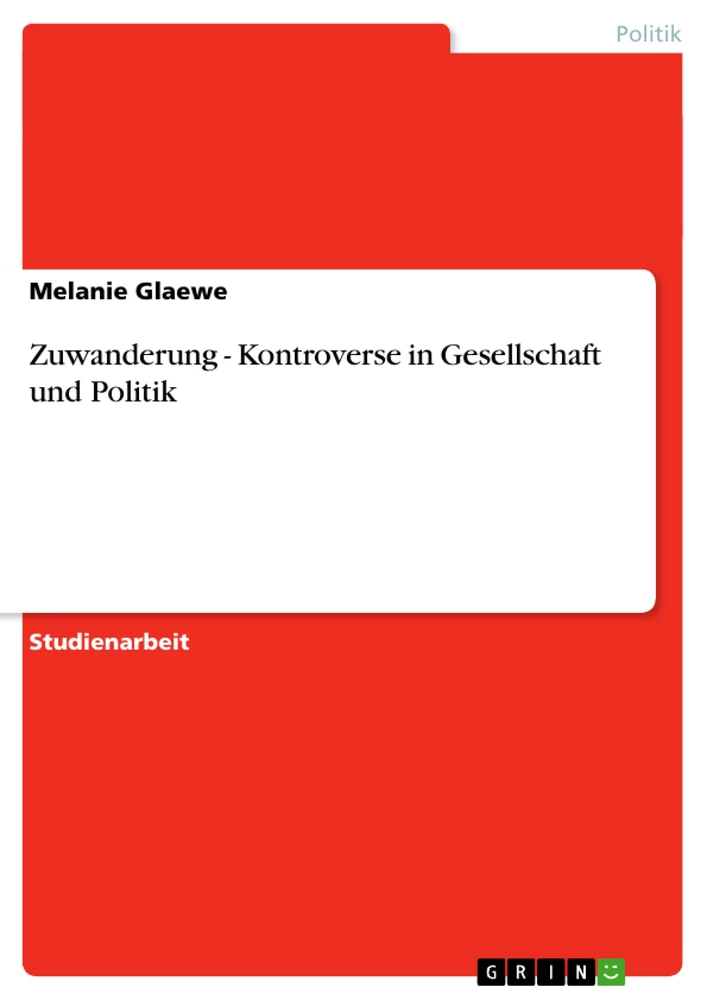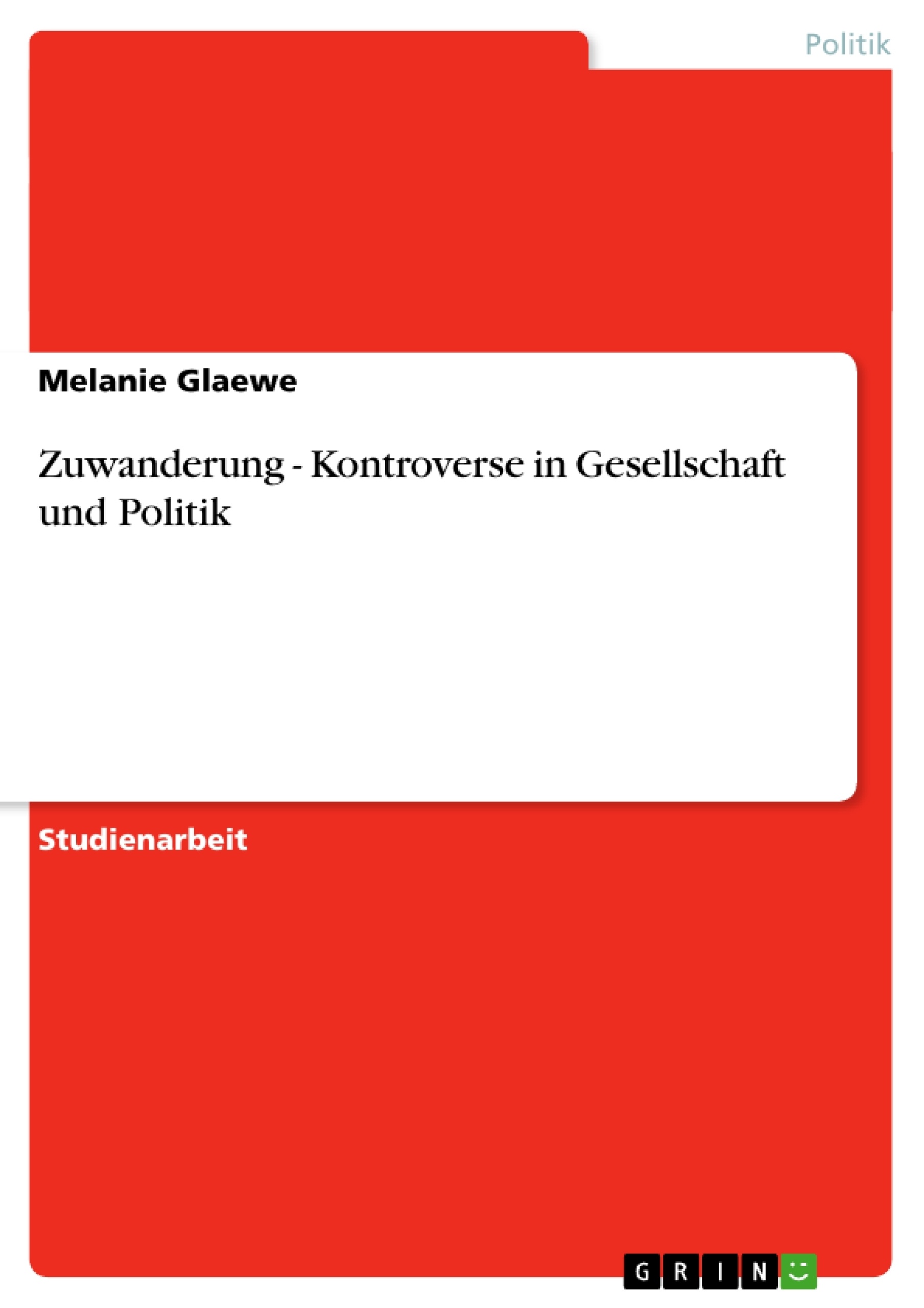Gliederung
1. Einleitung
2. Migration und Flucht
2.1. Schub- und Sogkräfte: Ursachen/Gründe von Migration und Flucht
2.2. Europa als Auswanderungs- und Einwanderungskontinent
2.3. Deutschland: vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland
3. Ausländer- und Asylpolitik in Deutschland
3.1. Der neue Vorschlag zum Einwanderungsgesetz: im Vergleich das aktuelle AuslG
3.2. Kontroversen in Gesellschaft und Politik: Positionen von Verbänden, Institutionen und Parteien
4. Fazit
5. Literatur
1.Einleitung
Bestimmen nationale Interessen welche Rechte der einzelne Mensch, hier der Zuwanderer, innerhalb der Gesamtgesellschaft besitzt? Werden dadurch Grenzen in politischen Gemeinschaften gezogen?
2.Migration und Flucht
Definitionen der Begriffe ( nach S. Collinson, Europe and International M. 1993; OECD, The Changing Course of International M. 1992 , aus Schmidt: Wörterbuch zur Politik, Stuttgart 1995 )
Migration: beschreibt eine Wanderungsbewegung von Individuen bzw. Kollektiven in geographischräumlicher Hinsicht. Sie kann allerdings auch eine Positionsbewegung innerhalb sozialstruktureller Gefüge einer Gesellschaft sein.
Flüchtling: Personen, die aus Furcht oder Not aufgrund von Kriegen und vor allem wegen Verfolgung aus politischen, rassischen, ethnischen oder religiösen Gründen ihre Heimat eine Zeit lang oder für immer verlassen.
2.1. Schub- und Sogkräfte : Ursachen / Gründe von Migration und Flucht
Schubfaktoren sind Faktoren, die Menschen dazu bewegen oder zwingen, ihre Heimat ( Dorf, Stadt, Region, Land ) zu verlassen.
Sogfaktoren entstehen in den Zielländern, indem sie etwas anbieten ( Arbeit, Wohlstand, Freiheit ).
Verschiedene Ursachen für Fluchtbewegungen:
1. Kriege als Hauptursache für Fluchtbewegungen
2. Repression als Fluchtursache
3. Verfolgung von Minderheiten
4. Umweltkatastrophen und Umweltflüchtlinge
5. Armut
6. „Junges Humankapital auf Wanderschaft“
2.2.Europa als Auswanderungs- und Einwanderungskontinent
Die Geschichte des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts hat gezeigt, daß in Europa aus ökonomischen und politischen Gründen starke Massenfluchtbewegungen einsetzten. Im 19. Jahrhundert löste Europa einen Großteil der sozialen Frage durch Auswanderung. Zwischen 1820 und 1930 verließen ungefähr 40 Millionen Menschen Europa, vorwiegend aus sozialen und ökonomischen Gründen.
Während des zweiten Weltkrieges, sowie in den folgenden Jahren, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts emigrierten rund 60 Millionen Menschen, beispielsweise in die Vereinigten Staaten.
Seit den 50er Jahren sind fast alle westeuropäischen Staaten zu Einwanderungsländern geworden ( bspw. durch die Dekolonialisierung ).
Desweiteren kamen aufgrund des steigenden Bedarfs an Arbeitskräften zwischen 1955 und 1973 ca.
13 Millionen Gastarbeiter nach Europa.
Ab Mitte der 70er Jahre nahm die Zahl der Arbeitsmigranten ab, und die der Asylsuchenden zu. Nach der „Wende“ 1989/90 und des Zusammenbruches des Sozialismus wurden die Staaten der EU zum Mittelpunkt der Migrationsbewegung aus dem Osten und Süden.
2.3. Deutschland: Vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland
Rund 5 Millionen Deutsche wanderten im 19. Jahrhundert vor allem in die USA aus, vorrangig aus ökonomischen Gründen. Aufgrund der zweiten großen Auswanderungswelle ab 1880 wurden für schwere und niedere Arbeiten in Landwirtschaft und Industrie vor allem Polen und in der Donau - Region lebende Menschen nach Deutschland geholt. Bis zum ersten Weltkrieg waren es rund 1,2 Millionen.
Durch den Nationalsozialismus stieg die Zahl auf ca. 10 Millionen ( Zwangsarbeiter für Rüstung und Industrie ).
Nach Ende des zweiten Weltkrieges kam es zu mehreren Zuwanderungswellen, die unterschiedliche Ursachen hatten ( mehrere Millionen Flüchtlinge und Heimatvetriebene aus dem Osten, die die deutsche Volkszugehörigkeit besaßen; Millionen „Gastarbeiter“ ab Mitte der 50er Jahre bis 1973; Flüchtlinge aus der ehemaligen DDR die bis zum Mauerbau 1961 kamen; Flüchtlinge vor allem aus osteuropäischen Ländern und der damaligen Sowjetunion ).
Die aktuelle Zahl, der in Deutschland lebenden Ausländer beträgt 7,3 Millionen - also 9% der Gesamtbevölkerung. Von diesen leben viele schon seit vielen Jahren hier, hinzu kommen die, die von Deutschland aus humanitären Gründen aufgenommen werden.
3.Ausländer- und Asylpolitik in Deutschland
„So ist es von unterschiedlicher ethischer Relevanz und politischer Bedeutung, ob es um Menschen geht, die als Arbeitsmigranten mit ihren Familien bei uns leben, die aufgrund politischer Verfolgung das Asylrecht in Anspruch nehmen oder Schutz vor Bedrohung von Leib und Leben bei Krieg und Bürgerkrieg suchen, oder ob es um Migration geht, die durch wirtschaftliche Not und das soziale Gefälle zwischen verschiedenen Regionen der Erde ausgelöst wird.“
( „...und der Fremdling, der in deinen Toren ist.“, Eine Arbeitshilfe zum Gemeinsamen Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht, 1998; www.bpb.de/zuwanderung/zuwanderung.htm )
Gerade durch das demographische Problem in Deutschland ist es notwendig das Thema Zuwanderung neu zu diskutieren, um einerseits die Sicherungssysteme und andererseits die Leistungsfähigkeit zu stabilisieren.
Es sollte allerdings beachtet werden, daß gerade aus diesen Gründen keine 2 - Klassen - Bildung von Ausländern entsteht.
3.1. Der neue Vorschlag zum Einwanderungsgesetz: im Vergleich das aktuelle AuslG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2. Kontroversen in Gesellschaft und Politik: Positionen von Verbänden, Institutionen und ParteienAmnesty International - Sektion Deutschland
a) Völkerrechtliche Verpflichtung:
durch Genfer Flüchtlingskonvention und Europäische Menschenrechtskonvention ist Entscheidungsfreiheit der Nationalstaaten eingeschränkt der Flüchtling hat Schutzanspruch
b) GG Beachtung der Grundrechtsbestimmungen in der Verfassung
c) Opferorientierung Forderung nach Anerkennung nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung Erhöhung der Altersgrenze auf 18 Jahre
d) Ausgestaltung des Anerkennungsverfahrens Forderung nach „Wohlwollenprinzip“ sachgerechtes, faires, auf Grundlage internationaler Normen durchgeführtes Verfahren Verlängerung der Fristen unabhängige Behörden ohne Bundesbeauftragten
e) Härtefallregelung oberste Landesbehörden sollten Möglichkeiten erhalten zur Erteilung Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären und politischen Gründen
f) Sanktion bei „Fehlverhalten“ Effektivität von Anerkennungsverfahren wird durch Sozialhilfe- und Arbeitsgenehmigungsrechtliche Sanktionen verhindert
g) Rückführung keine Weitergabe von Daten an Herkunftsländer Kirchen in Deutschland
a) Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen systematische Bekämpfung weltweiter Armut und Umweltzerstörung internationale Bemühungen Frieden zu erhalten
Schaffung demokratischer, rechtsstaatlicher und marktwirtschaftlicher Strukturen verbesserte Bildungseinrichtungen und Gesundheitswesen weltweit internationale Interessen vor nationalen Interessen b) Europäische Zuwanderungspolitik
abgestimmte europäische Ausländerpolitik nach humanitären und menschenrechtlichen Traditionen einheitliche Standards für Flüchtlingsanerkennung
-Europäische Lastenverteilung
-Ursachenbekämpfung
c) Gesamtkonzept Zuwanderung
-durchschaubare und verläßliche Regeln
-Verbesserung Verfahren und Abschiebeschutz
-Elemente Territorialprinzip zu Elementen des Abstammungsprinzip Kostenregelung Bund - Länder
-polizeiliche Aufklärung: Ausländer sind keine Gefahr für deutsche Bevölkerung d) Rechtliche Integration
politische Mitbestimmung, Bürgerrechte Mehrstaatigkeit
e) soziale und kulturelle Integration
-rechtliche und emotionale Einbürgerung
-Integrationshilfen: ehrenamtliches Engagement, Selbsthilfegruppen
f) Arbeitsleben
Bildungschancen um konkurrenzfähig zu sein Teilhabe an Qualifizierungsmöglichkeiten Schul- und Berufsbegleitende Unterstützung g) Wohnumfeld
-gleiche Chancen auf Wohnungsmarkt für verbesserte Integration h) Kulturelle Bedingungen
-Anerkennung von Vielfalt
-kulturübergreifende Verständigung, interkulturelle Konfliktfähigkeit, Toleranz
-gleichberechtigte Beteiligung am öffentlichen Leben ( einschließlich politische Aktivität )
-durch Religionsfreiheit: Möglichkeit zu muslimisch - religiösen Unterricht an öffentlichen Schulen
Türkische Gemeinde Deutschland
a) Integrationsförderung
-deutsche Sprache = Grundlage für Integration
-zusätzlich zu Deutschkursen: Gesellschaftskunde und berufliche Orientierung Förderung durch Anreizsystem teilweise Kosten - Selbstübernahme, bspw. wenn Kurs nicht regelmäßig besucht wird
Wohlfahrtsverbände
a) Integrationsförderung
-Förderung, damit gleichberechtigtes Teilhaben und Teilnehmen am Leben garantiert wird
-grundlegende Angebote: Kindergarten- und Schulbesuch, Sprachförderung, Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt
-individuell abgestimmte Sprachkurse ( unterschiedliche Lernniveaus, zeitliche Regelungen ) bundeseinheitliche Abschlußmöglichkeiten
DGB
a) Integrationsförderung
-Berücksichtigung aller Zuwanderer: dauerhafte gesellschaftliche, soziale und berufliche Eingliederung, damit faktische Gleichstellung
Inhalt: Beratung und Begleitung, sprachliche Förderung ( individuell ) Anreizsystem ohne Sanktionierung
-Kostenverteilung auch auf die Unternehmen / Arbeitgeber
b) Einwanderungsfrage
-dadurch Verzögerung des Demographie - Problems möglich
-Forderung nach Gesetz zur Gestaltung nach wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Gründen, zusätzliche Integration
BDI
a) Einwanderungsfrage
-Problem der Demographie
-systematische Zuwanderungs- und Integrationspolitik
-kurzfristige und pragmatische Übergangslösung ( s. Fachkräftemangel )
Bündnis 90 / Grüne
a) Konzept
3 - Säulen - Modell ( Zuwanderung nach wirtschaftlichen, politisch / humanitären, aus
Rechtsansprüchen entstandenen Gründen )
-bedarfsorientierte flexible Einwanderung
b) Integrationsförderung
-obligatorisches Angebot von Kursen für alle Zuwanderer
-Inhalt: dt. Sprache, politische Grundbildung, Arbeitsmarktkenntnisse Anreizsystem
c) Nichtstaatliche und Geschlechtsspezifische Verfolgung
-Beachtung Genfer Flüchtlingskonvention und Europäischer Menschenrechtskonvention: Schutzbedürftigkeit soll Maßstab sein
d)Einwanderungsfrage
-s. 3 - Säulen - Modell
-Leistungssteigerung Standort Deutschland
CDU
a) Konzept
-„Zuwanderung steuern und begrenzen, Integration fördern.“ Grundsatz: „ Aus- und Fortbildung vor Zuwanderung.“
b) Ziele
-Begrenzung, humanitäre Verpflichtung, Steuerung unter Berücksichtigung nationaler Interessen, Integrationsziele
-Erleichterung für Hoch- und Höchstqualifizierte
-Integrationsbemühungen: Akzeptanz innerhalb Bevölkerung
c) Integrationsförderung
-außer für Höchstqualifizierte, EU-Bürger, Minderjährige: Kurse für deutsche Sprache, Rechtsordnung, deutsche Geschichte und Kultur, Beratung für gesellschaftliche und berufliche Orientierung
-Anreizsystem mit Sanktionierungsmöglichkeiten Kostenselbstübernahme für Zuwanderer
d) Einwanderungsfrage
-Abmilderung des demographischen Problems Leistungsfähigkeit Deutschlands ausbauen
-keine Aufnahme von Wirtschafts- und Armutsflüchtlingen
CSU
a) Statement E. Stoiber vom 20.01.02
-bessere Strukturierung Zuwanderung
-Anwerbestop bei 4 Millionen Arbeitslosen
-Begrenzung von Zuwanderung: erstes Ziel = nationalen Arbeitsmarkt abschöpfen Absenkung des Nachzugsalters
Kommunen und Länder durch Verschuldung: keine finanziellen Mittel für Integrationsleistungen vorhanden
b) Integrationsförderung
Sprachkurse, Vermittlung von Grundkenntnissen der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung Kosten von Unternehmen mitgetragen
c) Nichtstaatliche und Geschlechtsspezifische Verfolgung: Anspruch von Asyl nur bei politischer Verfolgung
d) Einwanderungsfrage
flexibles und praktikables Gesetz nur für Hochqualifizierte, um leistungsfähig zu sein
FDP
a) Konzept
3 - Säulen - Modell ( marktorientierte gesteuerte Zuwanderung, humanitäre Verpflichtung und Integration )
„kleines Asyl“ bei nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung
b) Integrationsförderung
durch Anreizsystem ( ohne Sanktionierung ) geschaffenes Pflichtprogramm von Kursen eventuell Selbsttragen der Kosten
c) Nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung
-„kleines Asyl“: Schutzbedürftigkeit und Opferperspektive
d) Einwanderungsfrage
7
-Ausgleich für Arbeitskräftemangel, dadurch Wirtschaftswachstum und Wohlstandsentwicklung Abmilderung des demographischen Problems
-Handwerk und Mittelstand sollen auch besetzt werden
PDS
a) Konzept
-Deutschland = Einwanderungsland gegen Elite - Rekrutierung
b) Integrationsförderung
-Verpflichtung zu kostenlosen, öffentlich getragenen Kursen Anreizsystem
-Beratung mit individuellen Berufswegplan
c) Nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung asylbegründete Anerkennung
d) Einwanderungsfrage
-einwanderungspolitische Konzeption: Recht des Einzelnen auf Zugang in die BRD
4.Fazit
Grenzen der politischen Gemeinschaft werden vor allem dadurch gezogen, indem man deutlich macht, daß nationale Interessen vor internationalen Interessen stehen. „Auch der dramatische Bevölkerungsrückgang mit seinen absehbaren Folgen für die Sozialsysteme gab der Zuwanderungsdiskussion einen neuen Wert.“
( www. Spiegel.de/politik/deutschalnd/0.1518,148297,00.html; Zuwanderung in Deutschland )
Aber ist es nicht global gesehen wertvoller nationale Interessen hinter internationale Interessen zu stellen, um bspw. weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verbessern, indem man die Protektion in Entwicklungsländern abbaut, damit dort demokratische, marktwirtschaftliche und rechtsstaatliche Strukturen entstehen können, die gleichzeitig Fluchtursachen eindämmen?
5.Literatur
Benhabib, Seyla: Kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit. Politische Partizipation im Zeitalter der Globalisierung. Frankfurt/Main, 2. Auflage 2000
Müller, M. (Hrsg.): Weltgeschichte in Schlaglichtern. Mannheim, 1992
Nuscheler, Franz: Internationale Migration. Flucht und Asyl. Opladen, 1995
Pleticha, Heinrich: Weltgeschichte. Fürstenhöfe und Fabriken. Gütersloh, 1996 Schmidt, Manfred G.: Wörterbuch zur Politik. Stuttgart, 1995 Internetquellen
www. Bpb.de/zuwanderung/zuwanderung.html
www. Datenschutz-berlin.de/gesetze/auslg/auslg.htm
www.bpb.de/zuwanderung/synopse/body_integrationsförderung.html
www.heute.t-online.de/ZDFheute/artikel/0,1251,POL-4926-4865.FF.html
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Der Text befasst sich mit Migration und Flucht in Deutschland und Europa, einschließlich der Ursachen, der Geschichte der Wanderungsbewegungen und der aktuellen Ausländer- und Asylpolitik.
Welche Schub- und Sogfaktoren werden im Zusammenhang mit Migration und Flucht genannt?
Schubfaktoren umfassen Kriege, Repression, Verfolgung von Minderheiten, Umweltkatastrophen, Armut und das Vorhandensein von "jungem Humankapital auf Wanderschaft". Sogfaktoren entstehen in den Zielländern durch das Angebot von Arbeit, Wohlstand und Freiheit.
Wie hat sich Deutschland im Laufe der Zeit von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland entwickelt?
Im 19. Jahrhundert wanderten viele Deutsche aus ökonomischen Gründen, vor allem in die USA, aus. Später wurden Polen und Menschen aus der Donauregion für Arbeiten in Deutschland angeworben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es mehrere Zuwanderungswellen durch Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Gastarbeiter und Flüchtlinge aus Osteuropa.
Welche Positionen vertreten verschiedene Verbände, Institutionen und Parteien zur Ausländer- und Asylpolitik in Deutschland?
Amnesty International fordert die Beachtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Kirchen in Deutschland setzen sich für die Bekämpfung von Fluchtursachen und eine abgestimmte europäische Ausländerpolitik ein. Die Türkische Gemeinde Deutschland betont die Bedeutung der deutschen Sprache für die Integration. Wohlfahrtsverbände und der DGB fordern eine individuelle und umfassende Integrationsförderung. Der BDI sieht die Notwendigkeit einer systematischen Zuwanderungs- und Integrationspolitik aufgrund des demographischen Wandels. Die Parteien Bündnis 90/Die Grünen, CDU, CSU, FDP und PDS vertreten unterschiedliche Konzepte zur Steuerung der Zuwanderung und Integration, wobei die Meinungen über die Begrenzung der Zuwanderung, die Förderung der Integration und die Anerkennung von nichtstaatlicher Verfolgung auseinandergehen.
Welche Rolle spielt der demographische Wandel in der aktuellen Diskussion um Zuwanderung in Deutschland?
Der demographische Wandel und der damit verbundene Bevölkerungsrückgang geben der Zuwanderungsdiskussion eine neue Bedeutung, da sie als Möglichkeit zur Stabilisierung der Sozialsysteme und zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Landes angesehen wird.
Was wird im Fazit über nationale und internationale Interessen gesagt?
Es wird argumentiert, dass die Betonung nationaler Interessen gegenüber internationalen Interessen Grenzen der politischen Gemeinschaft zieht. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es global gesehen wertvoller wäre, nationale Interessen zugunsten internationaler Interessen zurückzustellen, um beispielsweise die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und Fluchtursachen einzudämmen.
Welche Literatur wird in dem Text zitiert?
Der Text zitiert Werke von Seyla Benhabib, M. Müller, Franz Nuscheler, Heinrich Pleticha und Manfred G. Schmidt, sowie verschiedene Internetquellen.
- Citar trabajo
- Melanie Glaewe (Autor), 2002, Zuwanderung - Kontroverse in Gesellschaft und Politik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105833