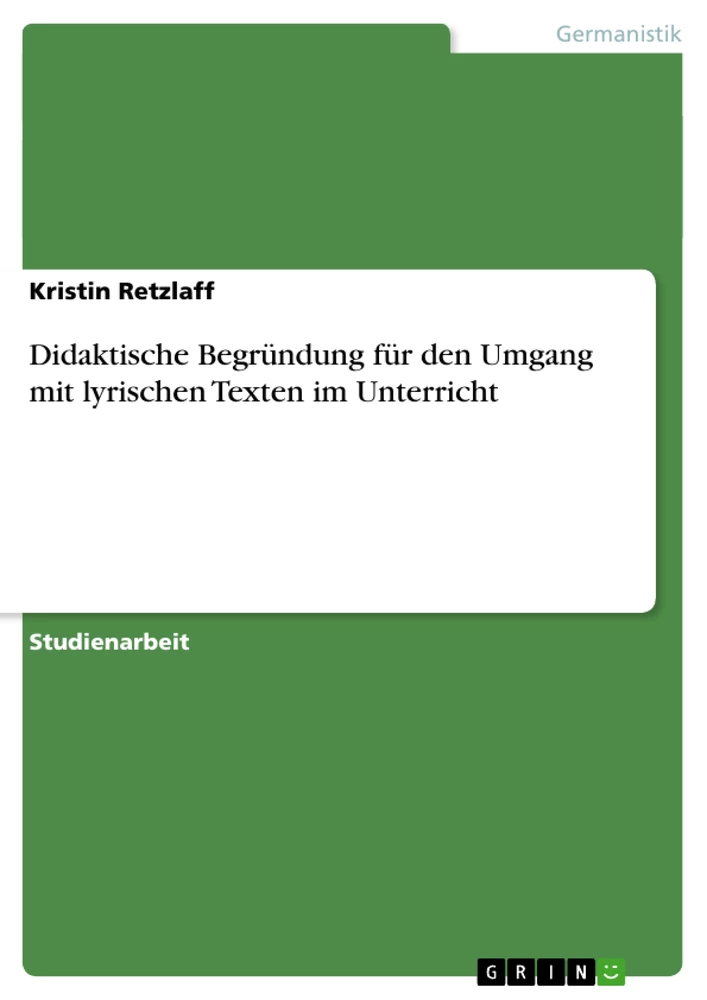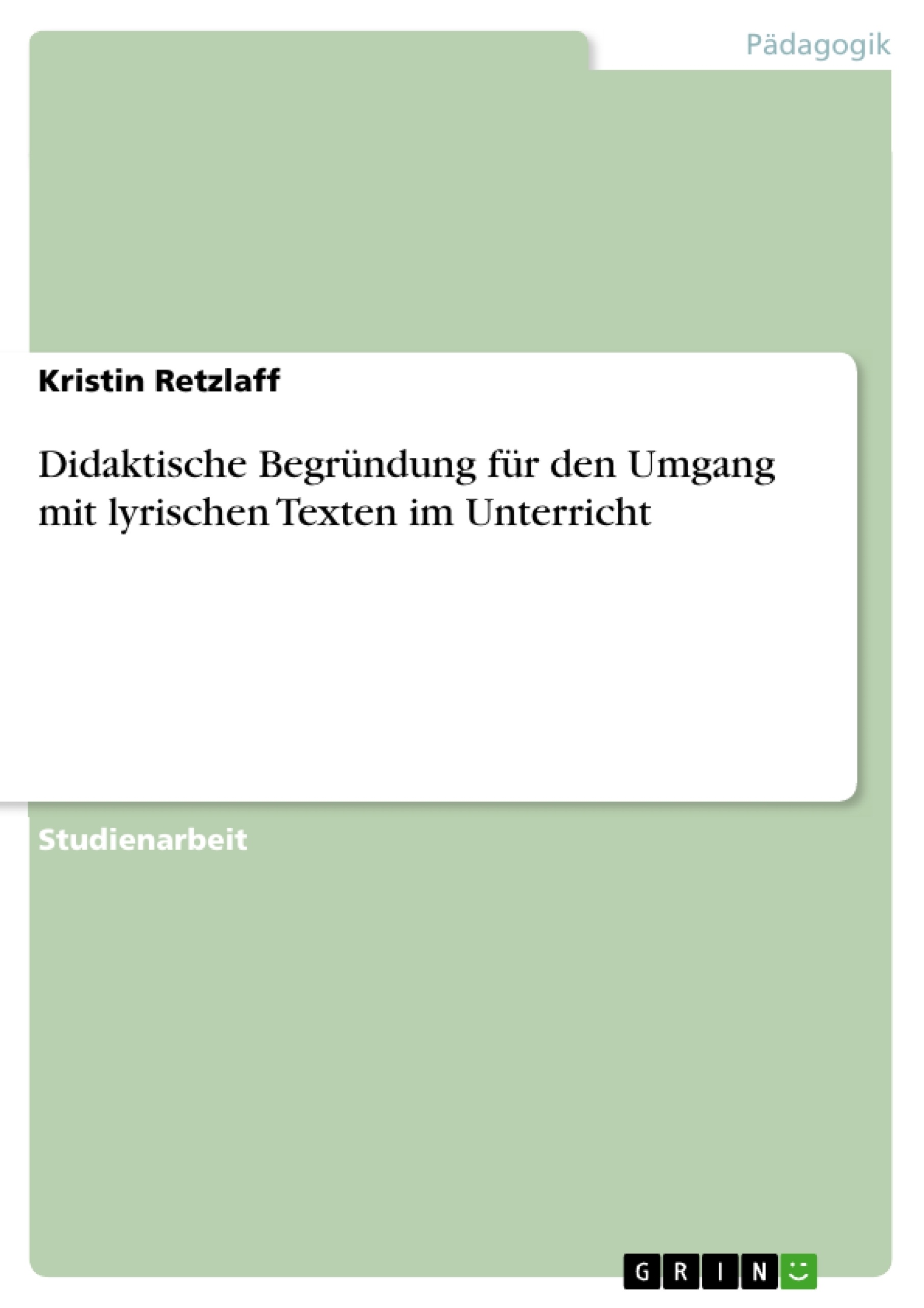Wie erschließt man Schülern die Welt der Lyrik? Diese Frage steht im Zentrum einer umfassenden Auseinandersetzung mit verschiedenen methodischen Modellen zur Interpretation und didaktischen Anwendung von Lyrik im Deutschunterricht. Beginnend mit einem Überblick über etablierte Ansätze, wie dem textgenauen Lesen nach Fingerhut und den Thesen von Paefgen, wird insbesondere das Phasenmodell nach Waldmann detailliert beleuchtet. Dieses Modell gliedert den Interpretationsprozess in Vorphase, Lese- und Aufnahmephase, konkretisierende Aneignung, textuelle Erarbeitung und textüberschreitende Auseinandersetzung, um einen vielschichtigen Zugang zu Gedichten zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung der Schüleraktivität, der Entwicklung eigener Vorstellungskräfte und der analytischen Auseinandersetzung mit Inhalten, Formen und Kontexten lyrischer Werke. Neben der theoretischen Fundierung wird die praktische Anwendung im Unterricht anhand des Magdeburger Modells konkretisiert, welches die Schüler in Phasen der Erstrezeption, vertiefenden Rezeption und Einordnung in übergreifende Zusammenhänge führt. Ziel ist es, eine Abwehrhaltung gegenüber Interpretationen abzubauen, die Leselust zu wecken und den Schülern die Möglichkeit zu geben, eigene lyrische Texte zu verfassen. Dabei wird betont, dass es keine richtigen oder falschen Interpretationen gibt, sondern dass die Haltung und das Können des Lehrers entscheidend sind, um einen Raum für das Gedicht zu schaffen, Verstehenshindernisse zu beseitigen und eine genaue Analyse zu fördern. Methodische Ansätze wie der Vergleich mit motivgleichen Gedichten, die Antizipation und das Selbstschreiben werden vorgestellt, um einen abwechslungsreichen und anregenden Unterricht zu gestalten. Diese Arbeit bietet somit eine fundierte Grundlage für Lehrer, die ihren Schülern einen kreativen,zugänglichen und tiefgründigen Zugang zur Lyrik ermöglichen möchten, wobei stets die individuelle Erfahrung und Auseinandersetzung der Lernenden im Vordergrund steht. Es wird ein Plädoyer gehalten für einen Deutschunterricht, der die Freude am Lesen und Interpretieren weckt und die Schüler dazu ermutigt, ihre eigene Stimme in der Welt der Lyrik zu finden.
Gliederung:
- 1 Einleitung
-
2 Hauptteil
- 2.1 Methodische Modelle
- 2.1.1 Phasenmodell nach Waldmann
- 2.2 didaktische Anwendung der Lyrik im Unterricht
- 2.1 Methodische Modelle
-
3 Schlussteil
- 3.1 Magdeburger Modell
- 3.2 Zusammenfassung
1 Einleitung
Wichtig bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Lyrik und deren didaktischer Anwendung bzw. Begründung erschienen mir 1. die Einordnung von mehreren Modellen, wobei ich speziell auf das Phasenmodell von Waldmann eingehe und 2. die didaktische Anwendung der Lyrik im Unterricht. Im Schlussteil werde ich auf das Magdeburger Modell tiefer eingehen und danach die Didaktik der Lyrik kurz zusammenfassen.
2 Hauptteil
2.1 Methodische Modelle
Die entscheidende Aufgabe des Literaturunterrichts ist es, Schüler zum Verstehen literarischer Texte zu führen. Daraus ergeben sich verschiedene Modelle. Es soll die Abwehrhaltung gegenüber Interpretationen abgebaut werden, indem der Text oft gelesen werden soll und der Schüler selbsttätig werden soll. Historische Kenntnisse bedürfen der Vorgabe des Lehrers, Kenntnisse über Autoren und Epochen sollen je nach Schulstufe erarbeitet werden.
Es werden in der Literatur drei Modelle miteinander verglichen (FINGERHUT/PAEFGEN/WALDMANN).
FINGERHUT stellt textgenaues Lesen in den Vordergrund. Er geht von einem Text - Leser - Verhältnis aus. Es sollen Argumente gesammelt werden, die eine vorher aufgestellte Hypothese stützen. Sekundärinformationen werden zuerst weggelassen und später hinzugefügt.
PAEFGEN teilt das textnahe Lesen in sechs Thesen auf: 1. gründliches, genaues, langsames Lesen; 2. Lernen und Lehren von textnahem Lesen; 3. Textmenge kleinhalten; 4. mehrmaliges Lesen; 5. Lyrik ist am geeignetsten; 6. wenig lesen - viel denken
2.1.1 Phasenmodell nach WALDMANN
Bei Waldmann beginnt die Interpretation eines Textes mit einer Vorphase. Hier wird ein spielhafter Einstieg gesucht, der motivieren, kreativ wirken, intensiver aufgenommen werden kann.
Die 1. Phase betrifft das Lesen und Aufnehmen eines Textes. Dies kann durch gemeinsames Erlesen mit verteilten Rollen, durch lautes Lesen, durch Hörspiele, Mitschnitte, Schallplatte, CD oder durch Videofilme eingeleitet werden.
In der 2. Phase geht es um die konkretisierende subjektive Aneignung von Texten, hier braucht der Schüler eigene Vorstellungskräfte und Phantasien für das Verstehen literarischer Texte, er muss Gelegenheit finden, sich imaginativ in den Text einzubringen durch Rezitieren, szenisches Darstellen von Gedichten (sich in sie hineindichten)
Die 3. Phase nach WALDMANN ist das textuelle Erarbeiten spezifischer literarischer Inhalte, Formen, Formstrukturen, Handlungen, Konflikte, Figuren, Orte und Zeiten. Es sollte analytisch vorgegangen werden.
Um die textüberschreitende Auseinandersetzung geht es in der 4. Phase, die geschichtlichen, gesellschaftlichen und politischen Hintergründe werden offengelegt, die Beziehungen zu anderen Texten und die Biographie des Autors werden genannt.
2.2 didaktische Anwendung der Lyrik im Unterricht
Hilde DOMIN sagt, dass es keine richtigen und falschen Interpretationen gibt, sondern nur intensive und weniger intensive Vollzüge (vgl. DOMIN, 1968, 170). Entscheidend aber ist die Haltung und das Können des Lehrers. Die Vermittlung eines Gedichts bedarf einer leichten Hand. Der Lehrer soll Raum für das Gedicht schaffen, Verstehenshindernisse beseitigen helfen, nicht seine Gesinnung aufdrängen, nicht paraphrasieren, vielmehr auf Genauigkeit und Sauberkeit der gemeinsamen Analyse mit dem Schüler achten.
Ihm stehen methodische Ansätze zur Verfügung, wobei er auch einen Wechsel der Methoden vornehmen soll: vom Druckbild ausgehend (über das Optische), von der Sprechgestalt her, durch Vergleiche mit anderen motivgleichen Gedichten, die Urteile und Wertungen begründen, durch Antizipation, durch Selbstschreiben, usw. Auch die Leselust sollte angeregt werden.
3 Schlussteil
3.1 Magdeburger Modell
Die Teilnahme am Seminar hat mir noch ein weiteres Modell vermittelt, und zwar das Magdeburger Modell. Es beschäftigt sich ebenso mit dem Verstehen und Lesen von Texten. Hier wird sich der Schüler in einer Phase der Erstrezeption spontan des Textes annehmen und ihn aufnehmen (Druckgestalt/Lautgestalt). In der weiteren Phase der vertiefenden Rezeption erfolgt die Arbeit am Text (Dargestelltes/Symbolhaftes). Die Phase der Einordnung in übergreifende Zusammenhänge endet dann schließlich in der Arbeit mit dem Text (Symbolhaftes/Modellhaftes). Dieses Modell kann man auch sehr gut für die Interpretation im Unterricht anwenden.
3.2 Zusammenfassung
Zusammenfassend kann ich feststellen, dass es einige Möglichkeiten der Analyse von Texten, speziell von lyrischen Interpretationen gibt. Welche der Lehrer einsetzt und anwendet, bleibt natürlich ihm überlassen. Er sollte dabei aber beachten, den Schüler nicht zu überfordern, langsam vorzugehen und seine eigene Interpretation außen vor zu lassen. Er sollte dabei möglichst viele Interpretationsmöglichkeiten aufgreifen, einzelnen Analysen nachgehen und die Schüler dazu anregen, selbst lyrische Texte zu schreiben.
Literatur
BEISBART, O./MARENBACH, D.: Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Do- nauwörth 1990
BELGRAD, J./FINGERHUT, K. (Hrsg.): Textnahes Lesen. Annährerungen an Literatur im Unterricht. Hohengehren 1998
LANGE, G./NEUMANN, K./ZIESENIS, W. (Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts. Bd. 2. Hohen- gehren 1990
PAEFGEN, E.: Textnahes Lesen. In: BELGRAD, J./FINGERHUT, K. (Hrsg.): Textnahes Lesen. Annähre- rungen an Literatur im Unterricht. Hohengehren 1998, S. 15-23
SCHUSTER, K: Einführung in die Fachdidaktik Deutsch. 7. Auflage. Hohengehren 1998 SOWINSKI, B. (Hrsg.): Fachdidaktik Deutsch. Böhlau 1980.
WEBER, A.: Lyrik im Unterricht. In: SOWINSKI, B. (Hrsg.): Fachdidaktik Deutsch. Böhlau 1980, S. 329ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text behandelt die didaktische Anwendung von Lyrik im Unterricht, wobei verschiedene methodische Modelle zur Interpretation und Analyse von Gedichten vorgestellt und verglichen werden.
Welche methodischen Modelle werden im Text behandelt?
Der Text vergleicht drei Modelle von FINGERHUT, PAEFGEN und WALDMANN. Besonders hervorgehoben wird das Phasenmodell nach WALDMANN.
Was beinhaltet das Phasenmodell nach WALDMANN?
Das Phasenmodell von WALDMANN besteht aus einer Vorphase (spielerischer Einstieg), gefolgt von vier Phasen: 1. Lesen und Aufnehmen des Textes, 2. Konkretisierende subjektive Aneignung, 3. Textuelles Erarbeiten spezifischer literarischer Inhalte, 4. Textüberschreitende Auseinandersetzung mit historischen, gesellschaftlichen und politischen Hintergründen.
Wie sollte Lyrik im Unterricht didaktisch angewendet werden?
Der Lehrer sollte eine leichte Hand bei der Vermittlung von Gedichten haben, Raum für das Gedicht schaffen, Verstehenshindernisse beseitigen, keine eigene Gesinnung aufdrängen, und auf Genauigkeit und Sauberkeit der gemeinsamen Analyse achten. Er sollte methodische Ansätze wechseln und die Leselust anregen.
Was ist das Magdeburger Modell?
Das Magdeburger Modell ist ein weiteres Modell zum Verstehen und Lesen von Texten. Es umfasst eine Phase der Erstrezeption (spontane Aufnahme), eine Phase der vertiefenden Rezeption (Arbeit am Text) und eine Phase der Einordnung in übergreifende Zusammenhänge (Arbeit mit dem Text).
Welche Literatur wird in Bezug auf die Didaktik der Lyrik genannt?
Die Literaturliste umfasst Werke von BEISBART/MARENBACH, BELGRAD/FINGERHUT, LANGE/NEUMANN/ZIESENIS, PAEFGEN, SCHUSTER, SOWINSKI, WEBER und WALDMANN.
- Quote paper
- Kristin Retzlaff (Author), 2002, Didaktische Begründung für den Umgang mit lyrischen Texten im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105885