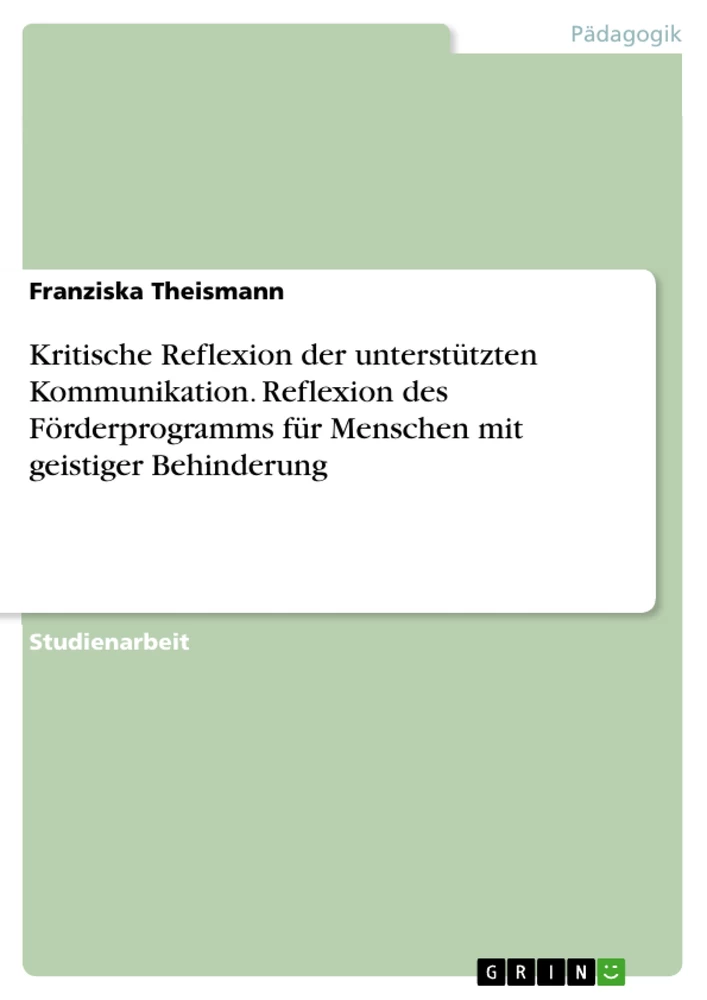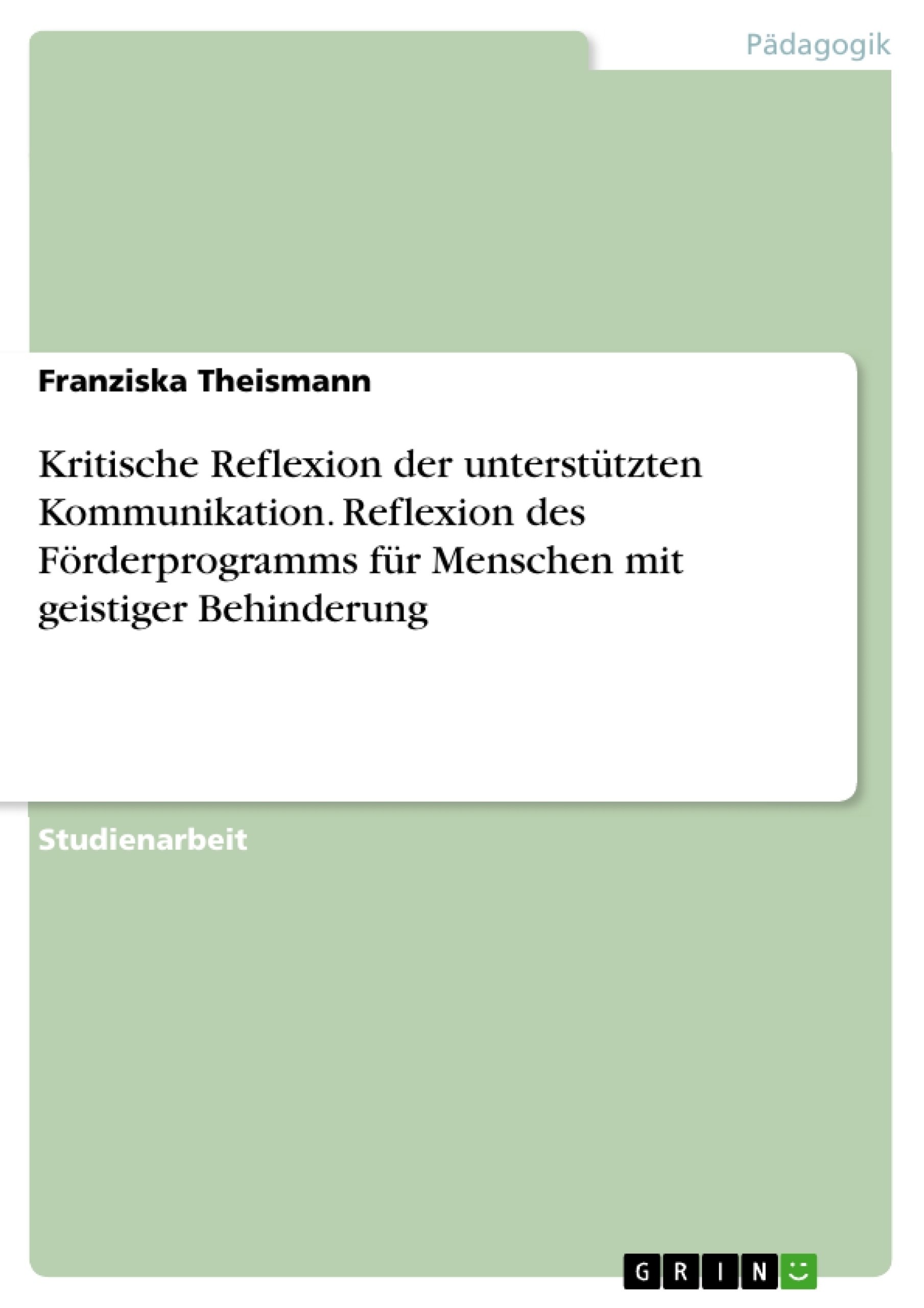In der Hausarbeit wird das Hilfsmittel unterstützte Kommunikation zunächst vorgestellt und im Anschluss kritisch reflektiert. Es werden verschiedene Zielgruppe sowie Formen mit eingebunden.
Wenn eine Person körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigt ist oder ihr eine (Schwer-)Behinderung droht, hat dieser Mensch ein Recht auf erforderliche Hilfe. Den Menschen wird geholfen, ihren entsprechenden Platz in der Gesellschaft sowie die Teilhabe am Arbeitsleben zu sichern. Die sozialrechtlichen Regelungen sind laut des neunten Buches des Sozialgesetzbuches im Jahr 2001 fortentwickelt worden. Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten nach diesem Buch Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern und ihren Benachteiligungen entgegenzuwirken (ebd.). Dazu gehören auch Beeinträchtigungen im Bereich der lautsprachlichen Kommunikation. Sprachlich-kommunikative Einschränkungen haben umfangreiche negative Folgen und beeinträchtigen die Lebensqualität der betroffenen Menschen enorm. Es entstehen Probleme wie Missverständnisse, problematische Verhaltensweisen, Frustrationen oder Gefühle wie Isolation.
Diese negativen Folgen können durch verschiedene unterstützte Kommunikationsformen vermieden werden. Zu den Methoden der unterstützten Kommunikation gehören körpereigene und körperfremde Kommunikationsmöglichkeiten, welche individuell auf die Person abgestimmt werden, sodass diese sich ebenfalls wirksam mitteilen können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DEFINITIONEN
- DEFINITION KOMMUNIKATION
- DEFINITION BEHINDERUNG
- DEFINITION BEEINTRÄCHTIGUNG
- DEFINITION SCHWERBEHINDERUNG
- KOMMUNIKATION ALS GRUNDRECHT
- UNTERSTÜTZE KOMMUNIKATION
- KOMMUNIKATIONSFORMEN
- KÖPEREIGENE KOMMUNIKATIONSFORMEN
- KÖRPERFERNE KOMMUNIKATIONSFORMEN
- NICHT-ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATIONSHILFEN
- ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATIONSHILFEN
- UNTERSTÜTZE KOMMUNIKATION WIRD AUS UNTERSCHIEDLICHEN GRÜNDEN BENÖTIGT
- UK ALS AUSDRUCKSMITTEL
- UK ZUR UNTERSTÜTZUNG DES SPRACHERWEBS ODER WIEDERERWEBS
- UK ALS ERSATZSPRACHE
- AUSWERTUNG SINNHAFTIGKEIT DER UNTERSTÜTZTEN KOMMUNIKATION
- VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS GELINGEN DER UNTERSTÜTZTEN KOMMUNIKATION
- VORTEILE UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION
- GRENZEN DER UK
- PRAXISBEZUG UND FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und reflektiert kritisch das Konzept der Unterstützten Kommunikation (UK), eine entscheidende Methode zur Förderung von Kommunikation und Teilhabe bei Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen. Die Arbeit befasst sich mit den verschiedenen Facetten der UK, von ihren Definitionen und theoretischen Grundlagen bis hin zu ihren praktischen Anwendungen und Grenzen.
- Definitionen von Kommunikation, Behinderung, Beeinträchtigung und Schwerbehinderung im Kontext von Unterstützter Kommunikation
- Rechtliche Grundlagen und ethische Aspekte der Unterstützten Kommunikation
- Verschiedene Formen der Unterstützten Kommunikation und ihre Einsatzgebiete
- Vorteile und Grenzen der Unterstützten Kommunikation
- Praxisbezogene Beispiele und Herausforderungen in der Anwendung der Unterstützten Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Unterstützten Kommunikation ein und beleuchtet die Bedeutung von Kommunikation für Lebensqualität und Teilhabe. Es wird auf die Problematik von sprachlichen Beeinträchtigungen eingegangen und die Notwendigkeit von Unterstützter Kommunikation hervorgehoben.
- Definitionen: Hier werden die zentralen Begriffe der Arbeit definiert, darunter Kommunikation, Behinderung, Beeinträchtigung und Schwerbehinderung. Es wird die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext von Unterstützter Kommunikation erläutert.
- Kommunikation als Grundrecht: Dieses Kapitel behandelt die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Bedeutung für die Förderung von Inklusion und Teilhabe. Die Konvention sieht die Unterstützte Kommunikation als ein Grundrecht an und betont die Notwendigkeit, allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
- Unterstütze Kommunikation: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Unterstützten Kommunikation und erläutert ihre Bedeutung für Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen. Es werden verschiedene Formen der UK vorgestellt und ihre Einsatzgebiete erläutert.
- Kommunikationsformen: Hier werden verschiedene Kommunikationsformen, die in der Unterstützten Kommunikation eingesetzt werden, vorgestellt und eingeteilt. Es werden sowohl körpereigene als auch körperferne Kommunikationsformen, sowie elektronische und nicht-elektronische Hilfsmittel erläutert.
- Unterstütze Kommunikation wird aus unterschiedlichen Gründen benötigt: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Gründe, warum Menschen Unterstützte Kommunikation benötigen. Es werden die Einsatzmöglichkeiten der UK zur Unterstützung des Spracherwerbs, als Ausdrucksmittel und als Ersatzsprache vorgestellt.
- Auswertung Sinnhaftigkeit der Unterstützten Kommunikation: Dieses Kapitel analysiert die Voraussetzungen, Vorteile und Grenzen der Unterstützten Kommunikation. Es wird untersucht, unter welchen Bedingungen die UK erfolgreich eingesetzt werden kann, und welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Unterstützte Kommunikation, Kommunikation, Behinderung, Beeinträchtigung, Schwerbehinderung, Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung, Lebensqualität, Spracherwerb, Kommunikationsformen, Kommunikationshilfen, Augmentative and Alternative Communication (AAC), Praxisbezug und Evaluation.
- Quote paper
- Franziska Theismann (Author), 2021, Kritische Reflexion der unterstützten Kommunikation. Reflexion des Förderprogramms für Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1059890