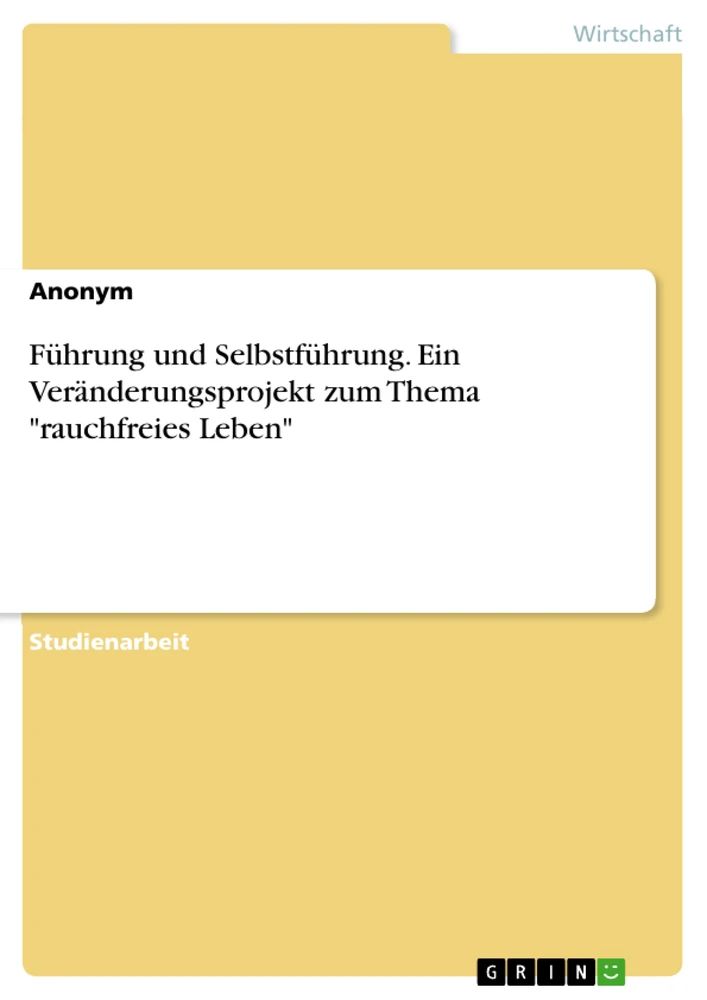Die vorliegende Hausarbeit beinhaltet die Theorie, Planung, Handlung und Abweichung des Veränderungsprojekts rauchfreies Leben. Da die Selbstbeeinflussung und -optimierung eine immer essentiellere Rolle für den unternehmerischen Erfolg spielt, sollen anhand dieses Projekts das Selbstmanagement und Self-Leadership Kompetenzen analysiert und erweitert werden. Im Fokus steht dabei insbesondere der resultierende Lernprozess. Die Führung und Selbstführung gewinnt vor allem vor dem Hintergrund der VUCA Anforderungen immer weiter an Bedeutung, um auftretende Herausforderungen zu bewältigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Hinführung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Grundlagen des Zigarettenkonsums
- Begriffsdefinition und allgemeine Fakten
- Suchtpotenzial und Rauchentwöhnung
- Grundlagen zur verwendeten Methode
- Das transtheoretische Modell
- Die sechs Stufen des transtheoretischen Modells
- Zusammenfassung und kritische Reflexion
- Grundlagen des Zigarettenkonsums
- Methode und Ergebnisse
- Zielformulierung
- Theoriebezogene Analyse
- Aktuelles Konsumverhalten
- Veränderungsplan
- Durchführung
- Abweichungsanalyse
- Kritische Reflexion
- Schlussfolgerungen für das künftige Vorgehen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Veränderungsprojekt „rauchfreies Leben“ und untersucht die Theorie, Planung, Handlung und Abweichung dieses Projekts. Der Fokus liegt auf der Analyse und Erweiterung von Selbstmanagement- und Self-Leadership-Kompetenzen im Kontext des persönlichen Lernprozesses. Diese Kompetenzen gewinnen im Hinblick auf die Herausforderungen der VUCA-Welt immer mehr an Bedeutung.
- Die Theorie des Zigarettenkonsums und seine Auswirkungen
- Die Anwendung des transtheoretischen Modells als Methode der Verhaltensänderung
- Die Planung und Umsetzung eines Veränderungsplans zur Rauchentwöhnung
- Die Analyse von Abweichungen und der daraus resultierende Lernprozess
- Schlussfolgerungen für das künftige Vorgehen im Bereich des Selbstmanagements und der persönlichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Veränderungsprojekt „rauchfreies Leben“ vor und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen, darunter die Definition des Zigarettenkonsums, sein Suchtpotenzial und die Methode der Verhaltensänderung, das transtheoretische Modell. Kapitel 3 widmet sich der Methode und den Ergebnissen des Projekts, inklusive der Zielformulierung, der theoriebezogenen Analyse des aktuellen Konsumverhaltens, dem Veränderungsplan und der Durchführung. Kapitel 4 beinhaltet eine kritische Reflexion des Projekts.
Schlüsselwörter
Zigarettenkonsum, Rauchentwöhnung, Selbstmanagement, Self-Leadership, transtheoretisches Modell, Veränderungsprojekt, VUCA-Welt, Lernprozess, Abweichungsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Projekts 'rauchfreies Leben'?
Ziel ist die Analyse und Erweiterung von Selbstmanagement- und Self-Leadership-Kompetenzen anhand einer persönlichen Verhaltensänderung (Rauchentwöhnung).
Welches psychologische Modell wird angewendet?
Es wird das Transtheoretische Modell (TTM) mit seinen sechs Stufen der Verhaltensänderung genutzt.
Was bedeutet VUCA in diesem Zusammenhang?
VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. In dieser Welt wird Selbstführung immer wichtiger, um flexibel auf Herausforderungen zu reagieren.
Wie wird der Erfolg des Projekts gemessen?
Der Erfolg wird durch eine theoriebezogene Analyse des Konsumverhaltens, einen Veränderungsplan und eine abschließende Abweichungsanalyse bewertet.
Welche Rolle spielt die Selbstführung für den Unternehmenserfolg?
Selbstoptimierung und Selbstbeeinflussung gelten als essenzielle Kompetenzen, um in modernen Arbeitsumgebungen leistungsfähig und gesund zu bleiben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Führung und Selbstführung. Ein Veränderungsprojekt zum Thema "rauchfreies Leben", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1060085