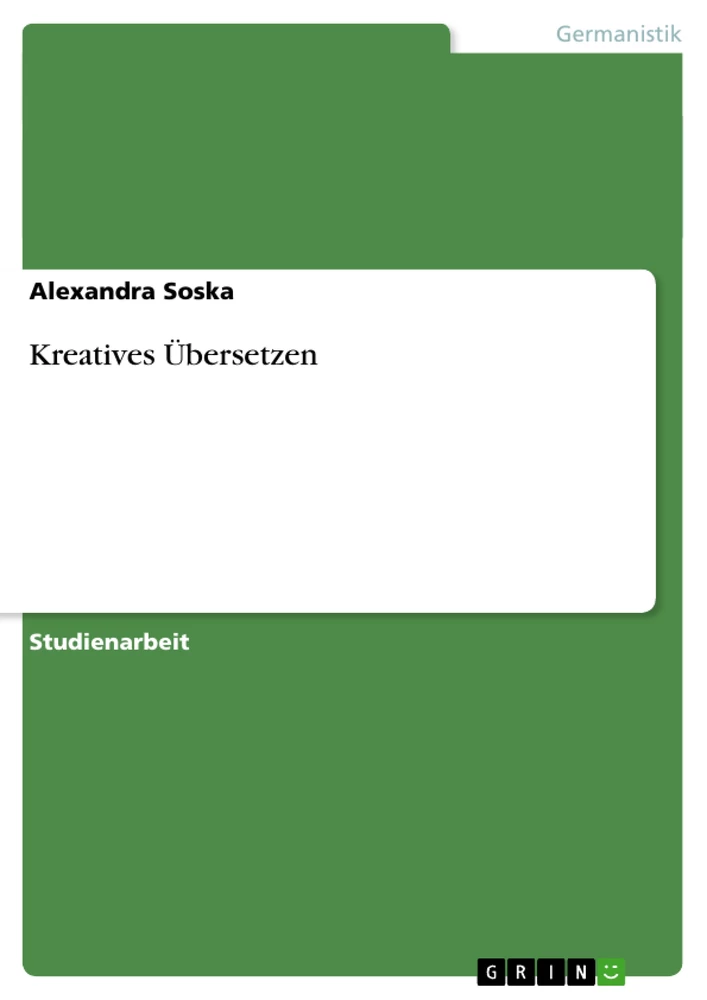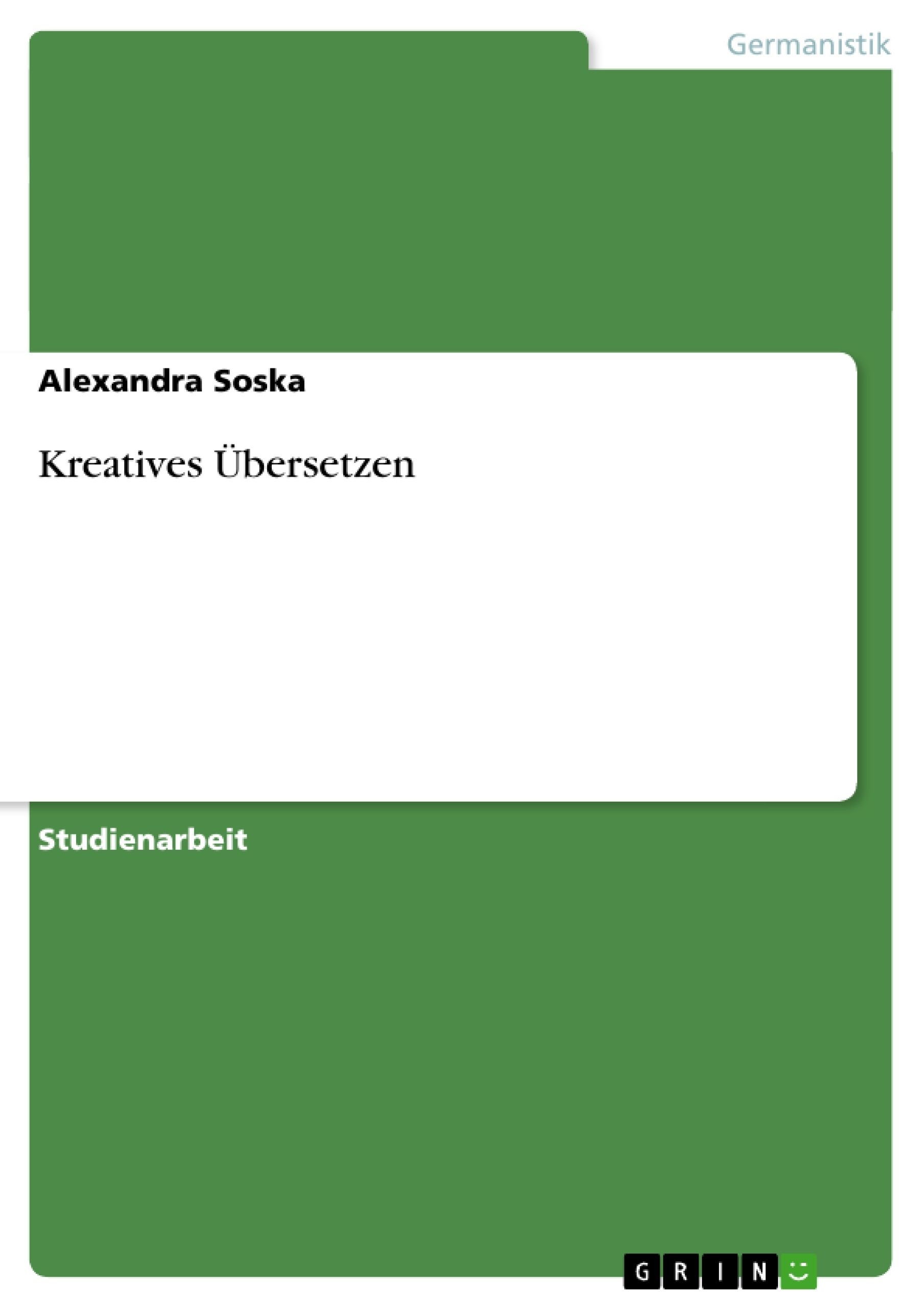Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsklärung
3. Modelle kreativen Denkens
3.1 Das Vierphasenmodell
3.1.1 Präparation
3.1.2 Inkubation und Illumination
3.1.3 Illumination und Evaluation
3.2 Laterales Denken, Perspektive und Fokus
3.2.1 Laterales Denken
3.2.2 Perspektive
3.2.3 Die Figur-Grund-Gliederung
3.3 Prototypen, Rahmen und Szenen
3.3.1 Die Prototypensemantik
3.3.2 Die Scenes-and-frames Semantik
3.4 Gedankensprünge
3.4.1 Alternativen
3.4.2 Verkettungen
3.4.3 Das dynamische Gedächtnis
4. Typen des kreativen Denkens: Anwendungsbeispiele
4.1 Rahmenwechsel
4.2 Neurahmung
4.3 Auswahl von Szenenelementen innerhalb eines Rahmens
4.4 Auswahl von Szenenelementen innerhalb einer Szene
4.5 Szenenwechsel
4.6 Szenenerweiterung
4.7 Einrahmung
5. Evaluation und Anwendung im Übersetzungsunterricht
6. Schlussbemerkungen
1. Einleitung
Unaufhörlich sann ich Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte zu merken begann: „Die Gerechtigkeit Gottes wird seines Glaubens le- ben.“ Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche Gerechtigkeit zu begreifen, durch die der Mensch als durch Gottes Geschenk lebt - also „aus Glauben“. Durch das Evangelium Gottes wird „passive“ Gerechtigkeit offen- bar, durch die er uns aus Gnade und Barmherzigkeit rechtfertigt. Da fühlte ich mich völlig neugeboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan; ich war in das Pa- radies eingetreten. 1
Dieses Zitat stammt von Martin Luther. Es zeigt, wie er ein neues Verständnis für den Begriff „Gerechtigkeit“ entwickelt. Dieses neue Verständnis führt später auch zu seiner Bibelübersetzung und zur Reformation. Kußmaul führt dieses Beispiel an, um zu zeigen, dass zum Übersetzen auch eine gewisse Portion Selbstbewusstsein und Mut gehört, denn Luther stieß mit seiner Übersetzung, also seinem Verständnis, auf großen Widerstand. Trotzdem verteidigte er seine Arbeit und war schließlich auch erfolgreich damit. Kußmaul meint, dass Luthers Verständnis und seine Übersetzung kreativ war, weil sie neu für die Zeit war.
Doch kann Übersetzen kreativ sein? Und was ist Kreativität eigentlich genau? Diesen Fragen geht Paul Kußmaul in seinem Buch „Kreatives Übersetzen“ nach. Die meisten Menschen sehen im Übersetzen wohl keine kreative Tätigkeit, denn man hat ja schon einen Text, den man dann einfach nur in einer anderen Sprache aufzuschreiben braucht. Außerdem sei Kreativität doch nicht fassbar, eher ein unerklärliches Phänomen. Kußmaul widerspricht dem. Er möchte mit seinem Buch zeigen, dass Übersetzen sehr wohl eine kreative Tätigkeit ist, die man be- schreiben und damit auch lehren und erlernen kann. Dadurch möchte er den Beruf des Übersetzers aufwerten, da ihm seiner Meinung nach viel zu wenig Anerken- nung zuteil wird. Dabei möchte er auch aufzeigen, dass Kreativität bei der Über- setzung verschiedener Textsorten eine Rolle spielt und nicht nur, wie man viel- leicht meinen könnte, bei literarischen Texten. Das Buch ist gleichermaßen für Dozenten und Studenten gedacht, denen es als Anleitung zum kreativen Denken und Übersetzen dienen soll.
Seine theoretische Grundlage bildet der funktionalistische Ansatz der Skopostheo- rie, da diese nach seiner Ansicht den meisten Spielraum für kreatives Übersetzen gewährt. Um geeignete Modelle und Strategien des kreativen Übersetzens darstel- len zu können, verwendet er Erkenntnisse aus der Kreativitäts- und der Kogniti- onsforschung. Damit möchte er zeigen wie kreatives Übersetzen funktioniert und welche mentalen Prozesse dabei ablaufen. Dies erläutert er anhand von Überset- zungsprodukten, also dem Vergleich von Ausgangs- und Zieltext, und Überset- zungsprozessen, d.h. in Form von Protokollen des lauten Denkens (LD- Protokollen) und Unterrichtsprotokollen, welche die Lösungsfindung seiner Stu- denten während des Unterrichts darstellen.2
Mit dieser Arbeit möchte ich die Theorie Kußmauls vorstellen und sie anhand von französischen Textbeispielen und ihrer deutschen Übersetzung erläutern.
2. Begriffsklärung
Kußmaul legt seinen Ausführungen3 folgende Definition zugrunde:
Eine kreative Übersetzung entsteht aufgrund einer obligatorischen Verände- rung des Ausgangstexts, und sie stellt etwas mehr oder weniger Neues dar, das zu einer bestimmten Zeit und in einer (Sub-) Kultur von Experten (= von Vertretern eines Paradigmas) im Hinblick auf einen bestimmten Verwen- dungszweck als mehr oder weniger angemessen akzeptiert wird.
Bei dieser Definition geht Kußmaul davon aus, dass man beim Übersetzen auf- grund einer Problemerkenntnis etwas Neues schafft, das angemessen ist und von der Mehrheit akzeptiert wird. Dabei sind Neuheit und Angemessenheit keine fest- stehenden Größen, sonder vielmehr graduierbar, was Kußmaul das Mehr-oder- weniger-Prinzip nennt.
Kußmaul stellt die These auf, dass eine Übersetzung immer, mehr oder weniger, neu sei, da man immer gezwungen sei, im Zieltext gegenüber dem Ausgangstext etwas zu verändern. Besonders deutlich wird dies bei idiomatischen Wendungen, Anspielungen, Wortspielen und Wortschöpfungen. Bei diesen Erscheinungen sind wörtliche Übersetzungen selten möglich, so dass man zu Verfahren wie der Para- phrase greifen muss, um den Text den Erwartungen der Zielkultur entsprechend zu gestalten.
Doch eine Übersetzung darf nicht nur neu sein, sie muss in den Augen der Adres- saten auch angemessen sein, d.h. sie muss z.B. dem Übersetzungsauftrag entspre- chen.
Was angemessen ist, entscheidet dann meist eine Gruppe von Experten. Diese treffen ihre Entscheidung in Abhängigkeit von der Zeit und dem Raum, in dem sie leben. So kommt es auch, dass heute gewisse Kunstwerke als besonders kreative Leistungen gefeiert werden, die in ihrer Zeit gar nicht oder nur verachtend betrachtet wurden. So auch Luthers Bibelübersetzung, da sie der Meinung der katholischen Kirche zu dieser Zeit stark widersprach.
Neuigkeit und Angemessenheit stehen allerdings in einem gewissen Widerspruch, denn je neuer eine Übersetzung ist, desto unangemessener ist sie meist und umge- kehrt ist es auch oft so, dass eine Übersetzung zwar äußerst angemessen, dafür aber nicht sehr neu ist. Hier ist wieder der quantitative Faktor der beiden Merkma- le einer kreativen Übersetzung von Bedeutung. Keines von beiden ist absolut, daher können auch immer mehr oder weniger kreative Übersetzungen zustande kommen.
3. Modelle kreativen Denkens
3.1 Das Vierphasenmodell
Um die mentalen Prozesse bei Übersetzen,4 durch die etwas Neues und daher Kre- atives entsteht, zu verdeutlichen, verwendet Kußmaul verschiedene Modelle aus der Psychologie und der Sprachwissenschaft. Dabei legt er keinen Wert auf Voll- ständigkeit, sondern stellt vor allem die Modelle vor, die seiner Ansicht nach für das Übersetzen am relevantesten sind und bei denen sich Kreativitätsforschung und Kognitionslinguistik überschneiden. Für ihn ist dabei die kreative Verarbei- tung von Sprache etwas ganz Normales, das keiner „Eingebung“ bedarf, sondern durch bestimmte Denkprozesse herbeigeführt werden kann.
Das erste Modell, das gewissermaßen die Abschnitte beim kreativen Denken beschreibt, ist das Vierphasenmodell. Diesem Modell zufolge läuft kreatives Übersetzen in den vier Phasen Präparation, Inkubation, Illumination und Evaluation ab. Diese werde ich im Folgendem erläutern.
3.1.1 Präparation
In der Vorbereitungs- oder auch Verstehensphase wird man sich des Überset- zungsproblems bewusst. Man versucht den Ausgangstext zu verstehen, indem man sein bereits erworbenes Wissen einsetzt oder dieses durch Recherche erwei- tert. Es wird die Übersetzungsfunktion im Hinblick auf den Übersetzungsauftrag geklärt und auch der Ausgangstext selbst analysiert, wodurch schon erste Hypo- thesen aufgestellt werden können, die aber später noch auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden müssen.
In dieser Phase sind die sogenannten Top-down bzw. Bottom-up Prozesse von Bedeutung. Bei Top-down Prozessen werden die persönlichen Erfahrungen und das Vorwissen angewandt, um den Text zu verstehen. Bei Bottom-up Prozessen ist die Analyse des Ausgangstextes und dessen Informationsinhalt die Grundlage des Verstehensprozesses. Beim Übersetzen kommen beide Prozesse gleicherma- ßen zur Anwendung.
Kußmaul stellt nun die These auf, dass diese Verstehensprozesse auch schon krea- tiv sein können, so wie z.B. das neue Verständnis von Gerechtigkeit bei Martin Luther.
Verstehen wird als das Zusammenspiel von Text und Vorwissen definiert. Durch bestimmte sprachliche Formen wird auch ein bestimmtes Wissen aktiviert. Da die Bedeutungen der sprachlichen Formen nicht feststehen, sondern je nach Kontext und Situation verschieden sein können, bleibt Kußmaul zufolge auch Raum für Kreativität, wenn das aus dem Gedächtnis hervorgerufene Wissen in Worte ge- fasst wird. Vor allem, wenn mehre Interpretationen möglich sind, kann schon das Verstehen kreativ sein. Der Definition einer kreativen Leistung zufolge, muss das Verstandene dann natürlich auch angemessen sein und akzeptiert werden.
Auch das Verstehen hängt natürlich wieder mit dem Raum und der Zeit zusam- men, in der man lebt. Hier führt Kußmaul den Begriff der relecture, der von Eu- gen Biser geprägt wurde, an. Dieser sagt aus, dass man einen Text aufgrund neuer Erlebnisse und Erfahrungen zu einem späteren Zeitpunkt anders verstehen kann, als man es vielleicht anfangs getan hat. Die Grundlage für ein neues Verständnis sind Achtsamkeit und Offenheit im Gegensatz zur Routine, d.h. der bereits be- kannten Verstehensweise.
Kußmaul betont das kreative Verstehen, denn seiner Meinung nach führt ein kreatives Verständnis später auch zu einer kreativen Übersetzung.
3.1.2 Inkubation und Illumination
Während der Inkubationsphase wird das vorhandene Wissen kombiniert, wobei die Denkprozesse eher unbewusst ablaufen. Es entstehen Assoziationen, die dann zur Illumination, also der Lösung führen. Man kann die mentalen Vorgänge, die zum Übersetzungsvorschlag führen nicht direkt beobachten. In den von Kußmaul aufgeführten Dialogprotokollen äußert sich die Phase kurz vor der Illumination oft durch Pausen. Allerdings kann man in den Dialogprotokollen die verschiede- nen Stufen beobachten, die zu einer Idee führen, d.h. was vor bzw. nach der Illu- mination geschieht und somit auf kreative Vorgänge schließen. Diese zeigen sich z.B. in der Flüssigkeit des Denkens, d.h. wenn in kurzen Zeit viele verschiedene Gedanken im Hinblick auf das Problem geäußert werden.
Wenn es zu keiner Lösung kommt, nennt man dies eine mentale Blockade. Denk- blockaden entstehen oft in Stresssituationen, können aber durch bestimmte Tätig- keiten, wie z.B. etwas zu essen oder einen Spaziergang, überwunden werden. Man beschäftigt sich mit etwas anderem, aber unbewusst arbeitet das Gehirn an dem Übersetzungsproblem weiter und dann kommt man plötzlich zu einer Lösung. Auch Emotionen können Blockaden hervorrufen. Wenn man entspannt ist, fällt das Übersetzen natürlich viel leichter, als wenn man sich ärgert oder sehr wütend ist. Die Illumination ruft schließlich auch positive Gefühle hervor, da man zufrie- den ist, eine Lösung gefunden zu haben, auch wenn sich einem vielleicht nicht gleich die „Tore zum Paradies“ öffnen, wie Luther.
3.1.3 Illumination und Evaluation
In der Evaluationsphase werden schließlich die gefundenen Lösungen auf ihre Angemessenheit überprüft. Dann werden sie entweder akzeptiert oder verworfen und es wird wieder nach einer neuen Lösung gesucht. Die verschiedenen Phasen können hierbei nicht getrennt werden. Um eine gewisse Distanz zur eigenen Ü- bersetzung zu bekommen, muss nach der Lösungsfindung auch immer gleich eine Überprüfung stattfinden. Einmal, um weniger angemessene Lösungen zu erken- nen, aber auch um gute Ideen festzuhalten. Da unser Denken auf Sprache aufbaut, aber unser Produkt, also die Übersetzung, auch aus Sprache besteht, kann das, was man verstanden hat oft schon, wenn es in Worte gefasst wird, die Überset- zung sein, die man dann aber auch wieder einer Evaluation unterziehen muss. Kußmaul stellt dies folgendermaßen graphisch dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1
3.2 Laterales Denken, Perspektive und Fokus
3.2.1 Laterales Denken
Laterales oder auch divergentes Denken steht5 im Gegensatz zu vertikalem bzw. konvergentem Denken. Diese Einteilung übernimmt Kußmaul von dem Kreativi- tätsforscher Edward de Bono. Beim vertikalen Denken gibt es immer nur eine richtige Lösung. Daher ist es auch nicht sehr kreativ. Es kommt im Vierphasen- modell in der Präparations- und in der Evaluationsphase zur Anwendung, wenn nach einer möglichen Interpretation gesucht wird bzw. die gefundene Übersetzung kritisch überprüft werden muss. Laterales Denken ist hingegen ein sprunghaftes Denken, es erlaubt mehrere verschiedene Lösungen und Wege. Es ist eine der Hauptvoraussetzungen für kreatives Übersetzen und findet hauptsächlich in der Inkubations- und Illuminationsphase statt. Um lateral Denken zu können, muss man oft andere Ansatzpunkte einnehmen, um so einen neuen Blickwinkel auf das Problem einnehmen zu können. Dabei ist der Ansatzpunkt der „Teil einer Situati- on oder eines Problems, der zuerst beachtet wird.“ Ein einfaches Beispiel für ei- nen veränderten Ansatzpunkt wäre, wenn man eine positive Aussage in eine nega- tive umwandelt oder umgekehrt.
3.2.2 Perspektive
Ein neuer Ansatzpunkt eröffnet also neue Perspektiven auf ein bestimmtes Problem. Kußmaul veranschaulicht dies u.a. mit folgendem Bild:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2
Je nach dem, welche Perspektive man einnimmt, geht der Würfel entweder nach oben rechts oder nach unten links. Zuerst sieht man wahrscheinlich das Bekannte, also die erste der beiden Varianten. Doch wenn man sich ein wenig konzentriert, kann man auch die zweite sehen. Es ist allerdings oft schwer eine neue Perspektive zu finden. Und dies gilt nicht nur für den Würfel, sondern auch für das Übersetzen. Nimmt man eine neue Perspektive in Bezug auf einen Text ein, so kann das die Übersetzung erheblich beeinflussen, denn durch einen neue Blickwinkel kann sich auch das Verstehen verändern. Dies ist wieder abhängig von Zeit und Kultur oder auch der vorherrschenden Ideologie.
Beim kreativen Übersetzen nimmt man eine andere Perspektive ein als allgemein üblich. So sieht man andere oder zusätzliche Seiten eines Problems, die dann zur Lösung beitragen. Dazu ist es oft nicht einmal nötig einen neuen Ansatzpunkt zu wählen. Meist reicht es, einfach die Blickrichtung ein wenig zu verändern, um einen neuen Aspekt zu erkennen. Diesen neuen Aspekt kann man auch einen neuen Brennpunkt oder Fokus nennen.
3.2.3 Die Figur-Grund-Gliederung
Im Zusammenhang mit den Begriffen Perspektive und Fokus stellt Kußmaul die Theorie der Figur-Grund-Gliederung von Ronald Langacker vor. Mit Grund ist der Hintergrund gemeint. In einem Bild wäre das die größere Fläche im Vergleich zu den kleineren. Die Figur ist kleiner und rückt dadurch in den Vordergrund. In der Sprache geschieht dies z.B. durch deiktische Formen. Wenn man z.B. sagt „Ich lese gerade dieses Buch.“, dann wird das Buch durch das Demonstrativpro- nomen in den Vordergrund gerückt, also fokussiert, während alle anderen Bücher, die vielleicht noch in der Nähe sind, im Hintergrund bleiben. Auch wenn in einem Text die Personalpronomen „ich“ oder „du“ auftreten, rücken diese in den Vor- dergrund, während alle anderen Personen in den Hintergrund treten. Wenn derar- tige Formen in einem Text vorkommen, wird es schwer, auf den Hintergrund zu achten, da diese Formen fast unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Doch um kreativ übersetzen zu können, muss man diesen Hintergrund, also den Kontext eines Textes, genauer betrachten, so dass eine Fokusveränderung möglich wird. Diese bewirkt dann, dass wir ein anderes Merkmal aus dem Kontext als Überset- zung auswählen und dadurch in den Vordergrund rücken.
Dies geschah z.B. bei der Übersetzung des Filmtitels „Le grand bleu“. In diesem Film geht es um zwei Apnoetaucher, die einen Wettkampf veranstalten, um he- rauszufinden, wer von ihnen länger und tiefer tauchen kann. Im Deutschen heißt der Film „Im Rausch der Tiefe“. Der französische Titel rückt das Element, um das es im Film im geht, also das Wasser und den weiten Ozean in den Vordergrund. Die deutsche Übersetzung nimmt eine neue Perspektive ein. Sie blickt auf die Handlung des Films, die beiden Männer und ihren Wettbewerb. Der Übersetzer hat also aus dem Hintergrund, der Handlung des Films, ein anderes Merkmal fo- kussiert und es somit in den Vordergrund gerückt. Das Element des Ozeans bliebt zwar implizit im Titel erhalten, doch wurden die Elemente neu gewichtet.
3.3 Prototypen, Rahmen und Szenen
3.3.1 Die Prototypensemantik
Hierbei geht es um Wortbedeutungen,6 denen aber kein Kontext zugeordnet wird. Sie geht davon aus, dass unser Denken stark durch Erfahrungen und Erlebnisse bestimmt ist. Das typische Beispiel ist wohl das des Vogels. Was stellen wir uns vor, wenn wir das Wort „Vogel“ hören? Wahrscheinlich einen Spatz oder ein Rotkehlchen, jedoch weniger Hühner oder Pinguine, obwohl auch dies Vögel sind. Das hängt damit zusammen, dass man einem Vogel im Allgemeinen gewisse charakteristische Merkmale zuordnet, vor allem das Merkmal, dass ein Vogel fliegen kann. Man kann sagen, dass diese Eigenschaft im Kern über unsere Vor- stellung über einen Vogel liegt. Andere Eigenschaften, wie das Eierlegen oder dass ein Vogel Federn hat, befinden sich dann eher an den unscharfen Rändern unserer Vorstellung. Die Begriffe Kern und R ä nder sind die zentralen Begriffe der Prototypensemantik. Was im Kern und was an den Rändern unserer Vorstellung angesiedelt ist hängt auch von der Kultur und der Gesellschaft, in der wir leben ab. Dabei spielt auch die Quantität eine wichtige Rolle. Pinguine fliegen gar nicht und Hühner flattern vielleicht mal mit den Flügeln, weswegen sie eher an den Rändern unserer Vorstellung über Vögel liegen. Doch z.B. ein Adler kann weite Strecken fliegen und deswegen befindet er sich auch näher am Kern unserer Vor- stellung. Diese wird daher auch stark davon bestimmt, wie stark gewisse Merkma- le ausgeprägt sind. Und je höher die Quantität, desto stärker rückt ein Element auch in den Kern unserer Vorstellung.
Kußmaul stellt nun die These auf, dass unser Denken beim Übersetzen stark durch Kernvorstellungen, Unschärfe und Quantität bestimmt wird. Man muss entschei- den, wo man den Schwerpunkt setzt. Eher auf den Kern, die Ränder oder auf bei- des. Dazu ist Kreativität notwendig, da man bestimmte Elemente fokussieren muss. Um zu einer kreativen Übersetzung zu gelangen, muss man daher die starre Struktur von Kern und Rändern aufbrechen, so dass Elemente, die eigentlich am Rand angesiedelt sind, in den Kern rücken können und umgekehrt. Man gewichtet die Elemente neu, wodurch eine neue Verbalisierung entsteht. Bei dem Filmtitel „Le grand bleu“ stand zuerst das Element der Weite des Ozeans und seine Farbe im Mittelpunkt, also im Kern. Die prototypische Vorstellung vom Ozean ist hierbei, dass er blau ist und sich über eine große Fläche erstreckt. In der deutschen Übersetzung „Im Rausch der Tiefe“ rückte hingegen ein anderes Element des O- zeans in den Mittelpunkt, nämlich, dass er auch sehr tief ist. Die Farbe des Wassers wird dagegen gar nicht mehr erwähnt.
3.3.2 Die Scenes-and-frames Semantik
Das Scenens-and-frames Modell, das von Charles J. Fillmore entwickelt wurde, ist eine Weiterentwicklung der Prototypensemantik, denn die Szenen, die durch bestimmte Rahmen hervorgerufen werden, basieren auf eigenen Erfahrungen und daher auch auf prototypischen Vorstellungen. Es ähnelt im Grunde auch der Fi- gur-Grund-Gliederung. Doch eignet es sich besser, bestimmte Vorgänge zu be- schreiben.
Dabei sind scenes oder Szenen mentale Bilder, die durch einen frame oder Rah- men eingefasst werden. Rahmen sind also bestimmte Kategorien bzw. die Versprachlichung von Denkvorstellungen, den Szenen. Beim Übersetzen werden eigentlich nur Rahmen verwendet, denn man drückt sich durch Sprache aus. Da- her ist es schwierig Szenen zu erkennen. Kußmaul gibt eine mögliche Unterschei- dung an. Er sagt, es handelt sich um einen Rahmen, wenn etwas direkt benannt wird, also synthetisch ausgedrückt wird, während bei Szenen mehrere Details ge- nannt werden, was eher einer analytischen Ausdrucksweise entspricht. So kann man z.B. sagen „Bald ist Weihnachten.“ und würde somit einen Tatbestand mit einem Rahmen ausdrücken. Aber man könnte auch sagen „Bald schmücken wir wieder unseren Tannenbaum, backen Plätzchen und bekommen schöne Geschen- ke.“ So hätte man den Rahmen „Weihnachten“ mit Szenenelementen ausgedrückt. Sicherlich sind die von mir gewählten Elemente nicht vollständig, man könnte die Liste noch verlängern, aber dies zeigt, dass auch hier wieder der Faktor der Quan- tität eine Rolle spielt. Durch die Nennung werden bestimmte Elemente stärker gewichtet als andere und somit fokussiert, also in den Kernbereich gerückt.
Beim Übersetzen gibt es vier Möglichkeiten, wie man Rahmen und Szenen ein- setzen kann. So kann man einen Rahmen durch einen anderen Rahmen ersetzen, was weniger kreativ ist, wenn sich die Rahmen in beiden Sprachen ähneln. Es ist auch möglich einen Rahmen durch eine Szene zu ersetzen und würde schon eine größere Veränderung darstellen, daher auch mehr Kreativität erfordern. Weiterhin könnte man eine Szene durch eine Szene wiedergeben, wobei man nur kreativ übersetzen würde, wenn die Szene im Zieltext sich von derjenigen im Ausgangs- text unterscheidet. Als letztes kann man auch eine Szene durch einen Rahmen ersetzen, was wiederum eine umfangreichere Veränderung wäre. Ob und in wie- weit die verschiedenen Veränderungen kreativ sind, müsste anhand ihrer Neuheit und Angemessenheit überprüft werden. Kußmaul gibt drei Möglichkeiten an, wie man überprüfen kann, ob eine Übersetzung angemessen ist:
1. wenn sie den üblichen Rahmen für ein oder mehrere im Ausgangstext genannten Szenenelemente nennt;
2. wenn sie ein Szenenelement durch ein anderes Kernelement der betref- fenden Szene ersetzt;
3. wenn sie [...] statt des Rahmens im Ausgangstext ein oder mehrere Kernelemente im Zieltext nennt.7
Kußmaul stellt schließlich die These auf, dass alle drei Modelle zur Beschreibung von sprachlichem Denken (Prototypensemantik, Figur-Grund-Gliederung, Scenesand-frames Semantik) mit lateralem Denken zu tun haben und damit sprachliches Denken im Grunde kreativ ist.
3.4 Gedankensprünge
3.4.1 Alternativen
Dieses Modell wurde von Edward8 de Bono entwickelt. Es ist ein weiteres Prinzip des lateralen Denkens und geht davon aus, dass man eine Sache auf verschiedene Art und Weise betrachten kann. Bei der Lösungsfindung müssen vorerst alle Alternativen festgehalten werden, ohne gleich einige zu verwerfen, denn nur so können neue und damit kreative Lösungen entstehen.
Alternativen entstehen in unserem Gehirn durch den sogenannten Konnektionis- mus, d.h. durch eine Andeutung werden größere Muster aktiviert, die dann je nach Situation oder Kontext verschieden interpretiert werden können. Wenn ein Lö- sungsweg erfolgreich war, wird er dann immer wieder aufgegriffen. Alternativen findet man auch, indem man z.B. einen anderen Ansatzpunkt wählt und damit die Perspektive und den Fokus seiner Betrachtungsweise ändert oder die Figur- Grund-Gliederung umkehrt.
In diesem Zusammenhang nennt Kußmaul auch den Begriff der Inferenz. Dabei handelt es sich um schlussfolgerndes Denken, d.h. wir sehen nicht nur die sprach- lichen Äußerungen, sondern wenden auch unser Weltwissen an. Somit können wir logische Zusammenhänge zwischen mehreren Sätzen erkennen. Kußmaul ist der Auffassung, dass man, um zum kreativen Denken anregen zu können die verschiedenen Wege zur Lösungsfindung, wie z.B. das Scenes-and- frames Modell, beschreiben muss.
3.4.2 Verkettungen
Das Verkettungsmodell wurde von George Lakoff entwickelt. Es ist eine Weiter- entwicklung der Prototypentheorie und führt den Begriff des prototypischen Sze- narios ein. Es zeigt, wie man aufgrund dieses Szenarios verschiedene Kategorien miteinander Verknüpfen kann. Ein Szenario ist dabei die “Beschreibung komple- xer Vorstellungen, die sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzen.“ Beim Übersetzen stellen wir uns in der Verstehensphase derartige Szenarien vor, wo- durch dann die zielsprachliche Version des Ausgangstextes entsteht. Verknüp- fungen entstehen nun über zentrale Elemente des Szenarios, welche metaphori- sche oder metonymische prototypische Vorstellungen beinhalten. So kann man zwischen verschiedenen Kategorien springen, was wiederum lateralem, also krea- tivem Denken entspricht. Wie bei dem Modell der Alternativen sind auch hier wieder Szenen und Szenenelemente beteiligt, da eine Verkettung durch Fokusver- änderungen entsteht und die verschiedenen Kategorien so über die fokussierten Szenenelemente verbunden sind. Für das Übersetzen stellt Kußmaul die Hypothe- se auf, dass auch hier Kategoriensprünge im Gehirn stattfinden. Indem gemeinsa- me Elemente erkannt werden, wird eine Kategorie oder Szene im Ausgangstext durch eine scheinbar andere Kategorie oder Szene im Zieltext wiedergegeben.
3.4.3 Das dynamische Gedächtnis
3.4.3.1 MOPs (Memory Organisation Packets)
Das Modell des dynamischen Gedächtnisses wurde von Roger Schank entwickelt. Es beschäftigt sich mit Gedächtnisstrukturen und Kußmaul untersucht, was diese Gedächtnisstrukturen mit dem Übersetzen zu tun haben. Auch dieses Modell hat in gewisser Weise mit Verkettungen zu tun, nur, dass nicht Kategorien verkettet werden, sondern Erinnerungen. Kußmaul hat dieses Modell aufgegriffen, weil er davon ausgeht, dass das Übersetzen auch sehr viel mit dem Abrufen von Erinne- rungen zu tun hat. Der Begriff MOP drückt aus, dass unsere Assoziationen, also unser Erinnern, keineswegs zufällig abläuft, sondern strukturiert vor sich geht. MOPs sind Bestandteile eines Erlebnisses, die einer Gesamtszene oder einem script untergeordnet sind. MOPs können im Gegensatz zu Verkettungen auch Szenen miteinander verbinden, die weiter voneinander entfernt sind. Kußmaul führt ein Beispiel an, in dem sich ein Patient beim Arzt darüber ärgert, dass ein anderer Patient, der später kam, vor ihm an der Reihe war und er schlussfolgert, dass ihm der Arzt wahrscheinlich eine zu hohe Rechnung ausstellen wird. Wie der Patient zu diesem Schluss kommt, soll mit den MOPs erklärt werden. Mit der Szene „Arztbesuch“ sind die MOPs Gesundheitsvorsorge, Besuch eines Spezialis- ten und Vertrag verbunden. Die Elemente dieser MOPs wären z.B. die Vereinba- rung eines Termins, das Eintreten in ein Büro oder Wartezimmer und die Bezah- lung der Dienstleistung. Vielleicht hat der Patient schon woanders, z.B. in der Kaufhalle erlebt, dass sich Leute vordrängelten und bezieht nun diese Erfahrung auf seinen Arztbesuch. Die Gemeinsamkeit dieser beiden Erlebnisse wäre, dass bei beiden etwas bezahlt werden muss. Dadurch wurden die verschiedenen Sze- nen im Kopf des Patienten verknüpft und er kam zu seiner Schlussfolgerung.
3.4.3.2 TOPs (Thematic Organisation Points)
Bei TOPs geht es auch um die Verknüpfung von Ereignissen und das Abrufen von Wissen, jedoch auf eine komplexere Weise. Es werden Ereignisse aus ganz ver- schiedenen Bereichen verbunden, z.B. wenn uns zu einer bestimmten Gelegenheit ein Zitat oder Sprichwort einfällt, das dazu passt. So können TOPs auch bei der Übersetzung von Sprichwörtern oder Wortspielen nützlich sein, die ja meist nicht einmal annähernd so übernommen werden können, wie sie im Ausgangstext ste- hen. Wichtig ist dabei natürlich, dass man beachtet, was ausgesagt oder erreicht werden soll, Schank nennt dies das TOP ZIEL. Wichtig ist auch das TOP BE- DINGUNG, d.h. die Voraussetzungen oder Umstände einer bestimmten Hand- lung.
Auch bei der Übersetzung von Analogien sind TOPs beteiligt. Analogien sind oft nicht einfach zu übersetzen, da sie häufig kulturgebunden sind, d.h. in Parabeln oder Volksweisheiten auftauchen oder möglicherweise den Sachverhalt nicht rich- tig erklären, so dass eine neue Analogie gefunden werden muss. Dabei müssen die Analogien allerdings nicht immer genau stimmen, sondern nur das Problem an- gemessen erläutern.
TOPs können auch bei der Evaluation von Übersetzungen hilfreich sein, denn wenn man erkennt, dass eine Übersetzung, auch wenn sie weit entfernt vom Ausgangstext scheint, durch ein TOP damit verbunden ist, dann kann man sie auch eher als angemessen akzeptieren.
MOPs, TOPs und Analogien beruhen auf Abstraktion, so dass Sachverhalte, die im Grunde nicht miteinander zusammenhängen, verknüpft werden können. Dies ist wiederum eine kreative Leistung, da hierzu assoziatives und damit laterales Denken notwenig ist.
4. Typen des kreativen Denkens: Anwendungsbeispiele
4.1 Rahmenwechsel
Bei den Typen des kreativen Denkens handelt es sich um Möglichkeiten9 oder Techniken, wie man kreativ übersetzen kann. Kußmaul unterscheidet sieben Ty- pen und bezieht diese aus den Überlegungen über die Scenes-and-frames Seman- tik. Dabei räumt er ein, dass diese Typen nicht genau voneinander abgrenzbar sind.
Eine Übersetzungsmöglichkeit ist der Rahmenwechsel. Hierbei wechselt nur der Rahmen, also die sprachliche Äußerung im Text, die eingerahmte Szene bleibt dieselbe. Ein Rahmenwechsel findet z.B. statt, wenn ein metaphorischer Ausdruck im Ausgangstext im Zieltext nicht-metaphorisch wiedergegeben wird oder umgekehrt, wie im folgenden Beispiel:
La construction européenne, dit-on souvent, a besoin d’un grand dessein: elle ne doit pas rester l’apanage de bureaucrates sans légitimité et de comptables sans âme. Fort bien. Raison de plus pour les Douze de donner du souffle à leur dé- marche, et de ne pas se contenter de contorsions juridiques au bord du gouffre.
Die europäische Einigung braucht, so ist schon oft gesagt worden, eine echte Zukunftsperspektive. Sie dürfe nicht ausschließlich die Sache von Bürokraten ohne politisches Mandat und von seelenlosen Rechenkünstlern sein. Dem kann man nur zustimmen. Und gerade deshalb muss die Zwölfer-Gemeinschaft dem Zusammenwachsen neue Impulse geben, darf sie sich nicht mit juristischen Fi- nessen zufrieden geben, wo es doch um die Existenz Europas geht.10
Der metaphorische Ausdruck „au bord du gouffre“ wurde im Deutschen mit „wo es doch um die Existenz Europas geht“ wiedergegeben, also auf nicht- metaphorische Weise. Daher handelt es sich hier um einen Rahmenwechsel. Um die Kreativität dieser Übersetzung zu überprüfen, muss man sie auf ihre Ange- messenheit und Neuigkeit hin untersuchen. Die Übersetzung ist meiner Meinung nach angemessen, da sie den im Ausgangstext dargestellten Sachverhalt ebenso ausdrückt. Es wird klar, dass die Europäische Gemeinschaft in Gefahr ist. Im Be- zug zum Ausgangstext ist die Übersetzung auch neu, denn man hätte die Meta- pher leicht mit der deutschen Entsprechung „am Rande des Abgrunds“ übersetzen können, was der Übersetzer wahrscheinlich zugunsten eines besseren Verständ- nisses vermieden hat.
4.2 Neurahmung
Bei der Neurahmung entsteht im Gegensatz zum Rahmenwechsel ein völlig neuer Rahmen, also „ein Wort, das nicht konventionellerweise für einen bestimmten Inhalt, eine bestimmte Szene benutzt wird. Ein neuer Rahmen ist manchmal eine Wortschöpfung.“
Neurahmungen entstehen über Top-down-Prozesse. Bereits vorhandenes Wissen wird also auf den Text projiziert, um daraus eine Übersetzung abzuleiten. So wie in folgendem Beispiel aus dem Gedicht „Sed non sadiata“ von Charles Baude- laire:
Par ces deux grands yeux noirs, soupiraux de ton âme,
Ô démon sans pitié ! verse-moi moins de flamme ;
Je ne suis pas le Styx pour t’embrasser neuf fois,
Aus dieses Seelenschächten, deinen schwarzen Augen,
Lass mich, Erbarmungslose, weniger Glut einsaugen;
Ich bin nicht Styx, ich kann nicht neun Mal dich umschlingen;11
Der Ausdruck „Seelenschächte“ für das Französische „soupiraux de ton âme“ ist eine Wortschöpfung. Sicherlich entstand sie aufgrund des Zwangs des Metrum und Rhythmus. Um zu dieser Übersetzung zu gelangen, war sicherlich eine szenische Vorstellung nötig, denn im Wörterbuch findet man für „soupirail“ die Entsprechungen „Kellerfenster“ oder „Kellerloch“. Wenn man sich ein Kellerfenster oder -loch vorstellt, dann sieht man eine Öffnung vor sich, die ins Dunkel führt, fast wie ein Eingang zu einem Tunnel oder eben Schacht.
4.3 Auswahl von Szenenelementen innerhalb eines Rahmens
Hier wird ein Rahmen durch eine Szene oder Elemente einer Szene ausgedrückt. Es wird also paraphrasiert, weil vielleicht keine direkte Entsprechung in der Zielsprache existiert oder man einen Sachverhalt konkreter und genauer ausdrücken will. Dazu folgendes Beispiel:
Elle peut aussi, grâce aux transmissions par satellite et aux connexions multi- ples, transformer un événement en affaire centrale de la planète, en faisant réagir les principaux dirigeants du monde, les personnalités les plus en vue, en contrai- gnant les autres médias à suivre, à amplifier l’importance de l’événement, à confirmer sa gravité et à rendre d’une urgence absolue la résolution du pro- blème. On peut échapper à ce tam-tam planétaire ? Tiananmen, Berlin, Rouma- nie, Golfe scandent avec une telle force l’évolution de l’actualité que tout le reste de l’information s’estompe, s’assourdit, se dissipe.
Dank Satellitenübertragung und intermedialer Vernetzungen kann es ein Ereig- nis auch zu einem zentralen Anliegen der ganzen Welt machen. Es kann die füh- renden Staatsmänner der Welt, es kann prominente Persönlichkeiten zu Stel- lungnahmen auffordern. Es kann die anderen Medien dazu zwingen, gleichzu- ziehen, also ein Ereignis aufzuwerten, den Ernst einer Lage wie das Fernsehen einzuschätzen oder eine Problemlösung herbeizureden. Wer könnte einem sol- chen Medienrummel rund um die Welt widerstehen? Bilder aus Peking vom Platz des Himmlischen Friedens, dann Berlin, Fall der Mauer, blutige Ereignisse in Bukarest, Golfkrieg, lauter Szenen, die den Ablauf der Berichterstattung der- art bestimmen, dass andere Nachrichten daneben verblassen und übertönt wer- den.12
Gegen Ende des Abschnittes werden verschiedene Orte genannt, an denen wichti- ge politische Ereignisse stattfanden. Unter anderem Rumänien im Ausgangstext. In der Übersetzung wurde daraus „blutige Ereignisse in Bukarest“. Es wurde also nicht der allgemeine Rahmen „Roumanie“ beibehalten, sondern konkreter ausge- drückt, was sich an welchem Ort ereignete. Dazu benötigt man natürlich das Hin- tergrundwissen, um sich die Szene vorstellen zu können, wie sie sich dort abspiel- te. Bei der Auswahl von Szenenelementen innerhalb eines Rahmens findet eine Fokussierung statt. Indem ein bestimmtes Element der Gesamtszene angeführt wird, richtet sich die Aufmerksamkeit auch nur auf einen bestimmten Bereich dieser Szene. Sicherlich könnte man sich zu Rumänien auch noch andere Szenen vorstellen. Doch durch den Kontext sind nur bestimmte Szenen angemessen. Der Hintergrund sind schließlich teilweise gewalttätige, jedoch bedeutende politische Umbrüche Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.
4.4 Auswahl von Szenenelementen innerhalb einer Szene
Hierbei werden durch einen Fokuswechsel verschiedenen Elemente aus einer Ge- samtszene ausgewählt. Die Blickrichtung ändert sich zwar, aber der Ausdruck im Ausgangstext und seine Entsprechung im Zieltext sind dennoch über die Gesamt- szene miteinander verbunden. Das möchte ich an folgendem Beispiel verdeutli- chen:
En haut de l’échelle se livre une compétition effréné pour décrocher un des rares emplois à la fois stables et ouverts sur une carrière ascendante. C’est ce qu’ un slogan publicitaire répugnant vante comme « la rage de gagner », étant entendu qu’il doit y avoir, pour chaque gagnant, une foule de perdants et que les vainqueurs ne doivent rien à ceux et à celles qu’ils écrasent.
Auf dem oberen Teil der sozialen Leiter findet ein erbitterter Kampf um die we- nigen Arbeitsplätze statt, die mit einem festen Arbeitsvertrag ausgestattet und an Aufstiegschancen geknüpft sind. Die Werbestrategen haben dafür die schnöde
Formel parat: „Einer wird gewinnen“. Sie besagt, dass auf jeden Gewinner zwangsläufig eine ganze Menge Verlierer kommen und dass jeder, der gewinnt, oder jede, die gewinnt, den anderen, die auf der Strecke bleiben, nichts schuldig ist.13
Am Ende des Absatzes steht im französischen Text : « ...les vainqueurs ne doi- vent rien à ceux et celles qu’ils écrasent. » Eine annähernde Übersetzung wäre vielleicht : „ …die Gewinner schulden denjenigen, die sie überrennen/überrollen nichts. „ . In der Übersetzung wurde jedoch die Variante gewählt „...den anderen, die auf der Strecke bleiben, nichts schuldig ist.“. Hierbei kann man gut den Wech- sel der Blickrichtung, also auch des Fokus beobachten. Im Ausgangstext stehen die Gewinner im Mittelpunkt. Man stellt sich vor, dass eine große Menge von Menschen einem bestimmten Ziel entgegenläuft und einige die anderen mit Füßen treten, um schneller voranzukommen. In der Übersetzung werden dagegen eher diejenigen hervorgehoben, die getreten werden, also „auf der Strecke bleiben“. Die Handlung derjenigen, die sie „überrennen“ tritt dagegen in den Hintergrund. Jedoch sind „überrennen“ und „auf der Strecke bleiben“ Elemente derselben Ge- samtszene.
4.5 Szenenwechsel
Beim Szenenwechsel wir die Szene im Ausgangstext im Zieltext durch eine ande- re Szene ausgedrückt. Man wechselt sozusagen die Kategorie. Kußmaul führt hierfür das Beispiel der Namen der Asterix-Figuren an. Da ich es sehr gelungen finde, möchte ich es übernehmen. So heißt z.B. der Druide im Französischen Pa- noramix, wahrscheinlich eine Mischung aus „panorama“ und „mixture“, was ei- nerseits auf den Weitblick und andererseits auf seine Fähigkeit hinweist, Zauber- tränke zu brauen. Im Deutschen wird der Druide Miraculix genannt. Hier wird die Betonung besonders darauf gelegt, dass er Wunder tut, indem er die Zaubertränke herstellt. Auf den ersten Blick haben die beiden Varianten nicht viel miteinander zu tun. Doch vor dem Hintergrund des Gesamtszenarios, also der Geschichte des Comics, erkennt man den Zusammenhang. Denn die beiden Namen beschreiben verschiedene Eigenschaften des Druiden, die im Laufe der Geschichte zu Tage treten. Also einmal sein Weitblick und einmal seine Zauberkraft. Hier fand wieder ein Fokuswechsel statt, denn der Blick wurde ja von einer bestimmten Eigenschaft des Druiden auf eine andere gerichtet, die aber genauso gut zu ihm passt, wodurch die Übersetzung ihre Angemessenheit gewinnt. Es fand also über das Gesamtsze- nario auch eine Verkettung statt, die zu einem Kategoriensprung führte. Kußmaul führt hierfür folgende Übersetzungsstrategie an: „Stelle dir das Gesamtszenario vor, das durch den größeren Kontext bestätigt wir, und richte deinen Blick auf die einzelnen Bestandteile dieses Szenarios, um dich für eine Übersetzung inspirieren zu lassen.“14
Der Szenenwechsel lässt sich auch gut bei Sprachwitzen und Wortspielen anwen- den, die nicht einfach in die Zielsprache übertragen werden können. Hier kommt auch das Modell der TOPs zur Anwendung. Dabei muss man das TOP ZIEL, also den Zweck, und das TOP BEDINGUNG, also z.B. die Form eines Witzes oder Wortspiels beachten. Wenn der Sprachwitz in der Ausgangssprache z.B. durch Homonymie oder Homofonie entsteht, dann müsste man in der Zielsprache eben- falls einen Witz finden, der diese Bedingung erfüllt. Kußmaul empfiehlt für die Übersetzung folgendes: „Erkenne das Ziel und die formalen Bedingeungen und „springe“ in eine andere Szene!“15.
4.6 Szenenerweiterung
Bei der Szenenerweiterung unterscheidet Kußmaul zwei Arten: „1. Die Überset- zung verbalisiert außer dem im Ausgangstext (durch einen Rahmen) versprach- lichten Element ein oder mehrere weitere Elemente, die im Ausgangstext nicht explizit genannt werden, aber in die Gesamtszene passen. 2. Die Übersetzung suggeriert eine noch umfassendere Szene als der Ausgangstext.“16 Hierzu möchte ich das Beispiel aus 7.3 heranziehen. In der Aufzählung der ver- schiedenen politischen Schauplätze taucht auch Berlin auf. Im Ausgangstext wird es bei der einfachen Nennung der Stadt belassen. Im Zieltext wählte der Überset- zer jedoch eine genauere Beschreibung und verwendetet „Berlin, Fall der Mauer“. Dies entspricht der ersten Art der Szenenerweiterung und ist auch eine angemes- senen Lösung, da man aus dem Kontext schließen kann, dass diese Szene gemeint ist.
Kußmaul macht in diesem Zusammenhang besonders auf die mentalen Prozesse aufmerksam, die beim Übersetzen ablaufen. In dem von mir angeführten Beispiel kamen beim Übersetzen wohl Top-down Prozesse zur Anwendung. Aufgrund seines Weltwissens konnte der Übersetzer Berlin mit der Wende und Wiederver- einigung assoziieren. Das Szenario in seinem Kopf war wohl jenes großer De- monstrationen, Reden und wie die Mauer geöffnet wurde. So konnte die Szenen- erweiterung „Berlin, Fall der Mauer“ vorgenommen werden. Kußmaul empfiehlt für das Übersetzen folgende „Strategie“: „Du kannst versuchen, die mentalen Vorstellungen, die eine Textstelle bei dir auslöst, durch dein Hintergrundwissen zu erweitern, und/oder du kannst versuchen, dich bei der Erweiterung dieser Vor- stellungen durch den Blick auf den Kontext stimulieren zu lassen.“17
4.7 Einrahmung
Die Einrahmung ist das umgekehrte Verfahren zu 7.3 , also der Auswahl von Sze- nenelementen innerhalb eines Rahmens. Ein Sachverhalt, der durch Details be- schrieben wurde wird hierbei durch einen abstrakten Begriff ausgedrückt. Beispiel:
L’ouest de l’Allemagne connaissait depuis bien avant la réunification la montée d’un mouvement d’extrême droite attisée par une immigration mal contrôlée. S’ajoutant à l’arrivée massive d’Allemands de l’Est et d’Allemands de souche venant de Russie, les premières vagues d’immigration de Roumains et de Yougoslaves on fait déborder le vase.
Schon lange vor der deutschen Wende und dem Einigungsvertrag hatte es im westlichen Teil Deutschlands ein Wiedererstarken der rechtsradikalen Kräfte gegeben, wofür die bald nicht mehr zu steuernde Fluchtbewegung von Ost nach West einen günstigen Nährboden geschaffen hatte. Der einsetzende Zustrom von Rumänen und Jugoslawen hatte nach der massiv anrollenden Übersiedler- und Aussiedlerwelle endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht.18
Die Beschreibung „...l’arrivée massive d’Allemands de l’Est et d’Allemands de souche venant de Russie...“ wird in der deutschen Übersetzung mit dem Rahmen „Übersiedler- und Aussiedlerwelle“ ausgedrückt. Sicherlich ist dieser Ausdruck nicht besonders neu, da er ja schließlich schon im deutschen Sprachgebrauch exis- tiert. Daher könnte man meinen, die Übersetzung sei nicht besonders kreativ. Al- lerdings ist Kreativität auch ein gradueller Begriff und meiner Meinung nach ge- hört schon ein wenig Kreativität dazu, um von der Umschreibung im Französi- schen auf den im Deutschen üblichen Ausdruck zu kommen. Weiterhin ist dieser Ausdruck angemessen, da er genau das wiedergibt, was im Französischen be- schrieben wurde.
5. Evaluation und Anwendung im Übersetzungsunterricht
In seinem Buch betont Kußmaul besonders die Bedeutung des kreativen Überset- zens im Übersetzungsunterricht. Er geht z.B. der Frage nach, wie man durch Eva- luation kreatives Übersetzen fördern bzw. auch behindern kann. Er ist dabei der Meinung, dass Evaluation die Übersetzung oder das Übersetzen an sich verbes- sern kann und natürlich auch den Leistungsstand der Studierenden offenbart. Sei- ne Methode der Evaluation ist vom funktionalen Ansatz geprägt und weniger von der Äquivalenztheorie. Es gibt hierbei zwei Möglichkeiten der Bewertung. Einmal die retrospektiv-kontrastive Herangehensweise und dann die prospektiv- funktionale Herangehensweise, die, wie gesagt, Kußmaul bevorzugt. Die retro- spektiv-kontrastive Evaluation wird meist im Fremdsprachenunterricht angewandt und dient dem Nachweis von Sprachkenntnissen, vor allem in der Schule. Beim Übersetzen geht es allerdings auch um muttersprachliche Kompetenz und diese Art der Evaluation ist nach Kußmaul daher auch schwer mit der natürlichen Kommunikation in Einklang zu bringen und behindert das Finden kreativer Über- setzungen. Die retrospektiv-kontrastive Evaluation wird aber auch in der Überset- zerausbildung bei Nicht-Schul-Sprachen verwendet, die ganz neu gelernt werden müssen. Und da auch dort oft von Anfang an Übersetzungen angefertigt werden, kommt es zu einem Konflikt bei den Studierenden, die gleichzeitig ihre Sprach- kenntnisse und übersetzerische Kompetenz nachweisen wollen. Der selbe Fall kann auch in der Praxis eintreten, wenn der Auftraggeber eine Übersetzung nicht akzeptiert, da er sie mit dem Ausgangstext vergleicht und meint, die Übersetzung würde ihn nicht richtig wiedergeben.
Bei der funktional-prospektiven Evaluation geht es eher darum, die Wirkung einer Übersetzung zu überprüfen. Man fragt, ob der Text „funktioniert“, also ob der Übersetzungsauftrag erfüllt wurde. Wenn ein Text z.B. Defekte hat, könnte man diese in der Übersetzung ausbessern, was bei der retrospektiv-kontrastiven Me- thode, bei der die Übersetzung direkt mit dem Ausgangstext verglichen wird, nicht möglich wäre. Kußmaul zufolge fördern die funktionalen Kriterien die Krea- tivität, da sie mehr Spielraum lassen. Natürlich muss der Zieltext noch eine Ver- bindung zum Ausgangstext haben, was in der Skopostheorie mit dem Begriff Fi- delit ä t ausgedrückt wird, allerdings ist diese dem Skopos untergeordnet.
Auch wenn Kußmaul die prospektiv-funktionale Evaluation vorzieht, räumt er der retrospektiv-kontrastiven Evaluation dennoch eine gewisse Berechtigung ein, denn um den Grad der Kreativität, also Veränderung und Neuigkeit, festzustellen ist schließlich ein Vergleich mit dem Ausgangstext notwendig. Doch ob der Text für den zielsprachlichen Adressaten angemessen ist, kann nur mit der prospektiv- funktionalen Evaluation überprüft werden. Daher müssen bei der Bewertung von Übersetzungen beide Methoden verwendet werden, wobei die retrospektiv- kontrastive Evaluation jedoch der prospektiv-funktionalen untergeordnet sein soll- te.19
So kann man, nach Kußmaul, die übersetzerische Kreativität der Studenten för- dern. Allgemein sollte man sie seiner Meinung nach zu kreativem Denken anre- gen, indem man sie z.B. auf die Textanalyse aufmerksam macht, mit deren Hilfe sie ihr Hintergrundwissen erweitern können oder ihnen die Wege zur Überwin- dung mentaler Blockaden20 aufzeigt. Außerdem sollten Dozentinnen und Dozen- ten, um gute Übersetzungen zu fördern nicht nur kritisieren, sondern auch Lob und Ermunterung schenken und vielleicht auch Text wählen, die den Studierenden zusagen, auch wenn dies natürlich nicht immer möglich ist21. In der Überset- zungsdidaktik wird auch oft empfohlen, die verschiedenen Phasen (Analyse, Ü- bersetzung, Beurteilung) zu trennen, allerdings könnten dabei gute Ideen verloren gehen, da, wie bei Vier-Phasen-Modell beschrieben, die Phasen eigentlich nicht zu trennen sind und eine Kritik, also eine Beurteilung, eine neue und bessere Ü- bersetzung hervorrufen kann22. Außerdem sollten Studenten dazu gebracht wer- den, sich im Text beschriebene Sachverhalte szenisch vorzustellen23 und dadurch auf die kreativen Denkprozesse24 aufmerksam gemacht werden, um zu guten I- deen zu gelangen.
6. Schlussbemerkungen
Meiner Meinung nach hat Kußmaul mit seinem Buch sein Ziel, zu kreativem Ü- bersetzen anzuregen, erreicht. Er schildert anschaulich und nachdrücklich seine Thesen und unterlegt sie mit vielen Beispielen. Sicherlich wären an einigen Stellen noch genauere Erläuterungen möglich gewesen, aber er räumt selbst ein, dass er keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Ich denke auch, dass sein Buch eine gute Grundlage für den Übersetzungsunter- richt bilden würde, denn er beschreibt sehr klar und verständlich, wie man an eine Übersetzung herangehen kann und wie man am effektivsten zu Lösungen gelangt. Durch sein Buch kann man erkennen, wie man die verschiedenen Modelle der Übersetzungswissenschaft, wie z.B. das Scenes-and-frames-Modell, praktisch anwenden kann.
Außerdem wirkte das Buch auf mich motivierend, weil viele verschiedene Mög- lichkeiten aufgezeigt wurden, die im Übersetzen stecken und dass es Spaß machen kann, nach Lösungen zu suchen und sich mit den zu übersetzenden Texten ausei- nanderzusetzen. Außerdem regt Kußmaul dazu an, sein Selbstbewusstsein zu ent- wickeln, um, wie Martin Luther, den Mut zu haben, seine (kreative) Übersetzung zu verteidigen, auch gegen vermeintlich Besser-Wissende. Und ich finde, Mut und Selbstbewusstsein sind nicht nur beim Übersetzen wichtig, sondern im gan- zen Leben.
[...]
1 Kussmaul, Paul Kreatives Ü bersetzen Tübingen: Stauffenburg Verlag 2000 in Studien zur Translation Band 10; S.69
2 Kußmaul, S. 9ff.
3 Kußmaul, S. 17ff.
4 Kußmaul, S. 57ff.
5 Kußmaul, S. 84ff.
6 Kußmaul, S.106ff.
7 Kußmaul, S. 128
8 Kußmaul, S 119ff.
9 Kußmaul, S. 150ff.
10 Henschelmann, Käthe; Problembewusstes Ü bersetzen: Franz ö sisch-Deutsch; Ein Arbeitsbuch Gunter Narr Verlag Tübingen 1999
11 Baudelaire, Charles; Les Fleurs du Mal - Die Blumen des B ö sen: Franz ö sisch/Deutsch; Reclam Verlag, Ditzingen 1998
12 Henschelmann, S. 110ff.
13 Henschelmann, S. 73f.
14 Kußmaul, S. 170
15 Kußmaul, S.173
16 Kußmaul, S. 177
17 Kußmaul, S.180
18 Henschelmann, S. 155f.
19 Kußmaul, S.36ff.
20 Kußmaul, S.73
21 Kußmaul, S.74
22 Kußmaul, S.78f.
23 Kußmaul, S.154
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt das Thema kreatives Übersetzen und untersucht, inwiefern Übersetzen eine kreative Tätigkeit sein kann. Er analysiert Modelle des kreativen Denkens und stellt Anwendungsbeispiele vor.
Welche Modelle des kreativen Denkens werden im Text vorgestellt?
Der Text stellt verschiedene Modelle des kreativen Denkens vor, darunter das Vierphasenmodell (Präparation, Inkubation, Illumination, Evaluation), laterales Denken, Perspektive und Fokus, Prototypen, Rahmen und Szenen sowie Gedankensprünge (Alternativen, Verkettungen, dynamisches Gedächtnis).
Was versteht Kußmaul unter einer kreativen Übersetzung?
Kußmaul definiert eine kreative Übersetzung als eine Übersetzung, die aufgrund einer obligatorischen Veränderung des Ausgangstexts entsteht und etwas Neues darstellt, das zu einer bestimmten Zeit und in einer (Sub-)Kultur von Experten als mehr oder weniger angemessen akzeptiert wird.
Was bedeutet das Vierphasenmodell des kreativen Denkens?
Das Vierphasenmodell beschreibt den Ablauf kreativen Denkens in vier Phasen: Präparation (Vorbereitung und Verstehen), Inkubation (unbewusste Denkprozesse), Illumination (plötzliche Einsicht oder Lösung) und Evaluation (Überprüfung der Lösung).
Was ist laterales Denken und wie unterscheidet es sich vom vertikalen Denken?
Laterales Denken (auch divergentes Denken) ist ein sprunghaftes Denken, das mehrere verschiedene Lösungen und Wege zulässt. Im Gegensatz dazu ist vertikales Denken (konvergentes Denken) auf eine einzige richtige Lösung ausgerichtet.
Was sind Rahmen und Szenen im Kontext der Scenes-and-frames Semantik?
Rahmen (frames) sind bestimmte Kategorien bzw. die Versprachlichung von Denkvorstellungen, während Szenen (scenes) mentale Bilder sind, die durch einen Rahmen eingefasst werden.
Welche Typen des kreativen Denkens werden im Text anhand von Anwendungsbeispielen erläutert?
Der Text erläutert sieben Typen des kreativen Denkens anhand von Anwendungsbeispielen: Rahmenwechsel, Neurahmung, Auswahl von Szenenelementen innerhalb eines Rahmens, Auswahl von Szenenelementen innerhalb einer Szene, Szenenwechsel, Szenenerweiterung und Einrahmung.
Welche Rolle spielt die Evaluation im Übersetzungsunterricht nach Kußmaul?
Kußmaul betont die Bedeutung der Evaluation im Übersetzungsunterricht, um kreatives Übersetzen zu fördern. Er unterscheidet zwischen retrospektiv-kontrastiver und prospektiv-funktionaler Evaluation und bevorzugt die prospektiv-funktionale Herangehensweise, die die Wirkung der Übersetzung überprüft.
Was sind MOPs und TOPs im Modell des dynamischen Gedächtnisses?
MOPs (Memory Organisation Packets) sind Bestandteile eines Erlebnisses, die einer Gesamtszene oder einem Script untergeordnet sind. TOPs (Thematic Organisation Points) beziehen sich auf die Verknüpfung von Ereignissen und das Abrufen von Wissen auf komplexere Weise.
Welche Empfehlungen gibt Kußmaul für die Förderung des kreativen Übersetzens im Unterricht?
Kußmaul empfiehlt, Studenten zu kreativem Denken anzuregen, indem man sie auf die Textanalyse aufmerksam macht, ihnen Wege zur Überwindung mentaler Blockaden aufzeigt, Lob und Ermunterung schenkt und sie dazu bringt, sich im Text beschriebene Sachverhalte szenisch vorzustellen.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Soska (Autor:in), 2002, Kreatives Übersetzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106019