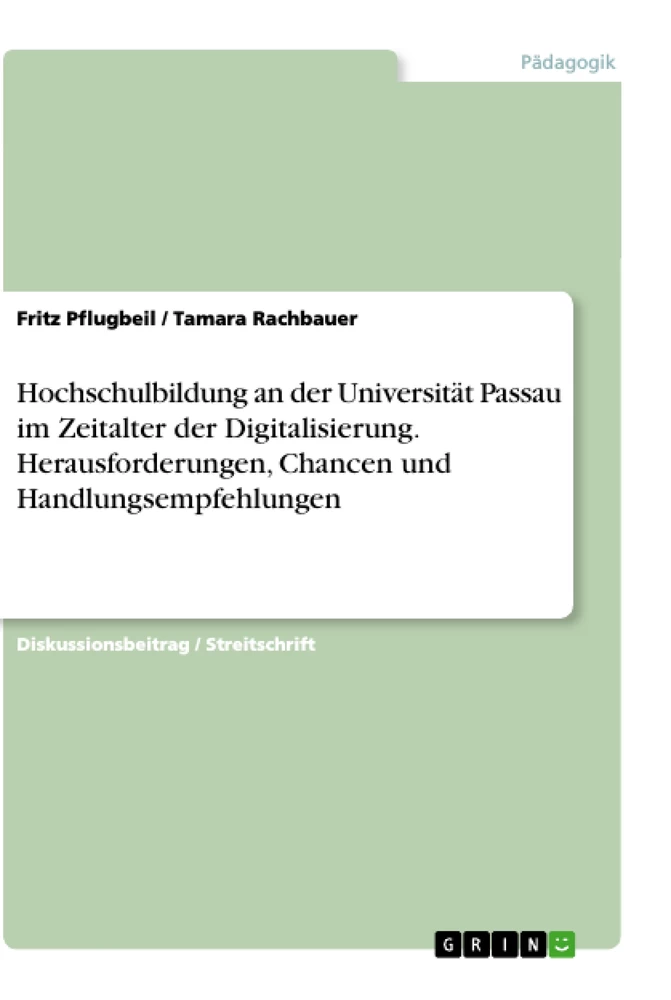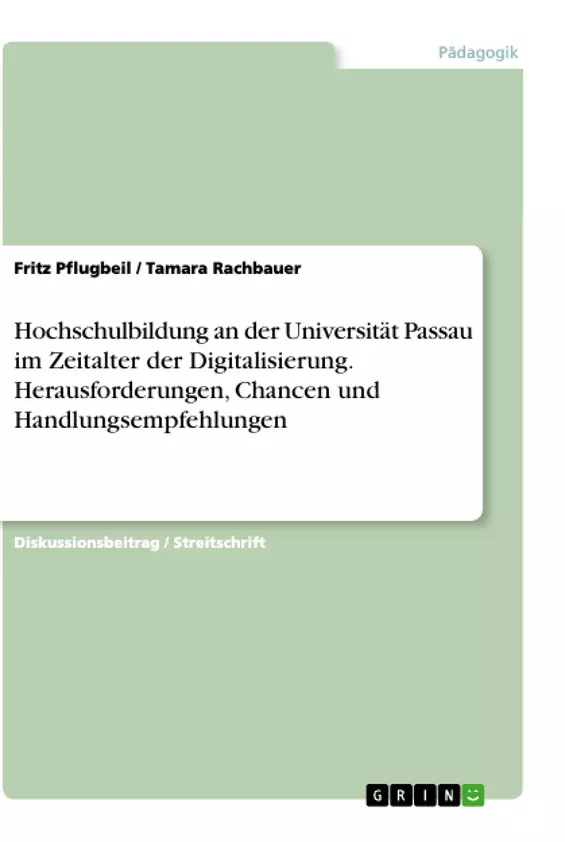Nachdem im Corona-Jahr das Sommersemester an den meisten deutschen Hochschulen überwiegend online stattfand und nach anfänglichen Bedenken der Notbetrieb erstaunlich gut funktionierte, zeigten sich Akteur*innen des Hochschulbetriebs von den Möglichkeiten der Digitalisierung beeindruckt. Auch an der Universität Passau hatte die Universitätsleitung schnell reagiert und einrichtungsübergreifend das "Transferforum DiTech" gebildet, das sich interdisziplinär aus Didaktikern und Technikern zusammensetzte. Das Team verfolgte vordergründig das Ziel, Dozierende innerhalb kürzester Zeit auf die Online-Lehre vorzubereiten. Dabei widmete sich das Team den Themenfeldern Technik, Didaktik und Recht.
Akteur*innen in der deutschen Hochschullandschaft sehen in der Corona-Krise die Chance, dass die Bildungslandschaft einen Digitalisierungsschub erlebt. Nicht selten sind Krisen Auslöser für neue Betrachtungs- und Herangehens-weisen. Dabei ist die Digitalisierung kein neues Thema. Digitale Medien bestimmen in weiten Teilen den Alltag der Gesellschaft. Sie haben Einfluss auf das Privatleben, den Beruf und die Bildung. Durch die Digitalisierung der Me-dien lassen sich heutzutage Daten leicht speichern, reproduzieren und verteilen. Mit dem Internet als Übertragungsmedium entstand somit ein weltweites Informations- und Kommunikationsnetzwerk.
Diese Entwicklung beeinflusst auch Bildungseinrichtungen, da neben traditionellen Lehr- und Lernangeboten digitale Medien vermehrt zur Wissensvermittlung herangezogen werden. Da jede Krise auch einmal zu Ende geht, sollten sich Hochschulen nachhaltig mit diesem Thema beschäftigen und die Potenziale strategisch nutzen. Diese Arbeit soll dazu einen kleinen Beitrag leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Geleitwort
- 1. Einleitung
- 1.1 Hintergrund
- 1.2 Motivation und Zielsetzung
- 1.3 Zentrale Fragestellung
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundbegriffe
- 2.1 E-Learning
- 2.2 Kooperatives E-Learning
- 2.3 Blended Learning
- 2.4 Mediendidaktik
- 2.5 Digitalisierungsstrategie
- 3. Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung
- 3.1 Ausgangslage von E-Learning an der Universität Passau
- 3.2 Problemfelder von E-Learning an der Universität Passau
- 3.2.1 Entwicklung einer Ziel- und Implementierungsstrategie
- 3.2.2 Falsches Verständnis für digitale Bildung
- 3.2.3 Fehlende Organisationsstruktur
- 3.2.4 Datenschutz
- 3.3 Chancen von E-Learning an der Universität Passau
- 3.3.1 Individualisierte Lernprozesse
- 3.3.2 Selbstgesteuertes und kollaboratives Lernen
- 3.3.3 Inklusion
- 3.3.4 Offene Bildung
- 3.3.5 Weiterbildung
- 3.3.6 Internationalisierung
- 3.3.7 Digitales Prüfen
- 4. Handlungsempfehlungen für die Universität Passau
- 4.1 Entwicklung von Ziel- und Implementierungsstrategien
- 4.2 Aufbau einer Koordinationseinheit durch ein interdisziplinäres Team
- 4.3 Nutzung und Ausbau bereits vorhandener Strukturen
- 4.4 Modernisierung von Bildungsräumen und -technologien
- 4.5 Etablierung eines kompetenzorientierten E-Assessments
- 4.6 Gemeinschaftliche Bildungspolitik auf Bundes- und Länderebene
- 4.7 Zusammenfassung der wichtigsten Empfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Diskussionspapier analysiert die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Kontext der Hochschulbildung an der Universität Passau. Die Autoren, die in den Bereich der didaktischen und technischen Expertise (DiTech) eingebunden sind, betrachten die Auswirkungen der Pandemie auf den Hochschulbetrieb und zeichnen ein Bild von der aktuellen Situation des E-Learnings an der Universität Passau. Das Papier zielt darauf ab, eine fundierte Grundlage für Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der digitalen Lehre und Forschung an der Universität zu schaffen.
- Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in der Hochschulbildung
- Analyse des E-Learnings an der Universität Passau
- Entwicklung einer Strategie zur Optimierung des digitalen Lehrens und Lernens
- Identifizierung von Schlüsselthemen und -faktoren für erfolgreiche digitale Lehre
- Erstellung konkreter Handlungsempfehlungen für die Universität Passau
Zusammenfassung der Kapitel
Das Diskussionspapier beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund, die Motivation und die Zielsetzung des Papers erläutert. Es werden die zentrale Fragestellung und der Aufbau des Papiers vorgestellt.
Im zweiten Kapitel werden grundlegende Begriffe wie E-Learning, kooperatives E-Learning, Blended Learning, Mediendidaktik und Digitalisierungsstrategie definiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Kontext der Hochschulbildung. Es analysiert die Ausgangslage von E-Learning an der Universität Passau und identifiziert verschiedene Problemfelder. Gleichzeitig werden auch die Chancen von E-Learning, wie individualisierte Lernprozesse, Selbstgesteuertes und kollaboratives Lernen, Inklusion, offene Bildung, Weiterbildung, Internationalisierung und digitales Prüfen, dargestellt.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf Handlungsempfehlungen für die Universität Passau. Es werden Vorschläge zur Entwicklung von Ziel- und Implementierungsstrategien, zum Aufbau einer Koordinationseinheit, zur Nutzung und zum Ausbau bereits vorhandener Strukturen, zur Modernisierung von Bildungsräumen und -technologien, zur Etablierung eines kompetenzorientierten E-Assessments und zur Gestaltung einer gemeinschaftlichen Bildungspolitik auf Bundes- und Länderebene vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Diskussionspapiers sind Digitalisierung, Hochschulbildung, E-Learning, Blended Learning, Mediendidaktik, Handlungsempfehlungen, Universität Passau, Pandemie, DiTech, Digitale Lehre, Digitale Bildung, Problemfelder, Chancen, Strategieentwicklung, Koordinationseinheit, Bildungsräume, E-Assessment.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die Corona-Pandemie für die Digitalisierung an der Uni Passau?
Die Pandemie wirkte als Katalysator, der den "Notbetrieb" der Online-Lehre erzwang und Akteure von den Potenzialen digitaler Medien überzeugte.
Was ist das "Transferforum DiTech"?
Ein interdisziplinäres Team aus Didaktikern und Technikern an der Universität Passau, das Dozierende bei der Umstellung auf Online-Lehre unterstützte.
Was sind die größten Herausforderungen beim E-Learning?
Zu den Problemfeldern gehören die Entwicklung einer klaren Strategie, fehlende Organisationsstrukturen, Datenschutzfragen und ein teilweise falsches Verständnis digitaler Bildung.
Welche Chancen bietet die Digitalisierung der Lehre?
Chancen liegen in individualisierten Lernprozessen, kollaborativem Lernen, Inklusion, Internationalisierung und neuen Formen des digitalen Prüfens (E-Assessment).
Was wird der Universität Passau empfohlen?
Empfohlen werden unter anderem der Aufbau einer zentralen Koordinationseinheit, die Modernisierung von Bildungsräumen und die Etablierung kompetenzorientierter Prüfungsformate.
- Quote paper
- Fritz Pflugbeil (Author), Tamara Rachbauer (Author), 2021, Hochschulbildung an der Universität Passau im Zeitalter der Digitalisierung. Herausforderungen, Chancen und Handlungsempfehlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1060809