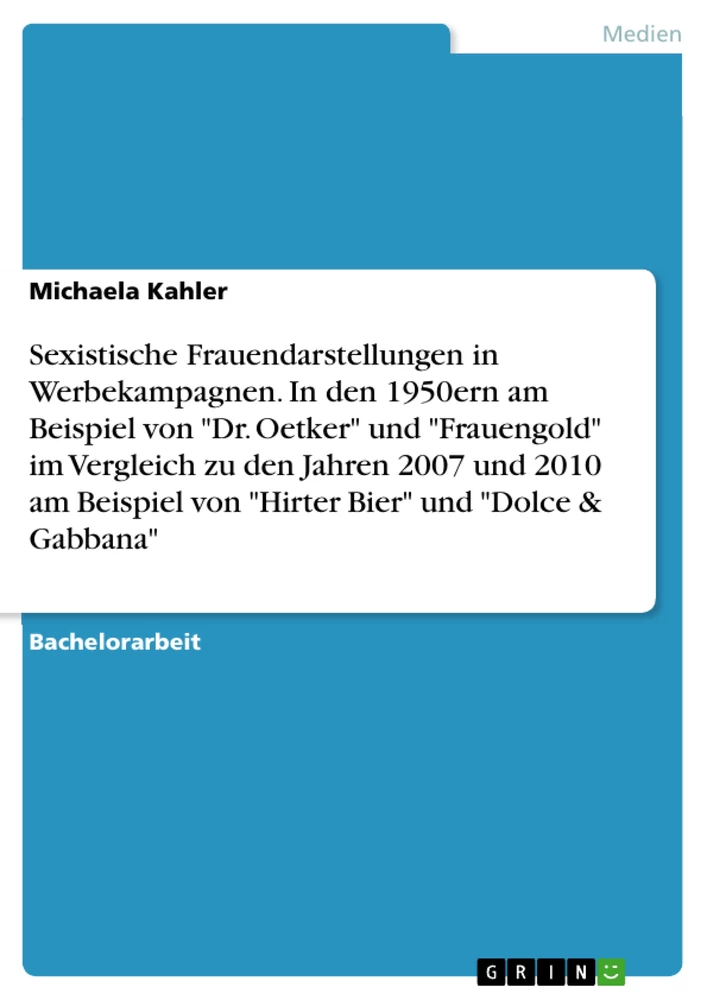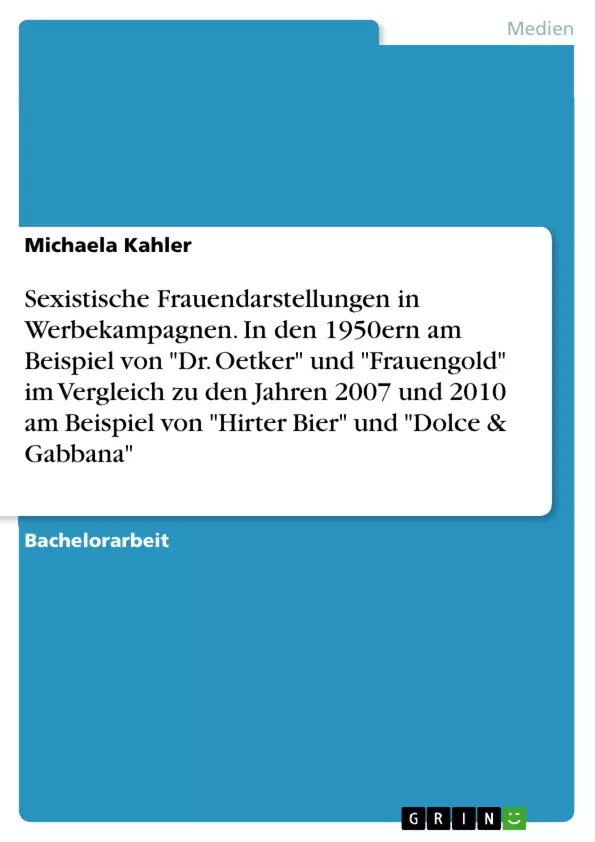Werbung ist heutzutage zu einer Selbstverständlichkeit unseres Lebensalltags geworden, welche wir ohne große Überlegungen hinnehmen. Überall begegnet sie uns – beim Spazieren durch die Stadt, beim Lesen, beim Fernsehen oder beim Surfen durch das Internet. Über Plakate und Werbeclips werden sowohl Botschaften gesendet als
auch Idealbilder verbreitet. Werbung gibt gesellschaftliche Rollenbilder weiter. Die dabei gezeigten Stereotype und Vorurteile beeinflussen die Adressaten und verankern sich in Wertvorstellungen.
Deshalb ist das Ziel dieser Arbeit das Bewusstsein eines jeden zu stärken und auf die tägliche Beeinflussung der verschiedenen Werbesujets gegenüber den Menschen zu richten. Weiters soll auch hervorgehoben werden, dass die Weiblichkeit für Frauen eine Herausforderung ist, da sie sich wegen dieser oft rechtfertigen müssen. Aus diesen
Überlegungen ergibt sich die zentrale Forschungsfrage, ob und wo Kontinuitäten bei den sexistischen Frauendarstellungen in den 50er Jahren und im Jahr 2007 und 2010 vorhanden sind oder in wie weit diese gleichgeblieben sind beziehungsweise sich verändert haben. Trotz vermeintlicher Differenzen in der Präsentation von Frauenbildern in den 50ern und heutzutage, lassen sich bei genauerer Betrachtung einige Parallelen finden. Daher sollen mittels dieser Arbeit Argumente geliefert werden, die belegen, dass die herrschende Meinung, dass eine Entwicklung hin zu einem positiveren Frauenbild stattgefunden hat, nicht vollständig zutreffend ist.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Zu Beginn wird der Fokus auf die Beziehung der (Haus-)Frau zum Fernsehen und in weiterer Folge auf die Beziehung der Soap Opera mit dem weiblichen Alltag gerichtet. Im zweiten Teil wird vorwiegend das Thema Postfeminismus aufgearbeitet, welcher Frauen unter anderem als aktive, sexuell begehrende Subjekte darstellt. Das darauffolgende Kapitel befasst sich mit dem Gleichheitsansatz und der Repräsentationskritik der feministischen Medientheorie, da diese die Ungleichbehandlung der Geschlechter thematisiert. Frauen werden hier als Opfer des Mediensystems, resultierend aus der Dominanz der Männer, angesehen.
Ausgehend von diesen Theorien erfolgt im fünften Teil eine wissenschaftliche Untersuchung der angeführten Werbefälle, um aufzuzeigen ob und wie Frauen in der Werbung diskriminiert werden. Außerdem werden Parallelen und Veränderungen dersexuellen Frauendarstellungen in den 50ern und im Jahr 2007 und 2010 aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- FRAUEN UND FERNSEHEN
- FRAUEN UND HAUSARBEIT
- SOAP OPERAS IM WEIBLICHEN ALLTAGSGESCHEHEN
- FRAUEN UND WERBUNG
- DIE FRAU ALS SEXOBJEKT
- GLEICHHEITSANSATZ UND REPRÄSENTATIONSKRITIK IN DER FEMINISTISCHEN MEDIENTHEORIE
- GLEICHHEITSANSATZ
- REPRÄSENTATIONSKRITIK
- ANALYSE DER FALLBEISPIELE
- 50ER JAHRE
- Dr. Oetker
- Frauengold
- 2007 & 2010
- Hirter Bier
- Dolce&Gabbana
- 50ER JAHRE
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern sexistische Frauendarstellungen in Werbekampagnen der 1950er Jahre im Vergleich zu den Jahren 2007 und 2010 bestehen geblieben oder sich verändert haben. Die Arbeit untersucht, wie die Darstellung von Frauen in Werbung gesellschaftliche Rollenbilder widerspiegelt und die Rezeption von Werbeinhalten beeinflusst.
- Die Rolle von Frauen im Fernsehen und in Soap Operas
- Die Frau als Sexobjekt in der Werbung
- Der Gleichheitsansatz und die Repräsentationskritik in der feministischen Medientheorie
- Analyse von Fallbeispielen aus den 1950er Jahren und den Jahren 2007 und 2010
- Parallelen und Veränderungen in der sexuellen Frauendarstellung in der Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Beziehung der (Haus-)Frau zum Fernsehen und der Rolle von Soap Operas im weiblichen Alltag. Das zweite Kapitel beleuchtet die Darstellung von Frauen im Kontext des Postfeminismus. Das dritte Kapitel behandelt den Gleichheitsansatz und die Repräsentationskritik in der feministischen Medientheorie. Das vierte Kapitel analysiert die Fallbeispiele aus den 1950er Jahren und den Jahren 2007 und 2010, um Parallelen und Veränderungen in der sexuellen Frauendarstellung in der Werbung aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Sexismus in der Werbung, Frauendarstellungen, feministische Medientheorie, Repräsentationskritik, Gleichheitsansatz, Werbekampagnen, 1950er Jahre, 2007, 2010, Dr. Oetker, Frauengold, Hirter Bier, Dolce & Gabbana.
- Quote paper
- Michaela Kahler (Author), 2019, Sexistische Frauendarstellungen in Werbekampagnen. In den 1950ern am Beispiel von "Dr. Oetker" und "Frauengold" im Vergleich zu den Jahren 2007 und 2010 am Beispiel von "Hirter Bier" und "Dolce & Gabbana", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1060820